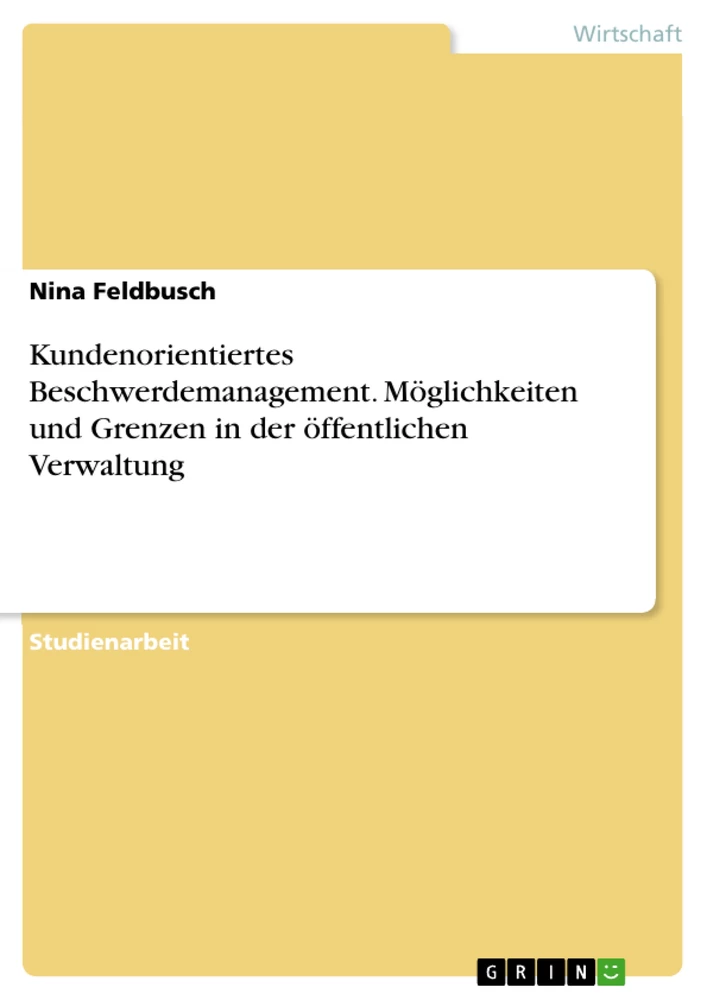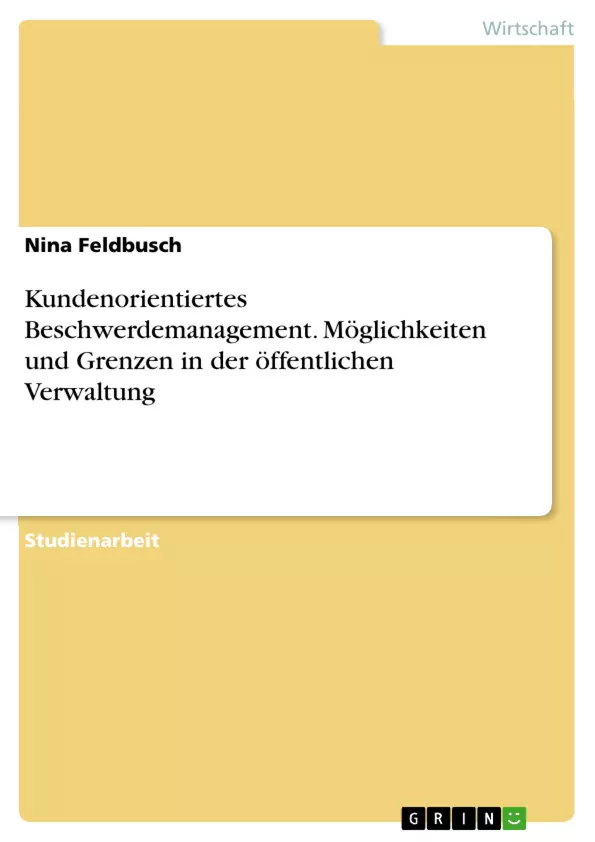Die vorliegende Arbeit wird sich mit einem zentralen Element des „Neuen Steuerungsmodells“ (NSM); der Kundenorientierung, im speziellen dem kundenorientierten Beschwerdemanagement, beschäftigen. Beschwerdemanagement verfolgt in der Regel das Ziel, die Kundenbeziehung zu stabilisieren und die Kundenzufriedenheit wiederherzustellen. Diese Absicht wird in der (Verwaltungs-)Praxis allerdings oftmals verfehlt, sodass Beschwerdeunzufriedenheit bei den Kunden entsteht und zurückbleibt. Es stellt sich daher die Frage wie kundenorientiertes Beschwerdemanagement in der öffentlichen Verwaltung so gestaltet werden kann, dass keine unzufriedenen Beschwerdeführer zurückbleiben.
Vor diesem Hintergrund sollen nachfolgend die Möglichkeiten und Grenzen eines kundenorientierten Beschwerdemanagements analysiert und daraus Handlungsempfehlungen abgeleitet werden. Im Anschluss an die Einleitung soll dafür zunächst die Begrifflichkeit „öffentliche Verwaltung“ definiert und abgrenzt werden. Anschließend werden die Begriffe Kundenorientierung und Beschwerdemanagement dargestellt sowie auf deren Zusammenhang eingegangen. Aufbauend auf diese Grundlagen erfolgt die Analyse der Möglichkeiten und Grenzen, die anschließend in einer kritischen Würdigung diskutiert und mit entsprechenden Handlungsempfehlungen versehen werden. Die Arbeit endet mit einem Fazit.
Seit zwei Jahrzehnten kann ein revolutionärer Veränderungsprozess in den Behörden beobachtet werden. Kommunalverwaltungen werden zur „Dienstleistungsunternehmen“, bei denen auch eine neue Adressatenbestimmung vorgenommen wird. Dabei werden Bürger als Kunden und nicht mehr als „Bittsteller“ betrachtet und anstelle von Bürgernähe ist von Kundenorientierung die Rede. Als Grund für diesen Umbau wird häufig das von der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt) gelieferte NSM angeführt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Begriff „kundenorientiertes Beschwerdemanagement“ in der öffentlichen Verwaltung
- Definition und Abgrenzung „öffentliche Verwaltung“
- Kundenorientierung
- Beschwerdemanagement
- Der direkte Beschwerdemanagementprozess
- Der indirekte Beschwerdemanagementprozess
- Zusammenhang zwischen Kundenorientierung und Beschwerdemanagement
- Möglichkeiten und Grenzen
- Möglichkeiten
- Grenzen
- Kritische Würdigung und Handlungsempfehlungen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert das kundenorientierte Beschwerdemanagement in der öffentlichen Verwaltung. Der Fokus liegt dabei auf der Klärung der Möglichkeiten und Grenzen dieses Instruments in der Praxis. Die Arbeit befasst sich mit der Frage, wie das Beschwerdemanagement so gestaltet werden kann, dass es den Bedürfnissen der Bürger als Kunden gerecht wird und gleichzeitig die Funktionsfähigkeit der Verwaltung gewährleistet.
- Definition und Abgrenzung des Begriffs „öffentliche Verwaltung“
- Darstellung der Konzepte „Kundenorientierung“ und „Beschwerdemanagement“
- Analyse der Möglichkeiten und Grenzen des kundenorientierten Beschwerdemanagements in der öffentlichen Verwaltung
- Entwicklung von Handlungsempfehlungen zur Optimierung des Beschwerdemanagements
- Kritische Würdigung der Ergebnisse der Analyse und Diskussion der Relevanz für die Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit dar und skizziert die Relevanz des Themas „kundenorientiertes Beschwerdemanagement“ in der öffentlichen Verwaltung.
Das zweite Kapitel definiert und grenzt den Begriff „öffentliche Verwaltung“ von privatwirtschaftlichen Unternehmen ab. Es werden die Unterschiede in Bezug auf die Zielsetzung, die Legitimationsanforderungen und die Möglichkeiten der Ressourcenallokation hervorgehoben.
Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit den zentralen Konzepten „Kundenorientierung“ und „Beschwerdemanagement“. Es wird die Bedeutung einer kundenorientierten Ausrichtung der Verwaltung erläutert und die verschiedenen Formen des Beschwerdemanagements vorgestellt.
Das vierte Kapitel analysiert die Möglichkeiten und Grenzen des kundenorientierten Beschwerdemanagements in der öffentlichen Verwaltung. Es werden sowohl Chancen als auch Herausforderungen aufgezeigt, die mit diesem Instrument verbunden sind.
Schlüsselwörter
Kundenorientierung, Beschwerdemanagement, öffentliche Verwaltung, Dienstleistungsqualität, Bürgerbeteiligung, Handlungsempfehlungen, Verwaltungsreform, Kundenbeziehung, Kundenzufriedenheit, Kritikmanagement, Kommunikation
- Quote paper
- Nina Feldbusch (Author), 2020, Kundenorientiertes Beschwerdemanagement. Möglichkeiten und Grenzen in der öffentlichen Verwaltung, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1289210