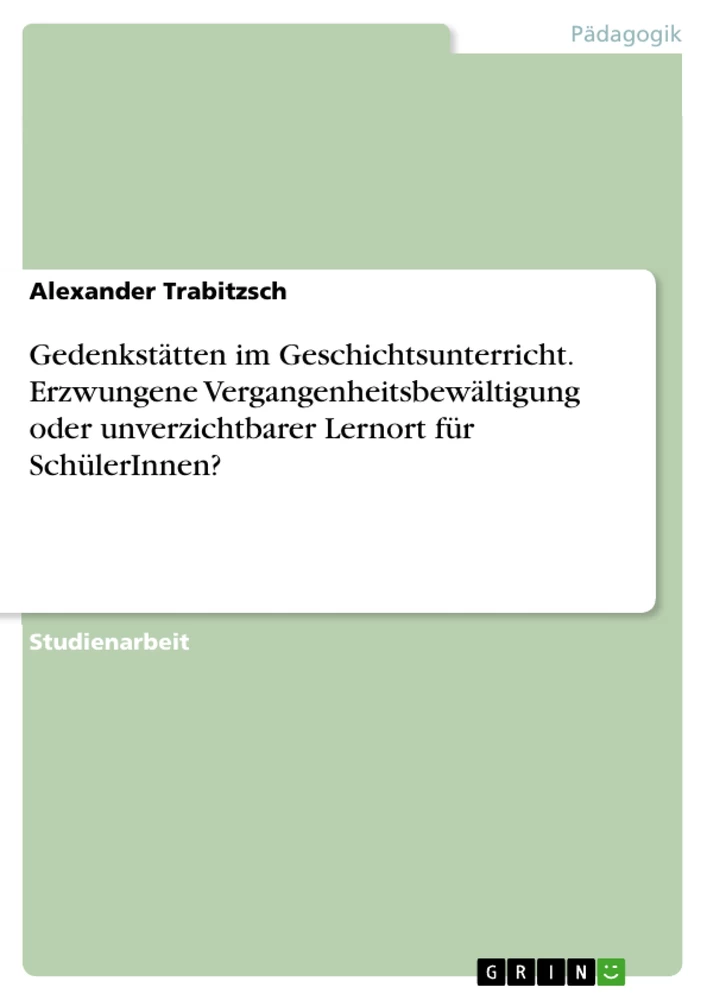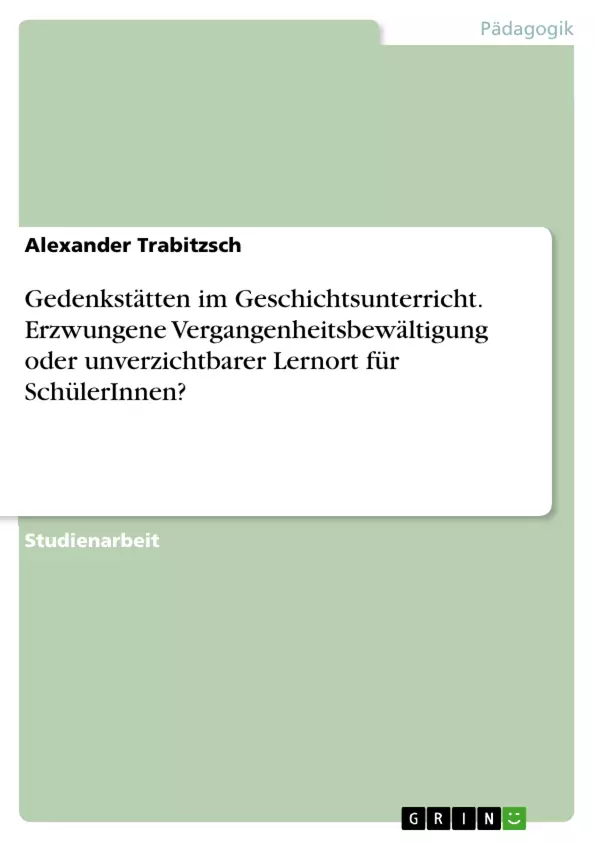Wie kann man SchülerInnen historisches Wissen und emotionale Betroffenheit vermitteln? Wieviel Erinnerung braucht der Mensch und wozu ist Erinnern und Gedenken wichtig? Wann führt Erinnern und Gedenken zum Lernen? Und wo liegen die didaktischen Grenzen ehemaliger Folter- und Vernichtungsstätten als außerschulische Lernorte im Geschichtsunterricht?
Mit wachsendem zeitlichen Abstand, in einer Situation, in der die Erlebnisgenerationen der historischen Ereignisse für ein direktes Gespräch immer weniger zur Verfügung stehen und die Geschichtsbilder der nachwachsenden Generationen zunehmend von Medienbildern geprägt werden, nimmt die Bedeutsamkeit des Themas Gedenkstättenbesuch innerhalb der Geschichtsdidaktik folglich eine durchaus besondere Rolle ein.
Nicht nur, da Besuche in KZ-Gedenkstätten heute ein fester Bestandteil der pädagogischen Arbeit in Schulen und in der außerschulischen politischen Jugendbildung sind, vielmehr stehen Gedenkstätten heute auch vor der wichtigen Aufgabe, demokratische Kompetenzen zu fördern und SchülerInnen überdies für potentielle Gefährdungen der Demokratie zu sensibilisieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffliche Grundlagen
- Gedenkstätte
- Außerschulischer Lernort
- Gedenkstätten als außerschulische Lernorte im Geschichtsunterricht
- Zur didaktischen Bedeutung außerschulischer Lernorte
- Forschungsstand
- Einordnung in den Kernlehrplan
- Möglichkeiten und Grenzen historischen Lernens vor Ort
- Entwicklungstendenzen der Gedenkstättenarbeit
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der Rolle von Gedenkstätten im Geschichtsunterricht. Sie untersucht, ob diese als erzwungene Vergangenheitsbewältigung oder als unverzichtbarer Lernort für SchülerInnen wahrgenommen werden. Die Arbeit analysiert die Begrifflichkeiten "Gedenkstätte" und "Außerschulischer Lernort" und beleuchtet deren Bedeutung für einen zeitgemäßen Geschichtsunterricht.
- Didaktische Bedeutung außerschulischer Lernorte
- Forschungsstand zum Thema Gedenkstätten im Geschichtsunterricht
- Einordnung von Gedenkstätten in den Kernlehrplan
- Möglichkeiten und Grenzen des historischen Lernens an Gedenkstätten
- Entwicklungstendenzen in der Gedenkstättenarbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und beleuchtet die aktuelle Relevanz von Gedenkstätten im Kontext von demokratischer Bildung und Erinnerungskultur. Kapitel 2 erläutert die begrifflichen Grundlagen, indem es die Definitionen von "Gedenkstätte" und "Außerschulischer Lernort" präzisiert und die Bedeutung dieser Einrichtungen für das kollektive Gedächtnis und die politische Selbstdarstellung von Nationalstaaten hervorhebt. Kapitel 3 untersucht die didaktische Bedeutung von Gedenkstätten im Geschichtsunterricht, wobei die Forschungslandschaft, die Einordnung in den Kernlehrplan, die Möglichkeiten und Grenzen des Lernens vor Ort sowie die Entwicklungstendenzen der Gedenkstättenarbeit beleuchtet werden.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem Themenfeld der Gedenkstätten im Geschichtsunterricht, wobei die folgenden Schlüsselwörter im Vordergrund stehen: Gedenkstätten, Außerschulische Lernorte, Geschichtsdidaktik, Erinnerungskultur, demokratische Bildung, Vergangenheitsbewältigung, Forschungsstand, Kernlehrplan, Möglichkeiten und Grenzen des historischen Lernens.
- Arbeit zitieren
- Dipl. Geogr. Alexander Trabitzsch (Autor:in), 2021, Gedenkstätten im Geschichtsunterricht. Erzwungene Vergangenheitsbewältigung oder unverzichtbarer Lernort für SchülerInnen?, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1288226