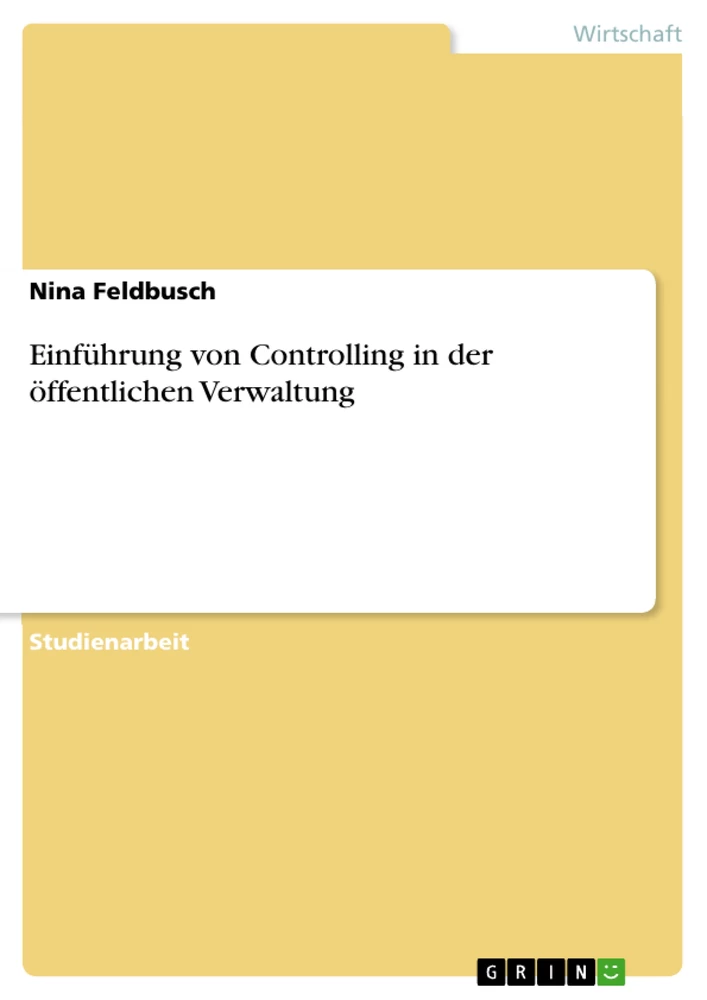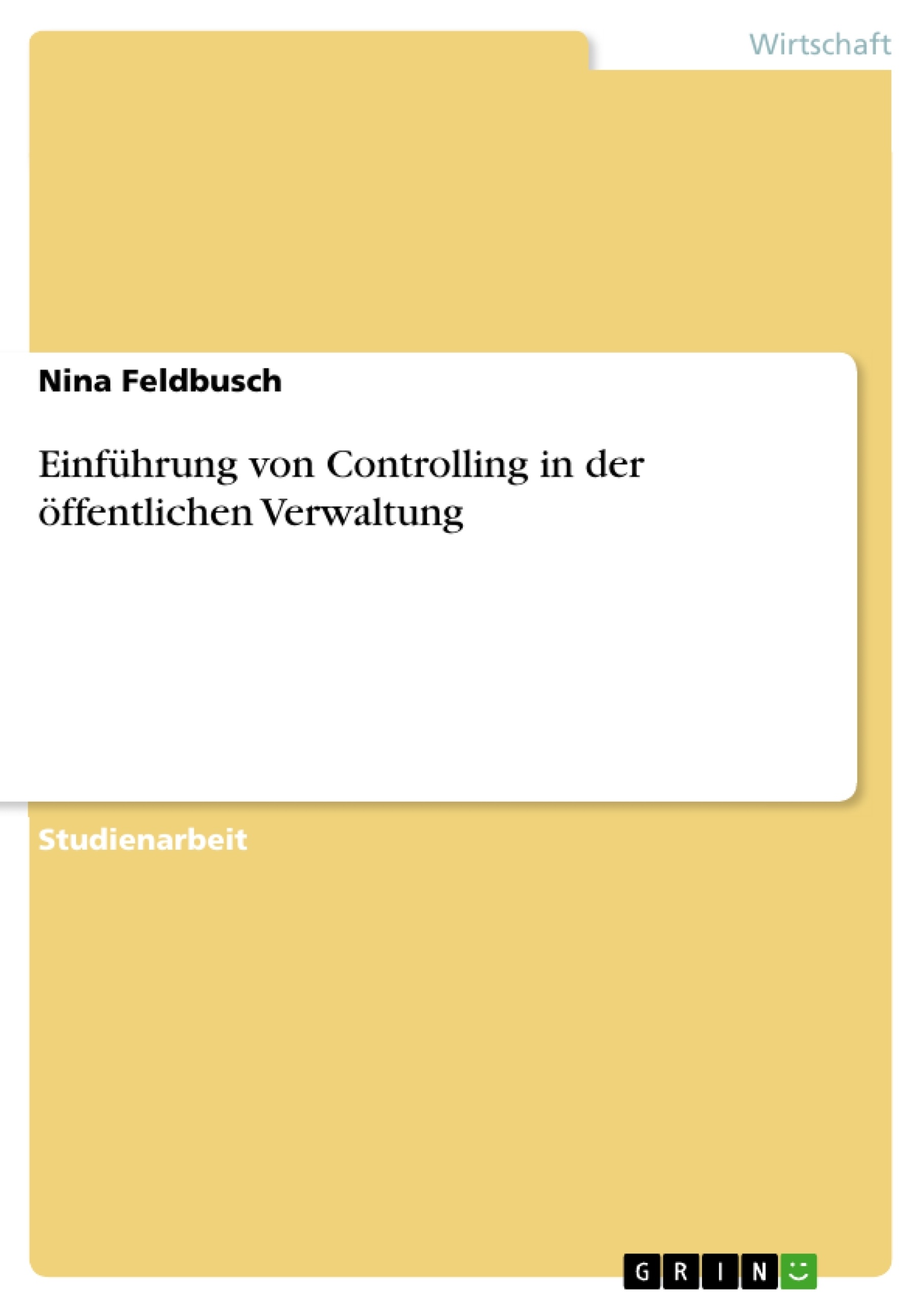Im Anschluss an die Einleitung soll zunächst der Begriff der öffentlichen Verwaltung definiert und von privatwirtschaftlichen Unternehmungen abgegrenzt werden, denn dieses ist für das weitere Verständnis der Arbeit von zentraler Bedeutung. Nachfolgend soll die Begrifflichkeit Controlling näher definiert werden, dessen Gründe und Ziele benannt werden sowie kurz auf die Bedeutung in Deutschland eingegangen werden. Auf diesen Grundlagen aufbauend, kann anschließend der theoretische Rahmen beschrieben werden. Die Arbeit bedient sich dabei am strategischen Controlling-Instrument der BSC. Anschließend erfolgt eine Analyse der Chancen und Risiken, die sich durch die Einführung der BSC ergeben können. Diese sollen nachfolgend diskutiert und mögliche Handlungsempfehlungen ausgesprochen werden. Die Arbeit endet mit einem Fazit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Begriff „Controlling“ in der öffentlichen Verwaltung
- Definition und Abgrenzung „öffentliche Verwaltung“
- Definition „Controlling“
- Gründe und Ziele
- Bedeutung in Deutschland
- Theoretischer Rahmen
- Chancen und Risiken
- Chancen
- Risiken
- Kritische Würdigung und Handlungsempfehlungen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Einführung strategischen Controllings, insbesondere der Balanced Scorecard (BSC), in der öffentlichen Verwaltung. Sie analysiert die Herausforderungen und Möglichkeiten einer solchen Implementierung, berücksichtigt die spezifischen Gegebenheiten der öffentlichen Verwaltung und entwickelt Handlungsempfehlungen für einen erfolgreichen Einführungsprozess.
- Definition und Abgrenzung von Controlling in der öffentlichen Verwaltung
- Analyse der Chancen und Risiken der BSC-Einführung
- Theoretische Fundierung des strategischen Controllings
- Unterschiede zwischen privater Wirtschaft und öffentlicher Verwaltung im Kontext Controlling
- Entwicklung von Handlungsempfehlungen für die Implementierung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Kontext der Arbeit, der durch die Notwendigkeit einer Modernisierung der öffentlichen Verwaltung und die damit verbundene Einführung neuer Steuerungsmodelle geprägt ist. Sie hebt die unzureichende Etablierung von Controlling, insbesondere strategischem Controlling, in der öffentlichen Verwaltung hervor und formuliert die Forschungsfrage nach dem Gelingen der Einführung strategischen Controllings, speziell der Balanced Scorecard (BSC).
Der Begriff „Controlling“ in der öffentlichen Verwaltung: Dieses Kapitel definiert den Begriff der öffentlichen Verwaltung und grenzt ihn von privatwirtschaftlichen Unternehmen ab, wobei die höhere Komplexität und die Besonderheiten des Gemeinwohlorientierten Handelns betont werden. Es folgt eine Definition von Controlling als Führungsservicefunktion und die Unterscheidung zwischen strategischem und operativem Controlling. Die Kapitel unterstreichen die Bedeutung dieser Definitionen als Grundlage für das Verständnis der BSC-Implementierung.
Schlüsselwörter
Controlling, öffentliche Verwaltung, Balanced Scorecard (BSC), strategisches Controlling, operatives Controlling, Neuen Steuerungsmodell (NSM), Gemeinwohlorientierung, Chancen, Risiken, Handlungsempfehlungen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Einführung strategischen Controllings in der öffentlichen Verwaltung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Einführung strategischen Controllings, insbesondere der Balanced Scorecard (BSC), in der öffentlichen Verwaltung. Sie analysiert die Herausforderungen und Möglichkeiten der Implementierung unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten der öffentlichen Verwaltung und entwickelt Handlungsempfehlungen für einen erfolgreichen Einführungsprozess.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit umfasst folgende Themen: Definition und Abgrenzung von Controlling in der öffentlichen Verwaltung, Analyse der Chancen und Risiken der BSC-Einführung, theoretische Fundierung des strategischen Controllings, Unterschiede zwischen privater Wirtschaft und öffentlicher Verwaltung im Kontext Controlling und die Entwicklung von Handlungsempfehlungen für die Implementierung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in die Kapitel Einleitung, Der Begriff „Controlling“ in der öffentlichen Verwaltung (inkl. Definition, Abgrenzung, Gründe und Ziele sowie Bedeutung in Deutschland), Theoretischer Rahmen, Chancen und Risiken, Kritische Würdigung und Handlungsempfehlungen und Fazit. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detaillierter beschrieben.
Was wird unter „Controlling in der öffentlichen Verwaltung“ verstanden?
Die Arbeit definiert den Begriff der öffentlichen Verwaltung und grenzt ihn von privatwirtschaftlichen Unternehmen ab. Controlling wird als Führungsservicefunktion definiert, wobei strategisches und operatives Controlling unterschieden werden. Die Bedeutung dieser Definitionen für das Verständnis der BSC-Implementierung wird hervorgehoben.
Welche Chancen und Risiken werden im Zusammenhang mit der BSC-Einführung betrachtet?
Die Arbeit analysiert sowohl die Chancen als auch die Risiken der Einführung der Balanced Scorecard in der öffentlichen Verwaltung. Konkrete Inhalte werden im entsprechenden Kapitel behandelt.
Welche Handlungsempfehlungen werden gegeben?
Die Arbeit entwickelt konkrete Handlungsempfehlungen für eine erfolgreiche Implementierung strategischen Controllings, speziell der Balanced Scorecard (BSC), in der öffentlichen Verwaltung. Diese Empfehlungen basieren auf den Analysen der Chancen, Risiken und der theoretischen Fundierung.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Controlling, öffentliche Verwaltung, Balanced Scorecard (BSC), strategisches Controlling, operatives Controlling, Neuen Steuerungsmodell (NSM), Gemeinwohlorientierung, Chancen, Risiken, Handlungsempfehlungen.
Was ist die zentrale Forschungsfrage?
Die zentrale Forschungsfrage ist, unter welchen Bedingungen die Einführung strategischen Controllings, speziell der Balanced Scorecard (BSC), in der öffentlichen Verwaltung gelingt.
Wie wird die Einleitung gestaltet?
Die Einleitung beschreibt den Kontext der Arbeit, der durch die Notwendigkeit einer Modernisierung der öffentlichen Verwaltung und die damit verbundene Einführung neuer Steuerungsmodelle geprägt ist. Sie hebt die unzureichende Etablierung von Controlling, insbesondere strategischem Controlling, in der öffentlichen Verwaltung hervor und formuliert die Forschungsfrage.
- Quote paper
- Nina Feldbusch (Author), 2020, Einführung von Controlling in der öffentlichen Verwaltung, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1288004