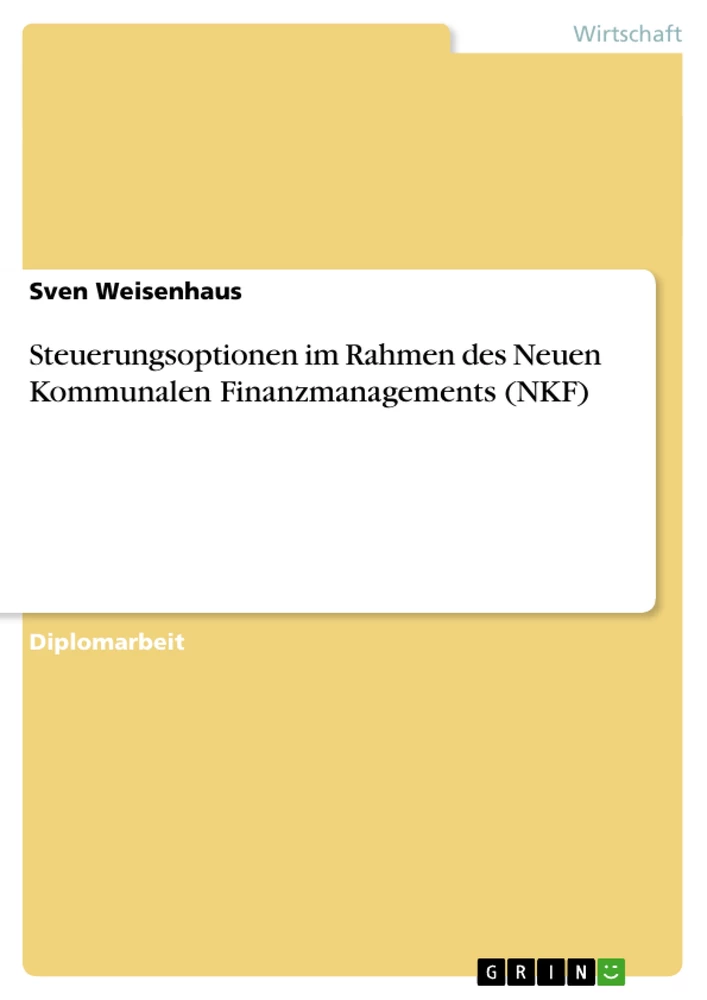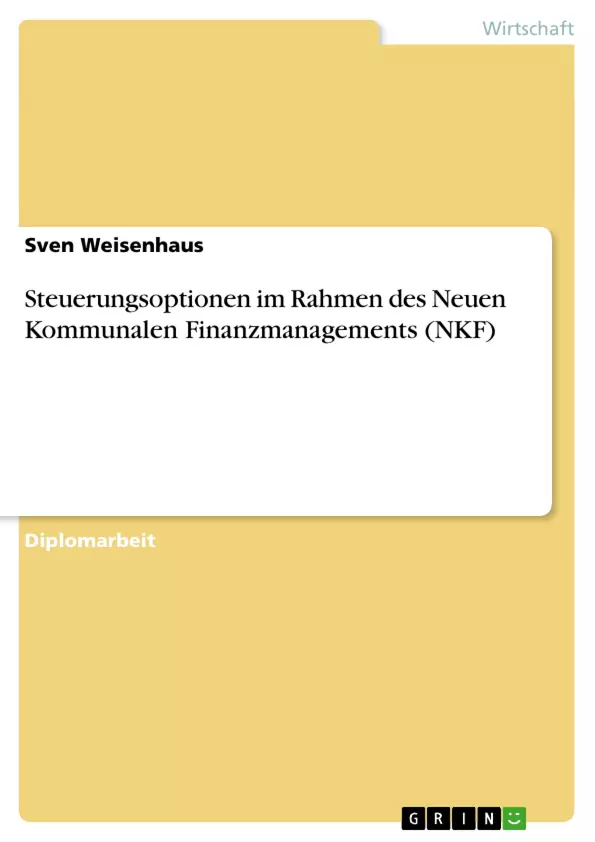Die Modernisierung in den Kommunen wird seit einigen Jahren unter dem Begriff „Neues Steuerungsmodell (NSM)“ betrieben. Die Hauptziele des NSM sind eine höhere Wirtschaftlichkeit und mehr Bürgerorientierung.
Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem „Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF)“, welches als ein Ergebnis des Neuen Steuerungsmodells zu sehen ist. „Neues Kommunales Finanzmanagement“ ist der Begriff für das neue, aus dem Neuen Steuerungsmodell entstandene und auf dem kaufmännischen Rechnungswesen aufbauende, kommunale Rechnungswesen in Nordrhein-Westfalen. Die Kommunen haben sich damit von der kameralen Haushaltsführung verabschiedet und mit der Einführung des kaufmännischen Rechnungswesens eine Grundlage geschaffen, um die Ziele des NSM besser umsetzen zu können.
Die Arbeit soll aufzeigen, dass die Einführung des NKF nicht nur ein finanzwirtschaftlicher Prozess ist, sondern auch betriebswirtschaftliche Steuerungsinstrumente mit sich bringt. Die kaufmännische Buchführung wird hierbei lediglich als das Rechnungswesen gesehen, das am ehesten die nötigen Informationen liefert, um eine neuartige Steuerung der Verwaltung zu ermöglichen. Im Folgenden wird beschrieben, was sich konkret hinter dem Begriff „Neues Kommunales Finanzmanagement“ verbirgt, welche Ziele mit der Reform verbunden sind und welche Steuerungsoptionen das NKF eröffnet, um diese Ziele zu erreichen.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Ziele dieser Arbeit
- Abkürzungsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- 1. Ausgangslage
- 2. Steuerungsmängel in der Kameralistik
- 2.1 Inputorientierte Steuerung
- 2.2 Trennung von Fach- und Ressourcenverantwortung
- 2.3 Unattraktive Arbeitsplätze
- 2.4 Entscheidungskompetenzen nur auf der obersten Ebene
- 2.5 Unzureichende Zielsetzungen
- 2.6 Leistungsdruck von außen
- 3. Das Neue Steuerungsmodell (NSM)
- 4. Der Weg zum neuen Rechnungswesen
- 4.1 Der Reformprozess zum NKF
- 4.2 Das Modellprojekt NKF
- 5. Grundlagen zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF)
- 5.1 Das 3-Komponentensystem des NKF
- 5.1.1 Die Bilanz
- 5.1.2 Der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung
- 5.1.3 Der Finanzplan und die Finanzrechnung
- 5.1.4 Zusammenhang und Wirkung der Komponenten
- 5.2 Der neue Gesamtabschluss im NKF - die Gemeinde als „Gesamtkonzern“
- 5.3 Der Neue Kommunale Haushaltsplan im NKF (NKH)
- 5.4 Der neue Jahresabschluss im NKF
- 5.5 Der Weg zur Eröffnungsbilanz - Die Inventur
- 6. Unterschiede der Doppik gegenüber der Kameralistik
- 6.1 Grundlagen zur Kameralistik
- 6.2 Grundlagen zur kaufmännischen Buchführung
- 6.3 Vollständige Abbildung des Ressourcenverbrauchs
- 6.4 Periodengerechte Zuordnung der Finanzvorfälle
- 6.5 Abschreibungen im NKF
- 6.6 Rückstellungen im NKF
- 7. Haushaltsausgleich im NKF
- 7.1 Wann ist der Haushalt ausgeglichen?
- 7.2 Haushaltsausgleich im Vergleich
- 7.3 Haushaltsausgleich im NKF – Fluch oder Segen?
- 8. Ziele des NKF
- 8.1 Die einzelnen Zielfelder des NKF
- 8.1.1 Darstellung des Vermögens und der Schulden einer Kommune
- 8.1.2 Darstellung der tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnisse
- 8.1.3 Abbildung des vollständigen Ressourcenverbrauchs
- 8.1.4 Keine Fragmentierung des Rechnungswesens im „Konzern Kommune"
- 8.1.5 Intergenerative Gerechtigkeit
- 8.1.6 Produktorientierte Transparenz
- 8.1.7 Darstellung der Liquidität der Kommune
- 8.1.8 Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung
- 9. Neue Steuerungsoptionen im NKF
- 9.1 Produkte als Steuerungsobjekt im NKF
- 9.1.1 Veränderungen der Organisation durch Produktbildung im NKF
- 9.2 Die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) als Steuerungsobjekt im NKF
- 9.3 Ziele und Kennzahlen als Steuerungsobjekt im NKF
- 9.4 Controlling als Steuerungsobjekt im NKF
- 9.5 Budgetierung im Neuen Kommunalen Haushalt als Steuerungsobjekt im NKF
- 10. Fazit
- Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) in Nordrhein-Westfalen und analysiert die Steuerungsoptionen, die dieses neue Rechnungswesen für Kommunen eröffnet. Die Arbeit zielt darauf ab, die Auswirkungen des NKF auf die kommunale Verwaltung zu beleuchten und die Möglichkeiten zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit und Bürgerorientierung aufzuzeigen.
- Steuerungsmängel der Kameralistik
- Ziele und Prinzipien des NKF
- Die drei Komponenten des NKF: Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung
- Steuerungsoptionen im NKF: Produkte, Kosten- und Leistungsrechnung, Ziele und Kennzahlen, Controlling, Budgetierung
- Die Bedeutung des NKF für die kommunale Verwaltung und die Herausforderungen bei der Implementierung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Analyse der Steuerungsmängel der traditionellen Kameralistik, die in der kommunalen Verwaltung vor der Einführung des NKF eingesetzt wurde. Es werden die Schwächen der inputorientierten Steuerung, die Trennung von Fach- und Ressourcenverantwortung, die Unattraktivität von Arbeitsplätzen, die Konzentration von Entscheidungskompetenzen auf der obersten Ebene, unzureichende Zielsetzungen und der fehlende Leistungsdruck von außen aufgezeigt.
Im Anschluss wird das Neue Steuerungsmodell (NSM) vorgestellt, das die Grundlage für die Einführung des NKF bildet. Das NSM zielt auf eine höhere Wirtschaftlichkeit und mehr Bürgerorientierung in der kommunalen Verwaltung ab.
Das Kapitel „Der Weg zum neuen Rechnungswesen“ beschreibt den Reformprozess zum NKF und das Modellprojekt NKF. Es wird erläutert, wie die Kommunen von der kameralen Haushaltsführung zum kaufmännischen Rechnungswesen gewechselt sind.
Das Kapitel „Grundlagen zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF)“ stellt das 3-Komponentensystem des NKF vor, das aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung besteht. Es werden die Zusammenhänge und Wirkungen der einzelnen Komponenten erläutert.
Das Kapitel „Unterschiede der Doppik gegenüber der Kameralistik“ vergleicht die beiden Rechnungssysteme und zeigt die Vorteile der Doppik auf. Es werden die Themen der vollständigen Abbildung des Ressourcenverbrauchs, der periodengerechten Zuordnung von Finanzvorfällen, der Abschreibungen und Rückstellungen im NKF behandelt.
Das Kapitel „Haushaltsausgleich im NKF“ beleuchtet die Bedeutung des Haushaltsausgleichs im neuen Rechnungssystem und stellt ihn in den Vergleich mit der Kameralistik. Es werden die Vor- und Nachteile des Haushaltsausgleichs im NKF diskutiert.
Das Kapitel „Ziele des NKF“ beschreibt die einzelnen Zielfelder des NKF, wie die Darstellung des Vermögens und der Schulden einer Kommune, die Abbildung der tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnisse, die Vermeidung der Fragmentierung des Rechnungswesens, die intergenerative Gerechtigkeit, die produktorientierte Transparenz, die Darstellung der Liquidität und der Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung.
Das Kapitel „Neue Steuerungsoptionen im NKF“ analysiert die Möglichkeiten, die das NKF für die Steuerung der kommunalen Verwaltung bietet. Es werden die Themen Produkte, Kosten- und Leistungsrechnung, Ziele und Kennzahlen, Controlling und Budgetierung im NKF behandelt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF), die Kameralistik, die Doppik, die Steuerung von Kommunen, Wirtschaftlichkeit, Bürgerorientierung, Produkte, Kosten- und Leistungsrechnung, Ziele und Kennzahlen, Controlling, Budgetierung, Haushaltsausgleich, Vermögens- und Schuldenmanagement, Transparenz und Intergenerative Gerechtigkeit.
- Arbeit zitieren
- Sven Weisenhaus (Autor:in), 2007, Steuerungsoptionen im Rahmen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF), München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/128029