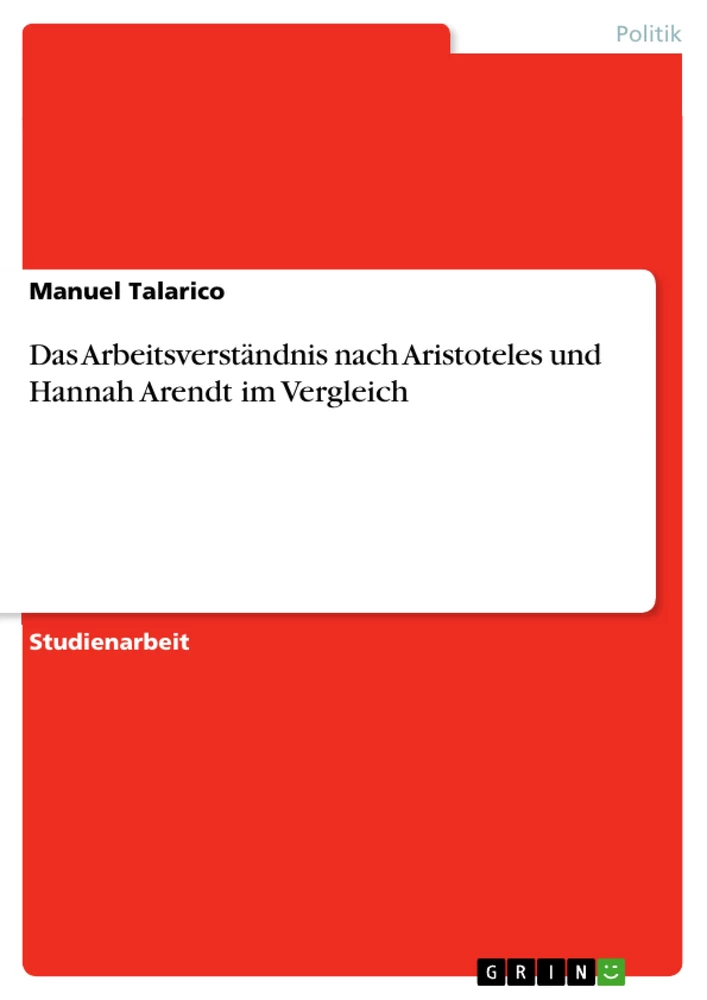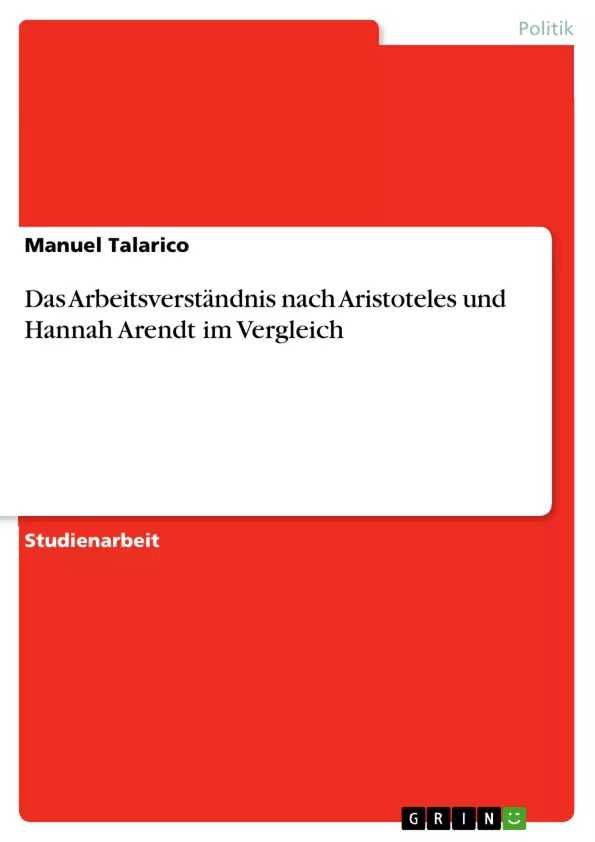Inwiefern spiegelt das Arbeitsverständnis Hannah Arendts die antike Vorstellung Aristoteles' wider? Die Untersuchung möchte gezielt dieser Fragestellung nachgehen und analysieren, inwieweit sich die Definitionen Arendts und Aristoteles' hinsichtlich des Arbeitsbegriffes gleichen. Handelt es sich um eine einfache Reproduktion der antiken Texte durch die jüdische Publizistin oder zeigen sich Weiterentwicklungen und Ergänzungen?
Laut dem Politologen Klaus Schubert ist Arbeit „eine spezifisch menschliche – sowohl körperliche als auch geistige – Tätigkeit, die […] [primär] zur Existenzsicherung […] [dient.]“ Darüber hinaus konstatiert er, dass „Arbeit […] insofern ein gestaltender, schöpferisch produzierender und sozialer, zwischen Individuen vermittelnder Akt“ ist. Dieser komplex anmutenden, modernen Definition des Arbeitsbegriffes geht eine lange Entwicklungsgeschichte voran. So sahen beispielsweise die antiken Philosophen Arbeit als nicht erstrebenswerte Tätigkeit an, die vor allem den Sklaven und Frauen vorbehalten war.
Diese ursprünglich negativ behaftete Konnotation findet sich ebenso in der etymologischen Herkunft des Wortes wieder. So „leitet sich [der Ausdruck] vom indogermanischen Wortstamm orbho ab und erscheint gotisch als arbaiphs, althochdeutsch als arabeit und mittelhochdeutsch als arebit“ und steht für „Mühsal, Plage, Not oder Beschwerde“. Mit den Wortwurzeln rab beziehungsweise rabu („Fronarbeit, Sklave, Knecht“) im Slawischen, dem lateinischen Wort arvum, welches übersetzt einen „gepflückter Acker“ repräsentiert und dem im Französischen verwendeten travail, „was sowohl eine Vorrichtung zum Beschlagen von wilden Pferden wie auch ein Folterwerkzeug meinte“, finden sich weitere abwertende Charakterisierungen. Umso überraschender scheint, dass bei oberflächlichem Studieren der knapp 2000 Jahre jüngeren Werke Hannah Arendts, Aristoteles' überholt-wirkende Auffassungen breite Anwendung finden.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Arbeit - Ein negativ konnotierter Begriff im Wandel der Zeit
- Methode und Gang der Studie
- Literaturbericht
- Deskription
- Aristoteles',,Politik"
- Hannah Arendts „Vita activa oder Vom tätigen Leben“
- Die Arbeit
- Nach Aristoteles
- Nach Hannah Arendt
- Das Herstellen
- Nach Aristoteles
- Nach Hannah Arendt
- Das Handeln
- Nach Aristoteles
- Nach Hannah Arendt
- Fazit - Analogien und Divergenzen der politischen Theorien
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Arbeitsverständnis nach Aristoteles und Hannah Arendt und analysiert deren Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Ziel ist es, die Entwicklung des Arbeitsbegriffs von der Antike bis zur Moderne zu beleuchten und die unterschiedlichen Perspektiven der beiden Denker auf die menschliche Tätigkeit zu vergleichen.
- Entwicklung des Arbeitsbegriffs im Wandel der Zeit
- Arbeit im Kontext der antiken Philosophie
- Das Arbeitsverständnis von Aristoteles
- Das Arbeitsverständnis von Hannah Arendt
- Analogien und Divergenzen der beiden Theorien
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung, die den Begriff der Arbeit im Wandel der Zeit beleuchtet und die Methodik der Studie erläutert. Im zweiten Kapitel werden die zentralen Werke von Aristoteles und Hannah Arendt, die „Politik“ und die „Vita activa oder Vom tätigen Leben“, vorgestellt. Die darauffolgenden Kapitel 3 bis 5 untersuchen die Konzepte von Arbeit, Herstellen und Handeln nach Aristoteles und Arendt im Vergleich.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf den Arbeitsbegriff, das Arbeitsverständnis, die politische Philosophie, Aristoteles, Hannah Arendt, Vita activa, Politik, Tätigkeit, Herstellen, Handeln, Analogien, Divergenzen.
- Quote paper
- Manuel Talarico (Author), 2022, Das Arbeitsverständnis nach Aristoteles und Hannah Arendt im Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1275224