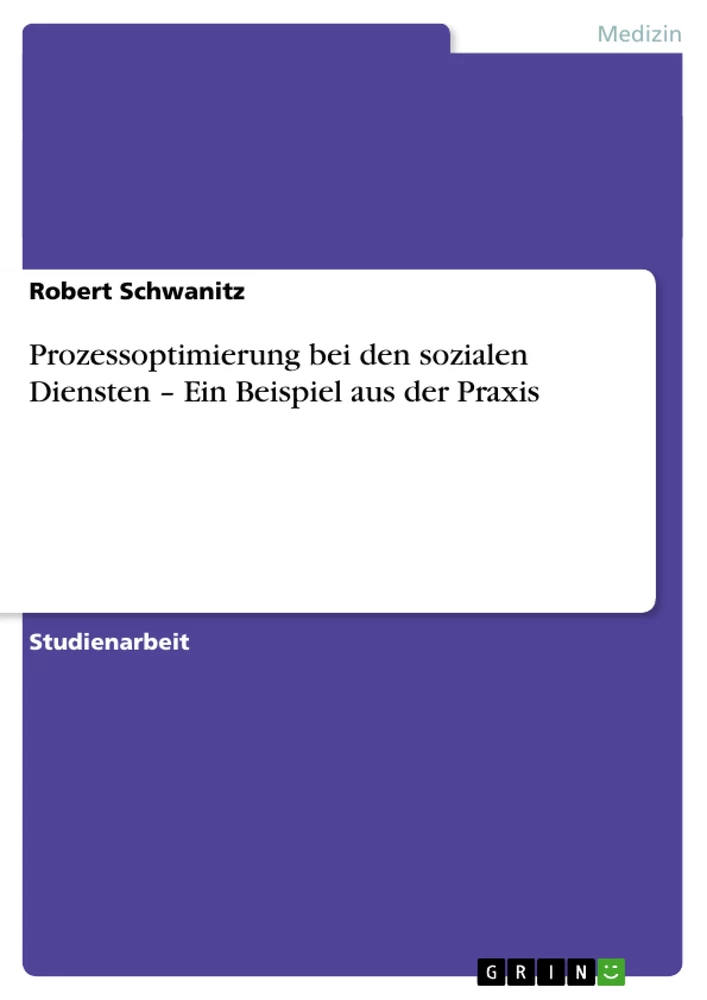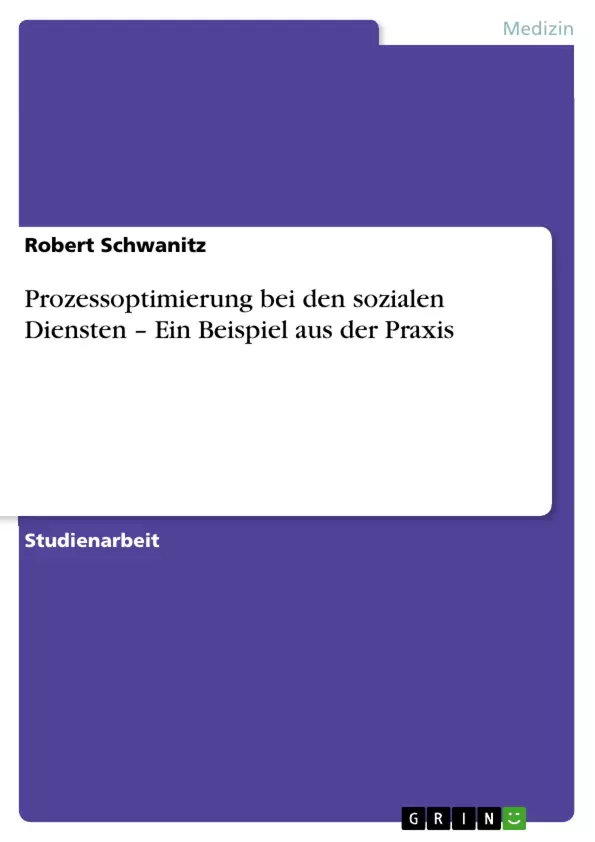Die Einnahmebasis für eine Hauptdomäne der Politik, das Bereitstellen von sozialen Diensten bricht weg, aber der Bedarf steigt stetig. In vielen Bereichen der sozialen Dienste hat die Politik mit Reformen reagiert, um die Fanzierungslücke zu schließen. Auf der einen Seite hat dies eine größere finanzielle Beteiligung für die Inanspruchnahme sozialer Dienste bedeutet. Als Beispiel seien hier nur die 10€ Praxisgebühr im Gesundheitswesen genannt, oder die Beteiligung an Medikamentenkosten. Auf der anderen Seite hat die Politik auch neue Effizienzmaßstäbe für die Anbieter sozialer Dienste festgelegt. Auch hier sei wieder das Gesundheitswesen als Beispiel benannt. Im Bereich der stationären Akutversorgung wurden Fallpauschalen eingeführt, die den Krankenkassen ein höheres Maß an Kontrolle der Krankenhäuser zubilligen. Den Krankenhäusern wird dabei ein Höchstmaß an Wirkkraft abverlangt, da sie dazu aufgerufen sind die Patienten möglichst schnell, effizient und dabei zielführend zu versorgen. Auch im pflegerischen Bereich der stationären und ambulanten Versorgung der älteren Bevölkerung, also im Bereich der Alten- und Seniorenheime so wie der ambulanten Pflegedienste, ist die Belastung gestiegen. Die Pflegesätze sind auf Grund des Kostendrucks in den letzten Jahren weitgehend gleich geblieben, wobei sich der Bedarf u.a. auf Grund des schon erwähnten demographischen Wandels aber auch aus Gründen wie z.B. des medizinischen Fortschritts erhöht hat (vgl. Bogedan, 2008, 214). Hier sind neue kreative Lösungen gefragt, die dazu führen, dass Pflegekräfte von Arbeiten entlastet werden, die nicht direkt mit der Versorgung des Patienten zu tun haben. Effizienzgewinne zu erzielen ist in einer Zeit der knappen Kassen wichtiger denn je.
Ziel dieser Arbeit ist es, exemplarisch an Hand eines vom Land NRW und von der EU geförderten Projekts im Bereich der Arzneimittelversorgung der ambulanten und stationären Altenpflege eine Prozessoptimierung und die Einführung einer neuen DL zu beleuchten. Dabei soll einführend der Bereich der sozialen Dienste dargestellt werden und was darunter zu verstehen ist. Kernstück der Arbeit ist die Darstellung des Projekts „Patientenorientierte Arzneimittelversorgung in Einrichtungen der stationären Altenpflege“. Dabei soll speziell der Bereich der Prozessabläufe und deren Aufnahme in den beteiligten Einrichtungen im Fokus stehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition sozialer Dienste
- Charakteristika Sozialer Dienste / Sozialer DL
- Zwischenfazit
- Einführung Praxisbeispiel: Patientenorientierte Arzneimittelversorgung in stationäre Einrichtungen der Altenpflege
- Ablauf und Projektphasen des Modellprojekts
- Projektphase I: Anforderungsanalyse
- Projektphase II: Erprobungsphase
- Projektphase III: Verbreitung und Testung
- Ergebnisse des Modellprojekts
- Ermittlung des Ist-Zustands vor Einführung der DL
- Umstellung der Belieferung und Ergebnisübersicht
- Ablauf und Projektphasen des Modellprojekts
- Einordung der „patientenindividuellen Arzneimittelversorgung“ in den Kontext sozialer Dienste
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Prozessoptimierung in sozialen Diensten am Beispiel eines Projekts zur patientenorientierten Arzneimittelversorgung in der stationären Altenpflege. Ziel ist es, die Herausforderungen der Effizienzsteigerung im Kontext knapper Ressourcen und steigenden Bedarfs zu beleuchten. Das Projekt dient als Fallstudie zur Analyse von Prozessabläufen und deren Optimierungspotential.
- Prozessoptimierung in sozialen Diensten
- Herausforderungen des demografischen Wandels und des Abbaus sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung
- Finanzierungsprobleme im Sektor der sozialen Dienste
- Einführung neuer Dienstleistungen und deren Auswirkungen
- Analyse eines Praxisbeispiels zur Arzneimittelversorgung in der Altenpflege
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den wachsenden deutschen Dienstleistungssektor und die besondere Rolle der sozialen Dienste, die hauptsächlich öffentlich finanziert werden. Sie beleuchtet die Herausforderungen durch den demografischen Wandel und den Rückgang sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung, die zu Finanzierungsproblemen führen. Die Arbeit fokussiert auf ein Projekt zur Prozessoptimierung in der Arzneimittelversorgung der Altenpflege als Beispiel für innovative Lösungsansätze.
Definition sozialer Dienste: Dieses Kapitel definiert soziale Dienste und deren Charakteristika. Es legt die Grundlage für das Verständnis des Kontextes, in dem das später beschriebene Projekt zur Prozessoptimierung angesiedelt ist. Der Fokus liegt auf der öffentlichen Finanzierung und den damit verbundenen Herausforderungen.
Einführung Praxisbeispiel: Patientenorientierte Arzneimittelversorgung in stationäre Einrichtungen der Altenpflege: Dieses Kapitel stellt das Kernstück der Arbeit dar und beschreibt ein EU- und Land NRW-gefördertes Projekt zur Optimierung der Arzneimittelversorgung in der stationären Altenpflege. Es werden die Projektphasen (Anforderungsanalyse, Erprobungsphase, Verbreitung und Testung) detailliert dargestellt und die Ergebnisse des Projekts bezüglich der Ermittlung des Ist-Zustands und der Umstellung der Belieferung analysiert. Der Fokus liegt auf den Prozessabläufen und deren Verbesserung.
Einordung der „patientenindividuellen Arzneimittelversorgung“ in den Kontext sozialer Dienste: Dieses Kapitel analysiert die Ergebnisse des beschriebenen Projekts und ordnet sie in den breiteren Kontext der sozialen Dienste ein. Es zieht Schlüsse aus den Erfahrungen des Projekts und diskutiert die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf andere Bereiche der sozialen Arbeit. Der Schwerpunkt liegt auf der Verbindung zwischen den Eigenschaften sozialer Dienstleistungen und den im Praxisbeispiel gewonnenen Erkenntnissen.
Schlüsselwörter
Soziale Dienste, Prozessoptimierung, Arzneimittelversorgung, Altenpflege, Demografischer Wandel, Finanzierung, Effizienzsteigerung, Dienstleistungssektor, Modellprojekt, Patientenorientierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Prozessoptimierung in Sozialen Diensten - Fallstudie Arzneimittelversorgung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Prozessoptimierung in sozialen Diensten anhand eines konkreten Projekts zur patientenorientierten Arzneimittelversorgung in der stationären Altenpflege. Sie beleuchtet Herausforderungen der Effizienzsteigerung bei knappen Ressourcen und steigendem Bedarf.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Ziel ist die Analyse der Herausforderungen der Effizienzsteigerung im Kontext knapper Ressourcen und steigenden Bedarfs im Bereich der sozialen Dienste. Das Projekt dient als Fallstudie zur Analyse von Prozessabläufen und deren Optimierungspotenzial.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Themen wie Prozessoptimierung in sozialen Diensten, Herausforderungen des demografischen Wandels und des Abbaus sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung, Finanzierungsprobleme im Sektor der sozialen Dienste, Einführung neuer Dienstleistungen und deren Auswirkungen sowie die Analyse eines Praxisbeispiels zur Arzneimittelversorgung in der Altenpflege.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, eine Definition sozialer Dienste mit Charakteristika, die detaillierte Beschreibung des Praxisbeispiels (patientenorientierte Arzneimittelversorgung in der Altenpflege mit Projektphasen: Anforderungsanalyse, Erprobungsphase, Verbreitung und Testung und den jeweiligen Ergebnissen), die Einordnung des Praxisbeispiels in den Kontext sozialer Dienste und ein Fazit. Es gibt zudem ein Inhaltsverzeichnis und eine Zusammenfassung der Kapitel sowie Schlüsselwörter.
Was wird im Kapitel "Definition sozialer Dienste" behandelt?
Dieses Kapitel definiert soziale Dienste und deren Charakteristika. Es legt die Grundlage für das Verständnis des Kontextes des Projekts zur Prozessoptimierung und fokussiert auf die öffentliche Finanzierung und die damit verbundenen Herausforderungen.
Was wird im Kapitel zum Praxisbeispiel (Arzneimittelversorgung in der Altenpflege) beschrieben?
Dieses Kapitel beschreibt detailliert ein EU- und Land NRW-gefördertes Projekt zur Optimierung der Arzneimittelversorgung in der stationären Altenpflege. Es werden die Projektphasen (Anforderungsanalyse, Erprobungsphase, Verbreitung und Testung) und die Ergebnisse (Ermittlung des Ist-Zustands und Umstellung der Belieferung) analysiert. Der Fokus liegt auf den Prozessabläufen und deren Verbesserung.
Wie werden die Ergebnisse des Praxisbeispiels eingeordnet?
Das Kapitel zur Einordnung analysiert die Ergebnisse des Projekts und ordnet sie in den Kontext der sozialen Dienste ein. Es zieht Schlüsse aus den Erfahrungen des Projekts und diskutiert die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf andere Bereiche der sozialen Arbeit.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Soziale Dienste, Prozessoptimierung, Arzneimittelversorgung, Altenpflege, Demografischer Wandel, Finanzierung, Effizienzsteigerung, Dienstleistungssektor, Modellprojekt, Patientenorientierung.
- Quote paper
- Robert Schwanitz (Author), 2008, Prozessoptimierung bei den sozialen Diensten – Ein Beispiel aus der Praxis, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/127353