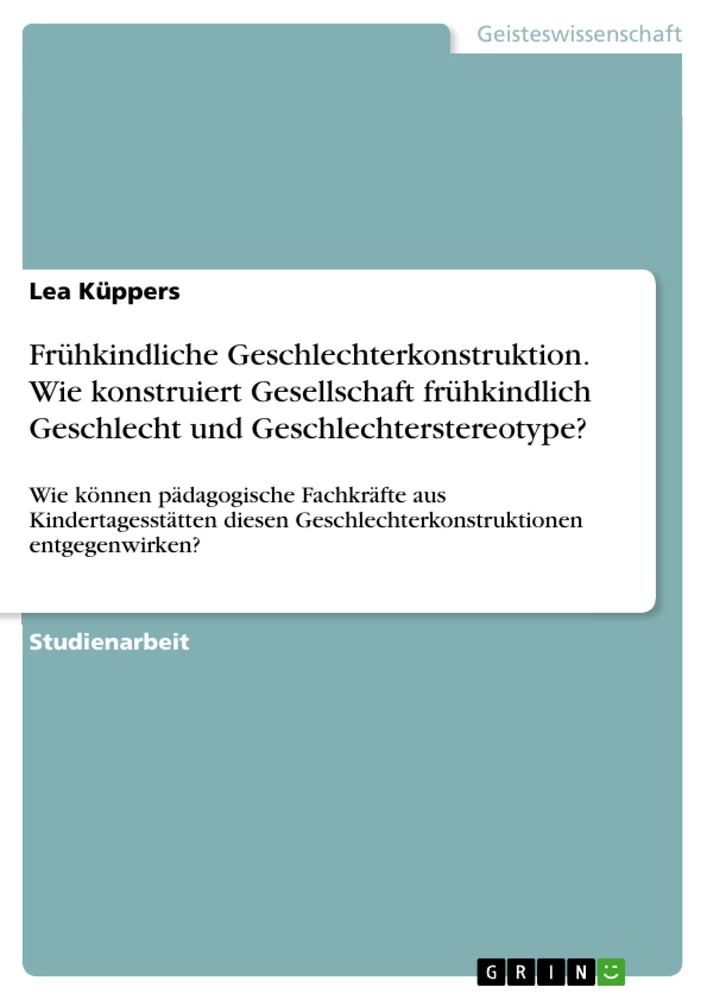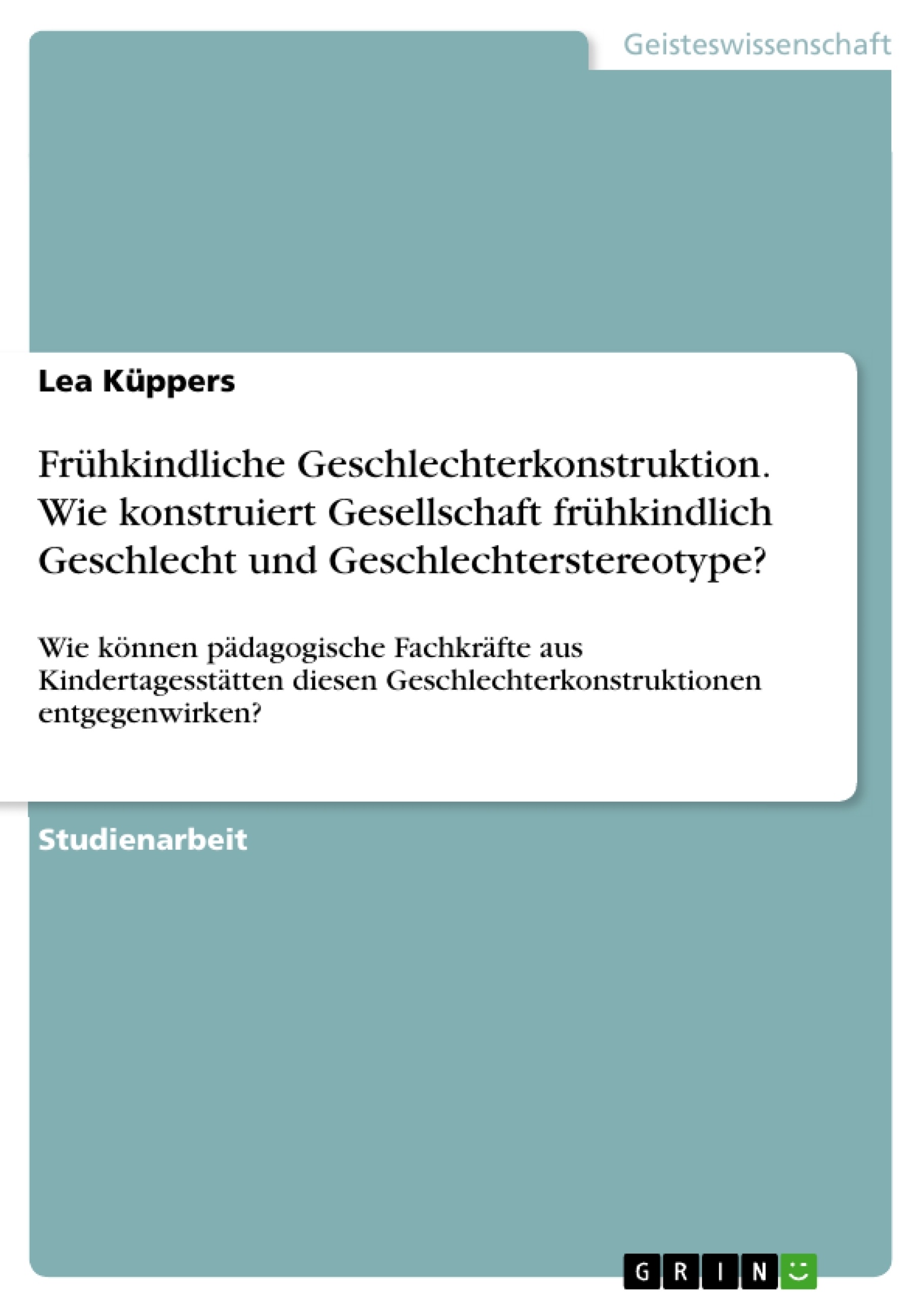Die Stigmatisierungen im Bezug auf das Geschlecht werden stetig durch soziale Interaktionen weitergegeben und manifestieren sich somit in der Bevölkerung. Diese Hypothese und die grundlegende Frage, wie die Tradierung von Geschlechterbildern im Kontext des Aufwachsens verläuft, sind dominierende Diskussionspunkte dieser Ausarbeitung. Abschließend wird auf die vorher aufgekommenen Fragestellungen aufbauend erläutert, wie Fachkräfte aus sozialen Institutionen wie Kindertagesstätten diesen präsenten Geschlechtsstereotypen und der essentialistischen Annahme eines natürlichen Geschlechts schon im Kindesalter entgegenwirken können und warum gerade männliche Fachkräfte in der Pädagogik so wichtig sind.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische Grundlagen
- 2.1 Geschlecht
- 2.1.1 Das biologische Geschlecht
- 2.1.2 Das soziale Geschlecht
- 2.1.3 Zweigeschlechtlichkeit
- 2.2 Pädagogische Fachkräfte
- 2.3 Elementarbereiche (Kindergärten/Kitas)
- 3. Das System der Zweigeschlechtlichkeit
- 3.1. Das Konstruieren von Geschlechterrollen durch die Spielzeugbranche
- 3.2. Die Vermittlung von geschlechtertypischer Aufgabenverteilung
- 4. Geschlechterdifferenzierung und pädagogische Fachkräfte
- 4.1 Die Minderheit der Männer in der Pädagogik
- 4.2 Wie können pädagogische Fachkräfte Stereotypenbildung entgegenwirken?
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Konstruktion von Geschlecht und Geschlechterstereotypen in der Gesellschaft und untersucht, wie pädagogische Fachkräfte in Kindertagesstätten diesen entgegenwirken können. Ziel ist es, die Entstehung und Perpetuierung von Geschlechterrollen und -stereotypen zu analysieren und Wege aufzuzeigen, um eine inklusive und gerechte Bildung für alle Kinder zu fördern.
- Die Konstruktion von Geschlecht und Geschlechterstereotypen in der Gesellschaft
- Die Bedeutung von Sozialisationsprozessen für die Entwicklung von Geschlechtsidentität
- Die Rolle pädagogischer Fachkräfte in der Vermittlung von Geschlechterrollen und -stereotypen
- Mögliche Strategien zur Gegenwirkung gegen Geschlechterstereotype in Kindertagesstätten
- Die Bedeutung von männlichen Fachkräften in der Pädagogik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Relevanz des Themas Geschlecht und Geschlechterstereotype hervorhebt und den Fokus der Arbeit auf die Analyse der Konstruktion von Geschlechterrollen und die Rolle pädagogischer Fachkräfte in diesem Kontext setzt.
Das zweite Kapitel befasst sich mit den theoretischen Grundlagen des Themas Geschlecht. Es werden verschiedene Definitionen von Geschlecht, darunter das biologische, das soziale und das konstruierte Geschlecht, beleuchtet. Weiterhin werden die Rolle von Pädagogischen Fachkräften und die Besonderheiten des Elementarbereichs (Kindergärten/Kitas) erläutert.
Kapitel 3 analysiert das System der Zweigeschlechtlichkeit, die in der Gesellschaft als biologisch gegeben wahrgenommen wird. Hierbei werden die Rolle der Spielzeugbranche und die Vermittlung von geschlechtertypischer Aufgabenverteilung im Hinblick auf die Konstruktion von Geschlechterrollen untersucht.
Im vierten Kapitel wird die Geschlechterdifferenzierung im Kontext von pädagogischen Fachkräften analysiert. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Minderheit der Männer in der Pädagogik gelegt und die Frage, wie pädagogische Fachkräfte Stereotypenbildung entgegenwirken können, behandelt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Themen Geschlecht, Geschlechterstereotype, Sozialisation, Pädagogische Fachkräfte, Kindertagesstätten, Zweigeschlechtlichkeit, Geschlechterrollen, Stereotypenbildung und inklusive Bildung. Im Fokus stehen insbesondere empirische Forschungsarbeiten, die die Entstehung und Perpetuierung von Geschlechterstereotypen beleuchten und die Bedeutung von frühkindlicher Bildung für die Entwicklung von Geschlechteridentität hervorheben.
- Quote paper
- Lea Küppers (Author), 2019, Frühkindliche Geschlechterkonstruktion. Wie konstruiert Gesellschaft frühkindlich Geschlecht und Geschlechterstereotype?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1271676