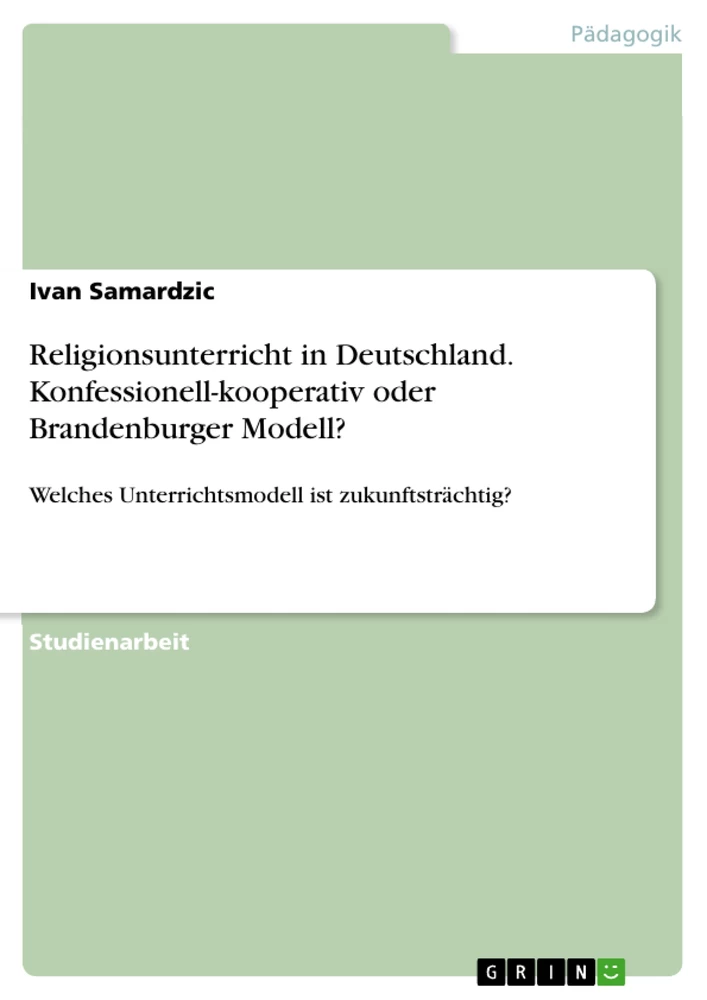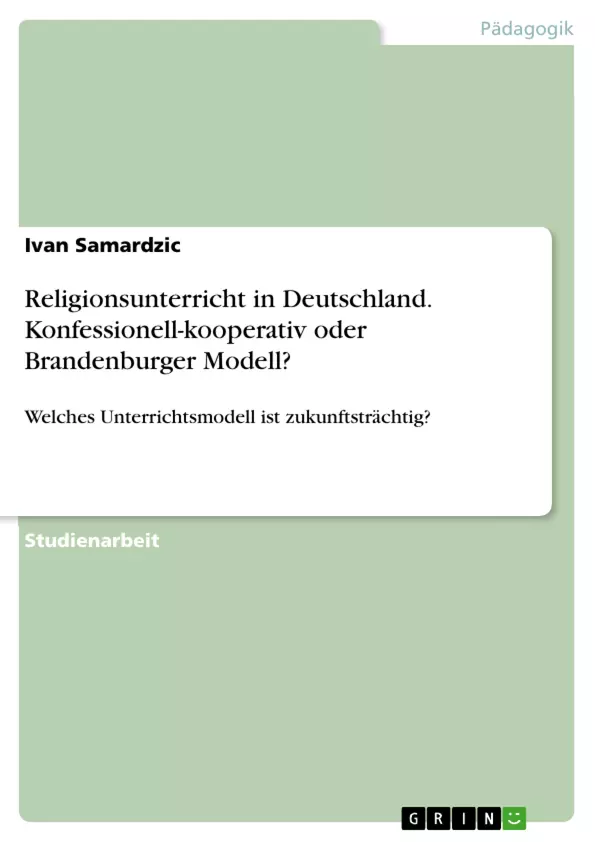Betrachtet man mögliche Unterschiede bezüglich des Religionsunterrichts innerhalb von Deutschland, so fällt schnell die immer wiederkehrende Verschiedenheit zwischen West- und Ostdeutschland auf. In dieser Arbeit soll der Blick auf diese Verschiedenheit gerichtet werden. Dies geschieht, indem zum einen das Modell des konfessionell-kooperativen Unterrichts, welches in Westdeutschland eine große Beliebtheit genießt und zum anderen das Brandenburger Modell, das – wie der Name es bereits vermuten lässt – in Ostdeutschland der Vorreiter ist, untersucht wird. Auf diese Weise soll die Frage untersucht werden, welches der beiden Modelle in der Postmoderne und somit auch für die Zukunft des Religionsunterrichts an den Schulen Deutschlands besser geeignet ist.
Im ersten Schritt wird der konfessionell-kooperative Unterricht genauer beleuchtet, indem zunächst grundlegende Dinge erwähnt werden, bevor über eine mögliche Gestaltung und die Ziele des Unterrichts gesprochen wird. Abschließend wird der Blick auf das interreligiöse Lernen gerichtet, welches in der zunehmend pluralen Gesellschaft immer bedeutsamer wird. Daraufhin wird das Brandenburger Modell thematisiert. Wo liegen dessen Ursprünge? Aus welchen Bausteinen besteht der Unterricht? Wie sehr wird er von äußeren Einflüssen geprägt? Auch hier wird zum Abschluss das interreligiöse Lernen besprochen.
Abgeschlossen wird die Arbeit mit einem Fazit, in dem die Erkenntnisse des vorherigen Kapitels prägnant wiederholt werden, wobei der Fokus auf den Stärken und Schwächen der jeweiligen Modelle liegt. Anhand dieses Vergleichs soll dann eine Antwort auf die Frage, welches der Modelle zukunftsträchtiger erscheint, gegeben werden bzw. ein allgemeiner Ausblick in die Zukunft des deutschen Religionsunterrichts erfolgen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Modelle des Religionsunterrichts
- Konfessionell-kooperativer Unterricht
- Brandenburger Modell
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die zwei dominanten Modelle des Religionsunterrichts in Deutschland - das konfessionell-kooperative Modell und das Brandenburger Modell - und analysiert deren Eignung für die Zukunft des Religionsunterrichts im Kontext der Postmoderne. Ziel ist es, die Stärken und Schwächen beider Modelle zu beleuchten und eine zukunftsorientierte Perspektive für den Religionsunterricht zu entwickeln.
- Konfessionell-kooperativer Unterricht in Westdeutschland
- Brandenburger Modell in Ostdeutschland
- Interreligiöses Lernen in der pluralen Gesellschaft
- Zukunftsfähigkeit der Modelle im Kontext der Postmoderne
- Stärken und Schwächen beider Modelle
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema des Religionsunterrichts ein und beleuchtet die unterschiedlichen Zielsetzungen innerhalb Europas. Das Kapitel „Die Modelle des Religionsunterrichts“ fokussiert zunächst auf den konfessionell-kooperativen Unterricht, der in Westdeutschland verbreitet ist. Es werden die Gestaltungsmöglichkeiten, die Ziele und das interreligiöse Lernen in diesem Modell betrachtet. Anschließend wird das Brandenburger Modell vorgestellt, dessen Ursprünge, Merkmale und Einflüsse beleuchtet werden. Der Fokus liegt dabei auch auf dem interreligiösen Lernen im Brandenburger Modell.
Schlüsselwörter
Konfessionell-kooperativer Unterricht, Brandenburger Modell, Religionsunterricht in Deutschland, Postmoderne, Interreligiöses Lernen, Ökumene, Pluralität, Identitätsbildung, Unterrichtsgestaltung, Stärken und Schwächen der Modelle, Zukunftsperspektive.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen dem Religionsunterricht in West- und Ostdeutschland?
In Westdeutschland ist das konfessionell-kooperative Modell weit verbreitet, während in Ostdeutschland das sogenannte Brandenburger Modell als Vorreiter gilt.
Was charakterisiert den konfessionell-kooperativen Unterricht?
Dieses Modell setzt auf die Zusammenarbeit verschiedener christlicher Konfessionen und zielt darauf ab, Identität zu bilden und gleichzeitig die Ökumene zu fördern.
Was versteht man unter dem Brandenburger Modell?
Das Brandenburger Modell ist ein spezifischer Ansatz des Religionsunterrichts in Ostdeutschland, der stark von den dortigen gesellschaftlichen und historischen Rahmenbedingungen geprägt ist.
Welche Rolle spielt interreligiöses Lernen in der heutigen Gesellschaft?
In einer zunehmend pluralen Gesellschaft ist interreligiöses Lernen essenziell, um Verständnis für verschiedene Glaubensrichtungen zu wecken und ein friedliches Miteinander zu fördern.
Welches Modell gilt als zukunftsträchtiger für den Religionsunterricht?
Die Arbeit vergleicht die Stärken und Schwächen beider Modelle im Kontext der Postmoderne, um eine Empfehlung für die zukünftige Gestaltung des Religionsunterrichts in Deutschland zu geben.
- Arbeit zitieren
- Ivan Samardzic (Autor:in), 2020, Religionsunterricht in Deutschland. Konfessionell-kooperativ oder Brandenburger Modell?, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1268982