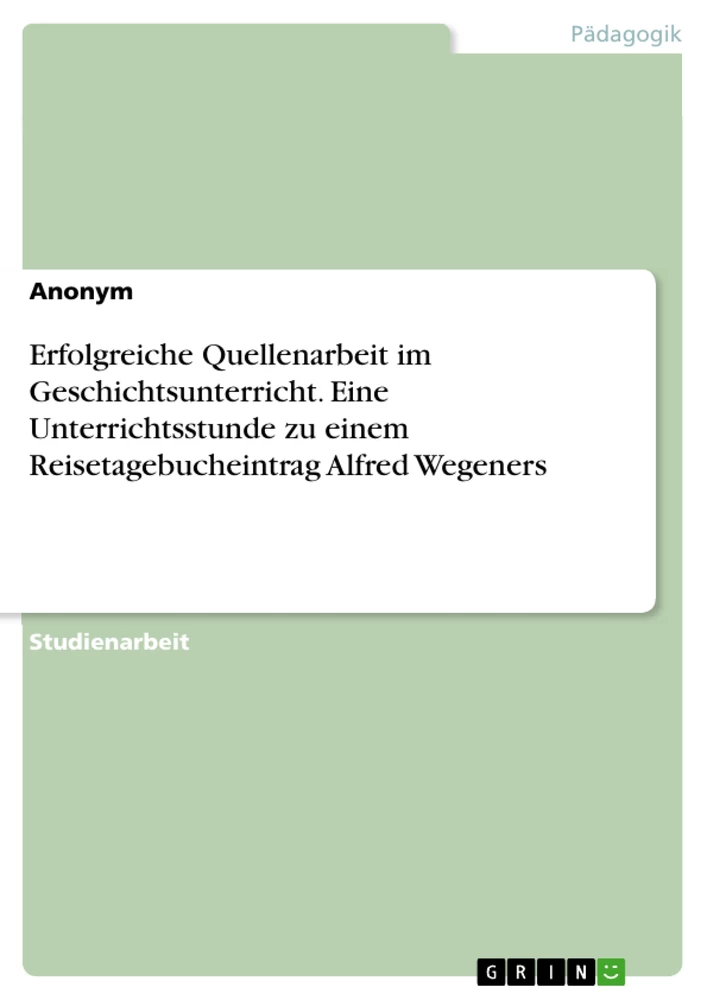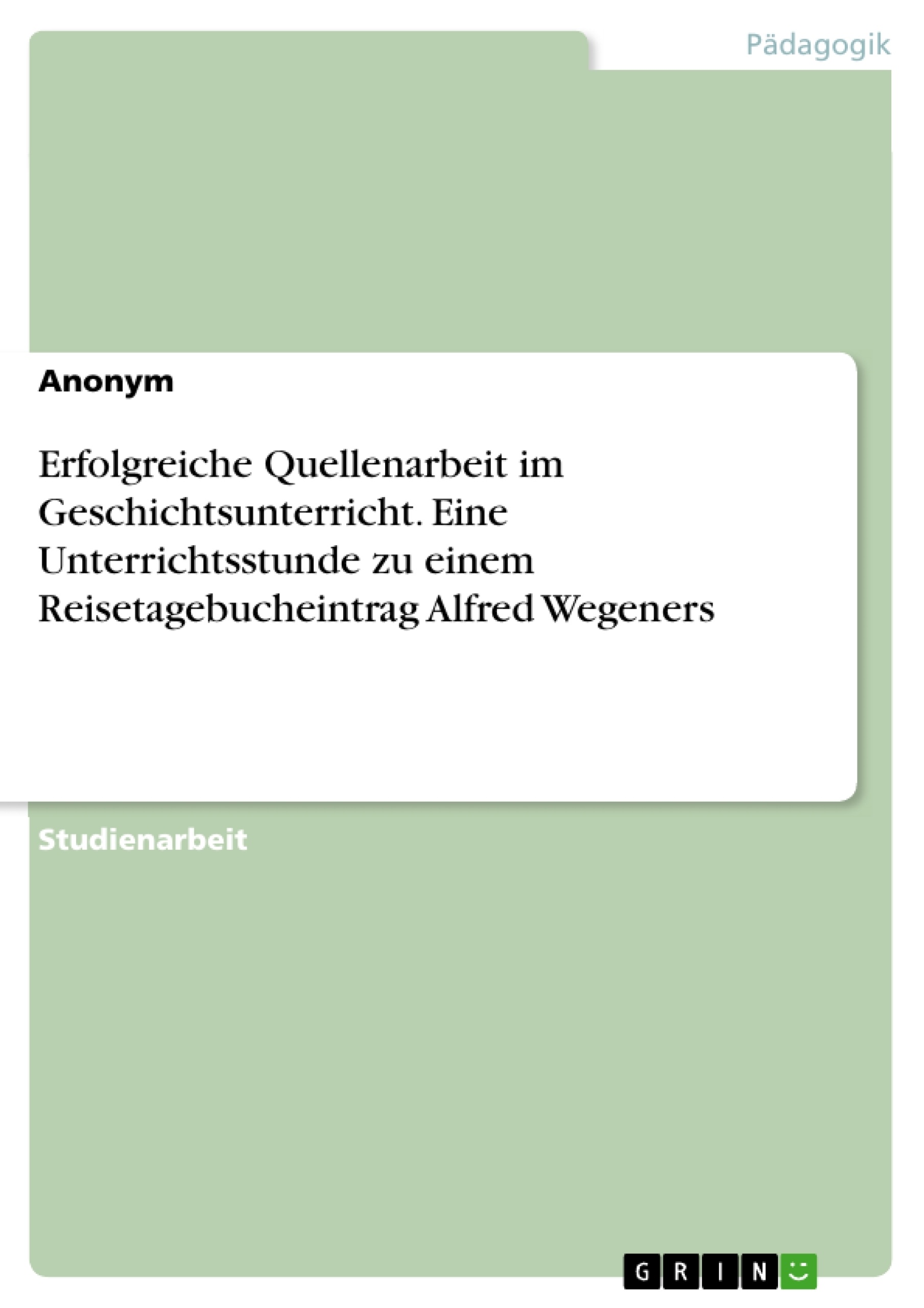Im Rahmen dieser Hausarbeit wird der Ursprung und der aktuelle Forschungsstand von Quellenarbeit im schulischen Geschichtsunterricht dargelegt, bevor eine exemplarische Unterrichtsstunde zum Thema Wissenschaftsreisen präsentiert und geschichtsdidaktisch verortet wird.
Historische Quellen stellen für die Geschichtswissenschaften den Ursprung allen Wissens über die Vergangenheit dar. Um Schüler*innen einen realistischen Eindruck davon zu vermitteln, wie die Arbeit von Historiker*innen verläuft, und sie dazu zu befähigen, sich selbst ein Urteil über den Aussagewert von Quellen vergangener Zeit zu machen, stellt die Arbeit mit historischen Quellen das Fundament dar, auf Basis dessen Geschichte in Deutschland unterrichtet wird.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Quellengattungen und ihre Besonderheiten
- 2.1 Der besondere Stellenwert der Textquellen
- 2.2 Das Reisetagebuch als Quelle
- 3. Historische Quellen als Kernelement des Geschichtsunterrichts
- 3.1 Prinzipien zur Gestaltung des schulischen Geschichtsunterrichts
- 3.2 Kernlehrplan des Fachs Geschichte in Nordrhein-Westfalen
- 4. Alfred Wegeners Reisetagebuch im Geschichtsunterricht
- 4.1 Sachanalyse
- 4.2 Didaktische Analyse und Lernzielformulierung
- 4.3 Methodische Analyse
- 4.4 Verlaufsplan
- 5. Zusammenfassung der Ergebnisse
- 5.1 Fazit
- 5.2 Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung historischer Quellen im Geschichtsunterricht und zeigt anhand einer konkreten Unterrichtsplanung auf, wie die Arbeit mit Quellen erfolgreich und kompetenzorientiert gestaltet werden kann. Der Fokus liegt auf der Verwendung eines Reisetagebuchs von Alfred Wegener. Die Arbeit beleuchtet den Stellenwert von Textquellen, insbesondere von Reisetagebüchern, und deren didaktische Möglichkeiten im Unterricht.
- Der Stellenwert historischer Quellen im Geschichtsunterricht
- Die didaktische Aufbereitung von Textquellen, speziell Reisetagebüchern
- Kompetenzorientierung im Geschichtsunterricht durch Quellenarbeit
- Analyse und Interpretation von Alfred Wegeners Reisetagebuch
- Konkrete Unterrichtsplanung zur erfolgreichen Quellenarbeit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung betont die zentrale Rolle historischer Quellen für die Geschichtswissenschaft und den Geschichtsunterricht. Sie hebt die Schwierigkeit hervor, die Schüler oft mit der Analyse und Interpretation von Quellen haben, und führt in die Zielsetzung der Arbeit ein: die Entwicklung einer erfolgreichen, kompetenzorientierten Unterrichtsstunde zur Quellenarbeit anhand eines Reisetagebuchs von Alfred Wegener. Die Einleitung verweist auf empirische Studien, die die Defizite im Umgang mit Quellen bei Schülern aufzeigen und begründet somit die Notwendigkeit einer verbesserten Herangehensweise an das Thema im Unterricht.
2. Quellengattungen und ihre Besonderheiten: Dieses Kapitel klassifiziert verschiedene Quellengattungen und hebt den besonderen Stellenwert von Textquellen in der Geschichtswissenschaft und im Geschichtsunterricht hervor. Es werden die Vorzüge von Textquellen bezüglich der Erfassung komplexer historischer Situationen betont. Innerhalb der Textquellen wird die spezifische Bedeutung von Reisetagebüchern als Selbstzeugnisse erläutert, die persönliche Erlebnisse, Gedanken und Befindlichkeiten zeitnah dokumentieren.
3. Historische Quellen als Kernelement des Geschichtsunterrichts: Dieses Kapitel untersucht die Prinzipien der Gestaltung des Geschichtsunterrichts und verweist auf den Kernlehrplan des Fachs Geschichte in Nordrhein-Westfalen. Es stellt den Zusammenhang zwischen der Arbeit mit historischen Quellen und dem Erreichen der im Lehrplan festgelegten Kompetenzen her. Der Abschnitt betont die Notwendigkeit, Schüler nicht nur im Wiedergeben von Fakten, sondern auch in der kritischen Analyse und Interpretation von Quellen zu schulen.
4. Alfred Wegeners Reisetagebuch im Geschichtsunterricht: Dieses Kapitel analysiert das Reisetagebuch von Alfred Wegener im Hinblick auf seine Eignung für den Geschichtsunterricht. Es beinhaltet eine Sachanalyse des Tagebuchs, eine didaktische Analyse mit Formulierung von Lernzielen und eine methodische Analyse der Unterrichtsplanung. Der Fokus liegt auf der Entwicklung eines Verlaufsplans, der die Schüler aktiv in den Prozess der Quellenanalyse und -interpretation einbezieht.
Schlüsselwörter
Historische Quellen, Geschichtsunterricht, Quellenarbeit, Textquellen, Reisetagebuch, Alfred Wegener, Kompetenzorientierung, Didaktik, Unterrichtsplanung, Quellenanalyse, Quelleninterpretation.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse eines Reisetagebuchs von Alfred Wegener im Geschichtsunterricht
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Bedeutung historischer Quellen, insbesondere von Reisetagebüchern, im Geschichtsunterricht. Im Mittelpunkt steht die Entwicklung und Umsetzung einer kompetenzorientierten Unterrichtsstunde anhand eines Reisetagebuchs von Alfred Wegener. Die Arbeit untersucht die didaktische Aufbereitung von Textquellen und die Förderung von analytischen und interpretativen Fähigkeiten der Schüler.
Welche Quellengattungen werden betrachtet?
Die Arbeit konzentriert sich auf Textquellen, insbesondere Reisetagebücher, und beleuchtet deren besonderen Stellenwert im Vergleich zu anderen Quellengattungen. Es wird dargelegt, warum Reisetagebücher als Selbstzeugnisse wertvolle Einblicke in historische Ereignisse und die subjektiven Erfahrungen von Zeitzeugen bieten.
Welche Rolle spielt der Kernlehrplan von Nordrhein-Westfalen?
Der Kernlehrplan des Fachs Geschichte in Nordrhein-Westfalen dient als Referenzrahmen für die didaktische Konzeption der Unterrichtsstunde. Die Arbeit zeigt auf, wie die Arbeit mit dem Reisetagebuch von Alfred Wegener die im Lehrplan festgelegten Kompetenzen der Schüler fördert, insbesondere im Bereich der Quellenanalyse und -interpretation.
Wie wird das Reisetagebuch von Alfred Wegener didaktisch aufgearbeitet?
Das Kapitel 4 beschreibt die detaillierte didaktische Analyse des Reisetagebuchs, inklusive der Formulierung von Lernzielen und einer methodischen Analyse des Unterrichtsverlaufs. Es wird ein konkreter Verlaufsplan vorgestellt, der die Schüler aktiv in den Prozess der Quellenanalyse und -interpretation einbezieht.
Welche Kompetenzen sollen die Schüler durch die Unterrichtsstunde erwerben?
Die Unterrichtsstunde zielt darauf ab, die Kompetenzen der Schüler in der Analyse und Interpretation historischer Quellen zu verbessern. Die Schüler sollen lernen, Informationen aus Textquellen zu extrahieren, diese kritisch zu hinterfragen und in einen historischen Kontext einzuordnen. Die Kompetenzorientierung steht im Mittelpunkt der didaktischen Konzeption.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Historische Quellen, Geschichtsunterricht, Quellenarbeit, Textquellen, Reisetagebuch, Alfred Wegener, Kompetenzorientierung, Didaktik, Unterrichtsplanung, Quellenanalyse, Quelleninterpretation.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Quellengattungen und ihre Besonderheiten, Historische Quellen als Kernelement des Geschichtsunterrichts, Alfred Wegeners Reisetagebuch im Geschichtsunterricht und Zusammenfassung der Ergebnisse (inkl. Fazit und Ausblick).
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit möchte zeigen, wie historische Quellen, speziell Reisetagebücher, erfolgreich und kompetenzorientiert im Geschichtsunterricht eingesetzt werden können. Sie will einen Beitrag zur Verbesserung des Umgangs mit Quellen im Unterricht leisten und konkrete Hilfestellungen für Lehrerinnen und Lehrer bieten.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2021, Erfolgreiche Quellenarbeit im Geschichtsunterricht. Eine Unterrichtsstunde zu einem Reisetagebucheintrag Alfred Wegeners, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1268840