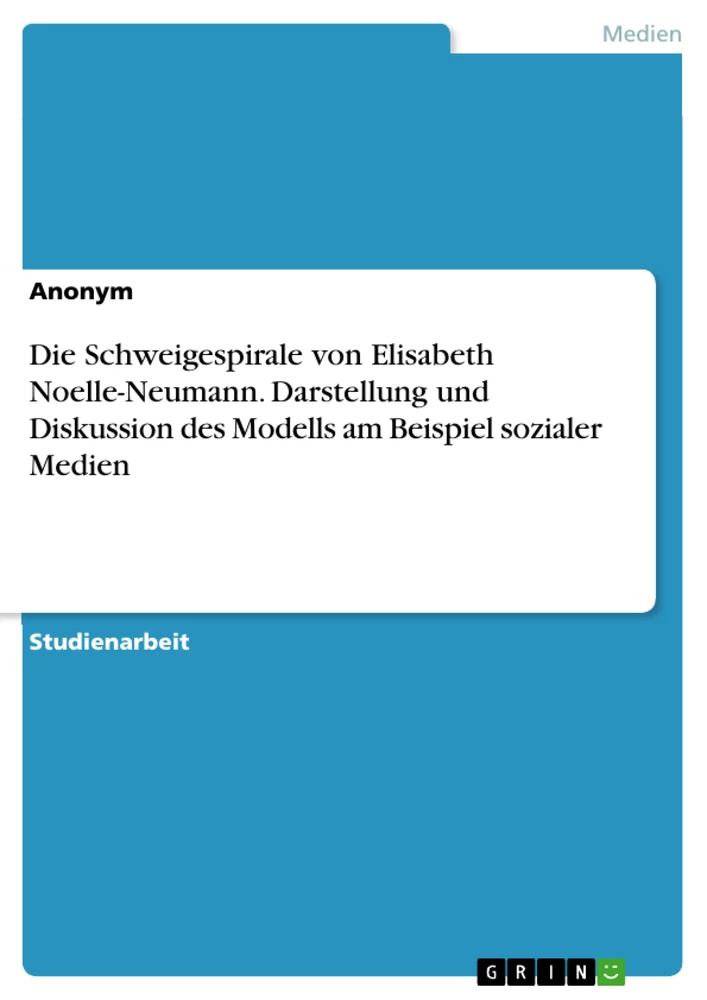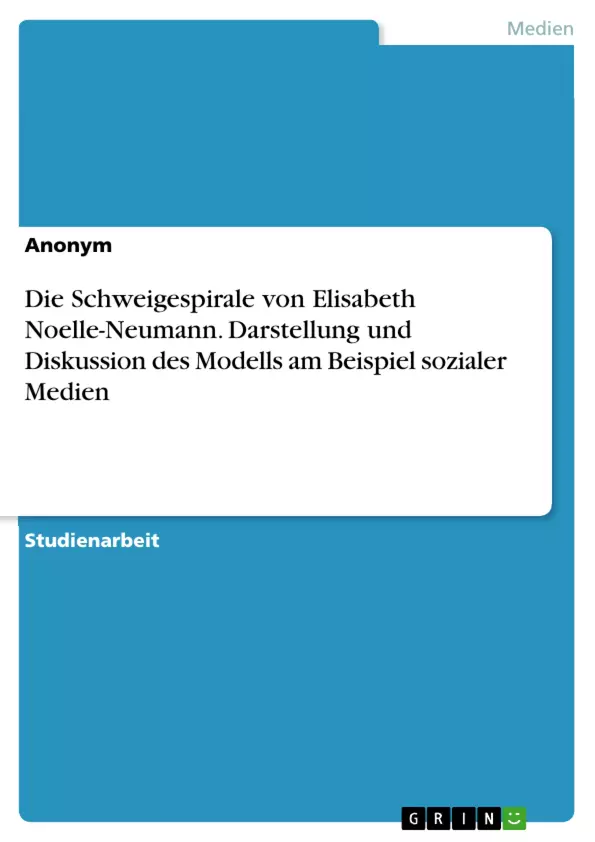Die folgende Arbeit beschäftigt sich mit der Darstellung und Diskussion des Modells der Schweigespirale am Beispiel sozialer Medien. Neben den Offlinemedien wie dem Radio, Fernsehen oder Zeitungen zählen die Onlinemedien im 21. Jahrhundert zu den wichtigsten Anlaufstellen zum Informieren, zum Austausch mit Mitmenschen und zur Unterhaltung. Vor allem die sozialen Medien nehmen seit den 2000ern eine wichtige Rolle im Alltag vieler Menschen ein und sind seitdem Teil von gesellschaftlichen und politischen Diskussionen.
Besonders der Einfluss der Medien auf die individuelle Meinungsbildung und die öffentliche Kundgabe der eigenen Meinung wird in diesem Zusammenhang häufig kritisch betrachtet, und gab bereits in den 1970er Jahren Anlass zur Entstehung einer (kommunikationswissenschaftlichen) Theorie – der Theorie der Schweigespirale von Elisabeth Noelle-Neumann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theorie der Schweigespirale
- Elisabeth Noelle-Neumann
- Idee und Entstehung der Theorie
- Die Grundannahmen der Schweigespirale
- Schweigespirale auf sozialen Medien
- Soziale Medien
- Übertragung der Schweigespirale auf soziale Medien im Sinne von Noelle-Neumann
- Justierung der Schweigespirale auf sozialen Medien
- Echokammer statt Schweigespirale?
- Zusammenfassende Kritik an der Theorie der Schweigespirale
- Kritik an empirischer Vorgehensweise
- Kritik an theoretischer Ausarbeitung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Theorie der Schweigespirale von Elisabeth Noelle-Neumann und untersucht deren Anwendbarkeit im Kontext sozialer Medien. Die Zielsetzung besteht darin, die Theorie darzustellen, zu diskutieren und ihre Relevanz für die Meinungsbildung im digitalen Raum zu beleuchten.
- Die Theorie der Schweigespirale und ihre grundlegenden Annahmen
- Die Anwendung der Theorie auf soziale Medien und ihre Herausforderungen
- Die Rolle von sozialen Medien für die öffentliche Meinungsbildung
- Die Kritik an der Theorie und ihre empirische Gültigkeit
- Die Bedeutung der Schweigespirale für die Meinungsfreiheit im digitalen Zeitalter
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit vor und erläutert die Bedeutung sozialer Medien für die Meinungsbildung im 21. Jahrhundert. Sie führt zudem die Theorie der Schweigespirale ein und skizziert den Schwerpunkt der Arbeit.
- Kapitel 2 beleuchtet die theoretischen Grundlagen der Schweigespirale. Es geht auf Elisabeth Noelle-Neumann ein, beschreibt die Entstehung der Theorie und erläutert die wichtigsten Begriffe im Zusammenhang mit der Schweigespirale, wie die öffentliche Meinung, das Meinungsklima und die Isolationsfurcht.
- Kapitel 3 befasst sich mit der Übertragung der Schweigespirale auf soziale Medien. Es werden die Besonderheiten sozialer Medien im Vergleich zu Offline-Medien diskutiert und es wird untersucht, inwieweit die Theorie auf diese digitalen Plattformen anwendbar ist. Außerdem werden die möglichen Auswirkungen von Echokammern auf die öffentliche Meinungsbildung in sozialen Medien analysiert.
- Kapitel 4 präsentiert eine zusammenfassende Kritik an der Theorie der Schweigespirale. Es werden sowohl empirische als auch theoretische Aspekte der Kritik beleuchtet und es wird diskutiert, welche Einwände gegen die Theorie erhoben werden können.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Begriffen und Konzepten der Kommunikationswissenschaft, insbesondere der Theorie der Schweigespirale, der öffentlichen Meinung, dem Meinungsklima, der Isolationsfurcht, sozialen Medien, Echokammern und der Meinungsfreiheit im digitalen Raum.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2021, Die Schweigespirale von Elisabeth Noelle-Neumann. Darstellung und Diskussion des Modells am Beispiel sozialer Medien, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1268375