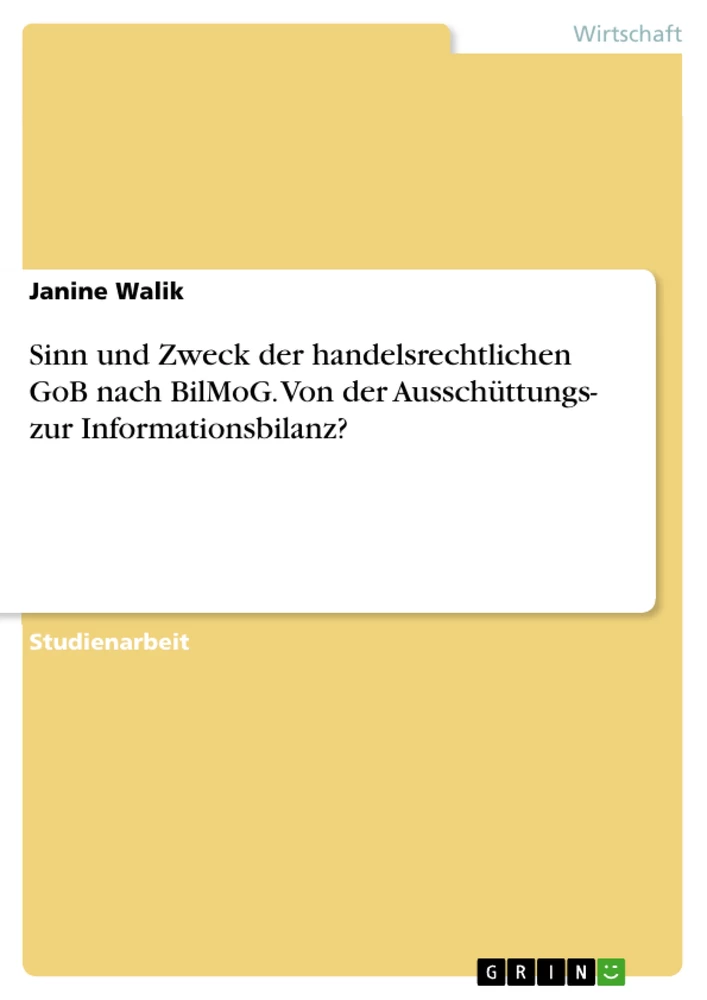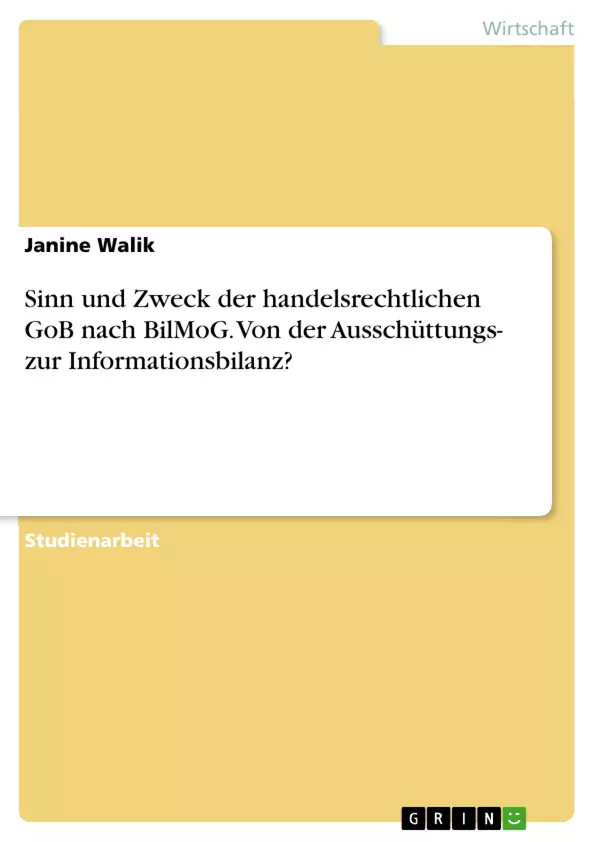Die Arbeit beschäftigt sich insbesondere mit der Fragestellung, in welchem Maße die Ausschüttungsfunktion der deutschen Rechnungslegung mit der Einführung des BilMoG weiterhin die primäre Zielsetzung darstellt und ob demgegenüber die Informationsfunktion noch immer hintangestellt oder gegebenenfalls zu einem neuen Primat der Rechnungslegung erhoben wird.
Das Bilanzmodernisierungsgesetz (BilMoG) hat mit seiner Einführung im Jahr 2009 einige gravierende Änderungen in der deutschen Rechnungslegung bewirkt. Auch wenn anfänglich über eine Ersetzung des dem Privatrecht zugehörigen Handelsgesetzbuches (HGB) als Sonderrecht der Kaufleute bzw. Gewerbetreibenden durch die International Financial Reporting Standards (IFRS) diskutiert wurde, entschieden sich die Schöpfer des BilMoG für eine lediglich "maßvolle Annäherung" an die IFRS.
Mit dieser Entscheidung sollte hauptsächlich der Kernpunkt des handelsrechtlichen Jahresabschlusses keine Änderung erfahren, sprich die Gewinnausschüttungsfunktion mit dem Grundsatz der Maßgeblichkeit bzw. Umkehrmaßgeblichkeit. Die Informationsfunktion sollte mit dem BilMoG zwar weiterhin eine sekundäre Funktion nach der Ausschüttungsbemessungsfunktion einnehmen, unklar bleibt hier jedoch worauf mit dem Gedanken einer "in den Vordergrund" tretenden Informationsfunktion abgezielt wird.
Inhaltsverzeichnis
- Problemstellung
- Allgemeines zum BilMoG
- Ziele der handelsrechtlichen Rechnungslegung
- Die Ausschüttungsbemessungsfunktion
- Die Informationsfunktion
- Ziele der Rechnungslegung nach IFRS
- Ziele der handelsrechtlichen Rechnungslegung
- Änderungen durch das BilMoG
- Aktivierung spezieller selbstgeschaffener immaterieller Vermögensgegenstände §248 Abs. 2 HGB
- Vom Aktivierungsverbot zum Aktivierungswahlrecht
- Auswirkungen auf die Informations- und Ausschüttungsbilanz
- Rückstellungsabzinsung
- Die Diskontierungspflicht nach §253 Abs. 2 HGB
- Auswirkungen der Diskontierungspflicht
- Herstellungskosten
- Gesetzliche Regelungen nach §255 Abs. 2 HGB
- Auswirkungen
- Aktivierung spezieller selbstgeschaffener immaterieller Vermögensgegenstände §248 Abs. 2 HGB
- Thesenförmige Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Auswirkungen des Bilanzmodernisierungsgesetzes (BilMoG) auf die handelsrechtliche Rechnungslegung in Deutschland. Sie analysiert, ob die Ausschüttungsbemessungsfunktion, die traditionell im Vordergrund stand, weiterhin die primäre Zielsetzung der Rechnungslegung darstellt oder ob die Informationsfunktion an Bedeutung gewonnen hat.
- Primäre Zielsetzung der deutschen Rechnungslegung: Ausschüttungsbemessungsfunktion vs. Informationsfunktion
- Einfluss des BilMoG auf die Gewinnausschüttungsfunktion
- Analyse von drei konkreten Normenänderungen durch das BilMoG
- Auswirkungen der Normenänderungen auf die Ausschüttungs- und Informationsfunktion
- Zusammenfassende Bewertung der Veränderungen im Hinblick auf die Priorisierung von Ausschüttungs- und Informationsfunktion
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Problemstellung und den Hintergrund der Untersuchung. Es stellt die wichtigsten Zielsetzungen der handelsrechtlichen Rechnungslegung dar, insbesondere die Ausschüttungsbemessungsfunktion und die Informationsfunktion. Anschließend werden die Ziele der Rechnungslegung nach IFRS kurz erläutert.
Im zweiten Kapitel werden die allgemeinen Ziele des BilMoG und die Unterschiede zwischen der deutschen und der internationalen Rechnungslegung dargestellt. Es werden die Auswirkungen der Einführung des BilMoG auf die Rechnungslegung in Deutschland aufgezeigt und ein Vergleich zwischen der Ausschüttungsbemessungsfunktion und der Informationsfunktion im Kontext des BilMoG vorgenommen.
Das dritte Kapitel untersucht die Änderungen, die das BilMoG in drei spezifischen Normenbereichen der handelsrechtlichen Rechnungslegung bewirkt hat. Dazu gehören die Aktivierung von immateriellen Vermögensgegenständen, die Rückstellungsabzinsung und die Herstellungskosten. Für jede dieser Normen werden die neuen Regelungen des BilMoG vorgestellt und die Auswirkungen auf die Ausschüttungs- und Informationsfunktion analysiert.
Schlüsselwörter
Bilanzmodernisierungsgesetz (BilMoG), Handelsgesetzbuch (HGB), International Financial Reporting Standards (IFRS), Ausschüttungsbemessungsfunktion, Informationsfunktion, Aktivierung von immateriellen Vermögensgegenständen, Rückstellungsabzinsung, Herstellungskosten, Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB).
- Quote paper
- Janine Walik (Author), 2020, Sinn und Zweck der handelsrechtlichen GoB nach BilMoG. Von der Ausschüttungs- zur Informationsbilanz?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1263944