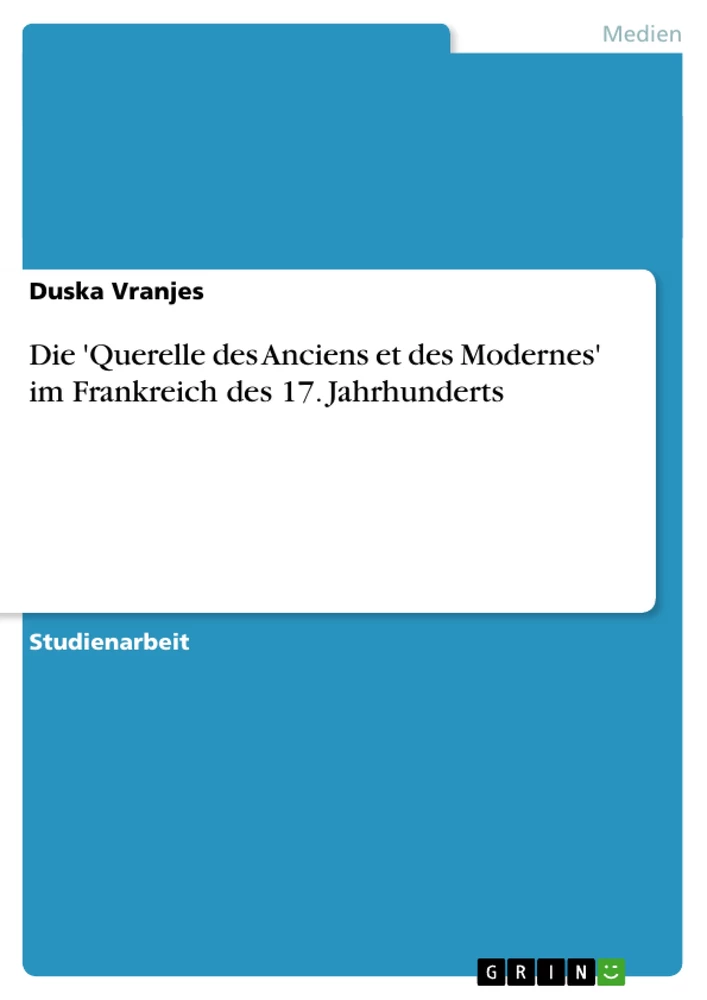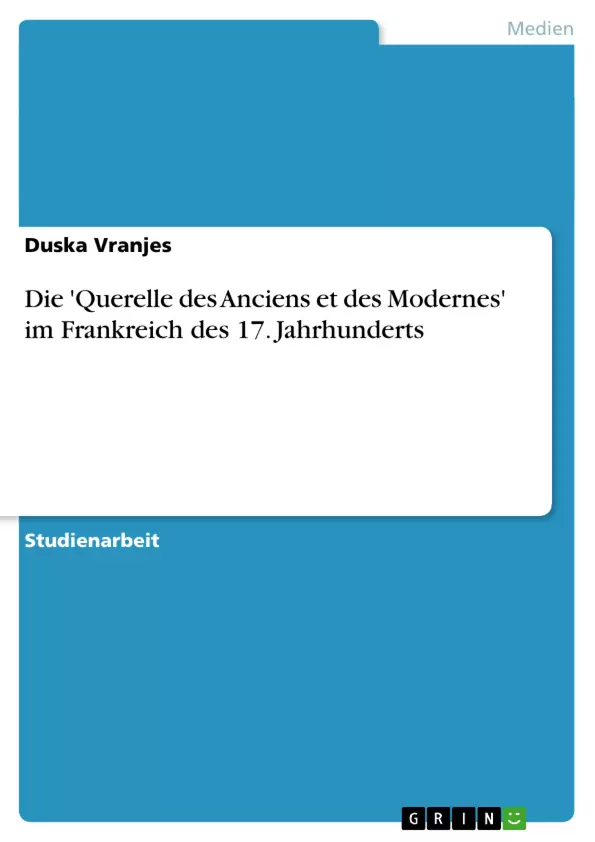Die folgende Ausarbeitung setzt sich mit dem Streit zwischen den Modernes
und den Altertumsanhänger, der „Querelle des Anciens et des Modernes“,
welche im 17. Jahrhundert in Frankreich stattgefunden hat, auseinander. Nach
einer kurzen geschichtlichen Einordnung soll der Verlauf der Querelle umrissen
werden und die Einstellungen der Gegnerparteien dargelegt werden. Vor
diesem Hintergrund soll das Kunstverständnis der Modernisten und der
Anciens erklärt werden. Dabei soll die Entwicklung in der Malerei, der Skulptur
und der Architektur beschrieben werden. König Ludwig XIV. übernimmt im März 1661, nach dem Tod seines Ersten
Ministers, Kardinal Jules Mazarin, der seit 1643 für den unmündigen König die
Geschäfte geleitet hat, als absolutistischer Herrscher die Regierungsgeschäfte.
Unter ihm erreicht der Absolutismus die höchste Machtentfaltung nach innen
und außen. Der Hof des „Sonnenkönigs“ in Versailles wird das Vorbild der
höfisch-aristokratischen Gesellschaft Europas. Die Kunst des Barock (z.B.
Schloss Versailles), die klassische Literatur (u.a. Molière, La Fontaine,
Corneille, Racine), Philosophie und Malerei erleben ihre Hochblüte. Doch leitet
die übersteigerte Expansionspolitik (Eroberungskriege u.a. gegen Spanien und
die Niederlande) und die Verschwendungssucht von Ludwig XIV. zugleich die
Schwächung des Königtums ein.
Ludwig XIV. beschränkt das Parlament und den Adel in ihren politischen
Kompetenzen, verstärkt gleichzeitig die königliche Verwaltung und Armee.
Auch die Künste entziehen sich nicht der Aufmerksamkeit des Königs. Von der
Krone gefordert, geraten sie nach und nach unter das Diktat des Königs und
dienen der Verherrlichung der Persönlichkeit Ludwigs XIV.
Unter Ludwig XIV. soll Paris zu einem neuen Rom werden. In der vom König.
gegründeten Akademie in Rom werden die wichtigsten Statuen von
französischen Künstlern nachgebaut, gezeichnet, gemessen und
Marmorkopien erstellt. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1.2. Merkmale des franquistischen Herrschaftssystems
- Die sozial-ökonomische Situation in den ersten Jahren des Regimes ( 1939-1959)
- 2.1. Das Wirtschaftsproblem und seine gesellschaftlichen Folgen
- 2.2. Das Land- und Industrieproletariat
- 2.3. Widerstand- und Guerillabewegung
- Die gesellschaftlichen Veränderungen im Zusammenhang mit dem Wirtschaftsaufschwung ( 1960-1973/74)
- 3.1. Die Phase des Wirtschaftswunders 1960-73/74
- 3.2. Arbeitsmarkt und Wanderungsbewegungen
- 3.3 Die Mittelschicht
- 3.3.1 Der öffentliche Dienstleistungssektor
- 3.3.2. Das politisch-gesellschaftliche Verhalten
- 3.3.3. Der Status der Frauen
- 3.4. Die Arbeiterklasse
- 3.4.1. Das politisch-gesellschaftliche Verhalten
- Konflikt und Widerstand
- 4.1. Streikbewegungen und Entstehung von Arbeiterkommissionen
- 4.2. Das Aufbegehren an den Universitäten
- 4.3. Das Aufbegehren der unterdrückten Regionen: 3Baskenland und Katalonien
- 4.4. Die Distanzierung der Kirche
- Schlußbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der spanischen Gesellschaft unter der Diktatur Francos von 1939 bis 1975. Sie analysiert die sozial-ökonomischen Entwicklungen und gesellschaftlichen Veränderungen in dieser Zeit, wobei der Fokus auf den Widerstand gegen das Regime und den Konflikt zwischen den unterschiedlichen sozialen Gruppen liegt.
- Die wirtschaftliche Situation Spaniens unter der Diktatur Francos
- Die sozialen Klassen und ihre Entwicklungen
- Die Rolle des Widerstands und der Guerillabewegung
- Die gesellschaftlichen Veränderungen im Zusammenhang mit dem Wirtschaftsaufschwung
- Die Konflikte und Widerstände innerhalb der spanischen Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung liefert einen Überblick über die Merkmale des franquistischen Herrschaftssystems. Im zweiten Kapitel werden die sozial-ökonomischen Bedingungen in den ersten Jahren des Regimes analysiert, einschließlich des Wirtschaftsproblems, der Lage des Land- und Industrieproletariats sowie der Widerstand- und Guerillabewegung. Kapitel 3 befasst sich mit den gesellschaftlichen Veränderungen im Zusammenhang mit dem Wirtschaftsaufschwung der 1960er und 1970er Jahre, einschließlich der Entwicklung des Arbeitsmarktes, der Wanderungsbewegungen und der Herausbildung einer Mittelschicht. Kapitel 4 beleuchtet Konflikte und Widerstände innerhalb der spanischen Gesellschaft, wie Streikbewegungen, das Aufbegehren an den Universitäten und die Distanzierung der Kirche.
Schlüsselwörter
Franquismus, Spanien, Diktatur, Wirtschaftsgeschichte, Soziale Klassen, Widerstand, Guerillabewegung, Wirtschaftsaufschwung, Arbeiterklasse, Mittelschicht, Konflikte, Kirche, Katalonien, Baskenland.
- Quote paper
- Duska Vranjes (Author), 2002, Die 'Querelle des Anciens et des Modernes' im Frankreich des 17. Jahrhunderts, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/12607