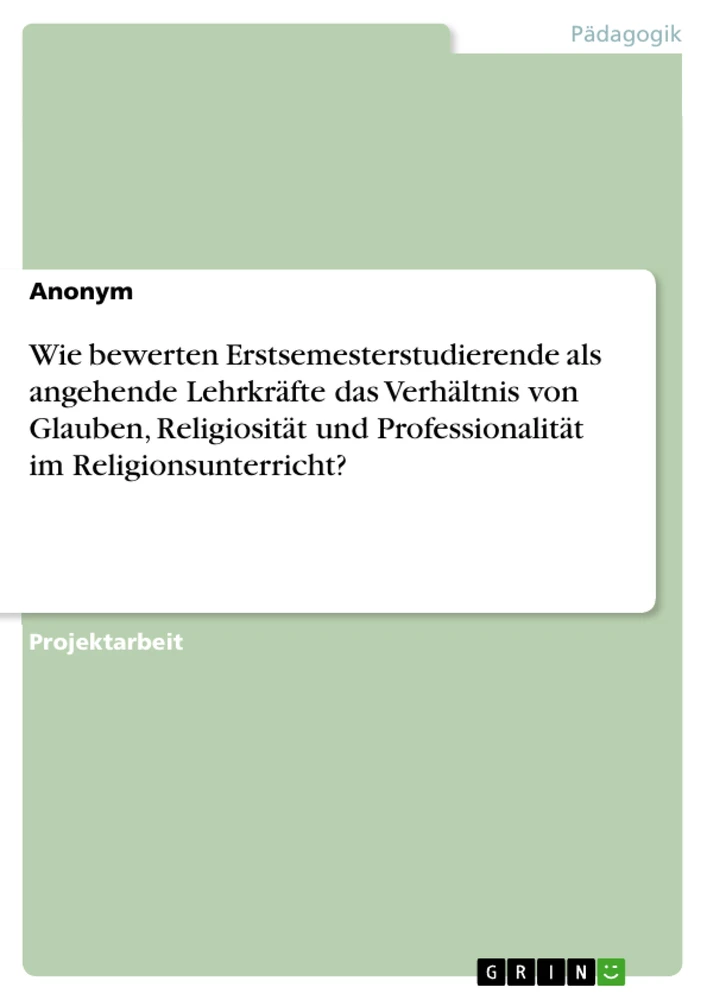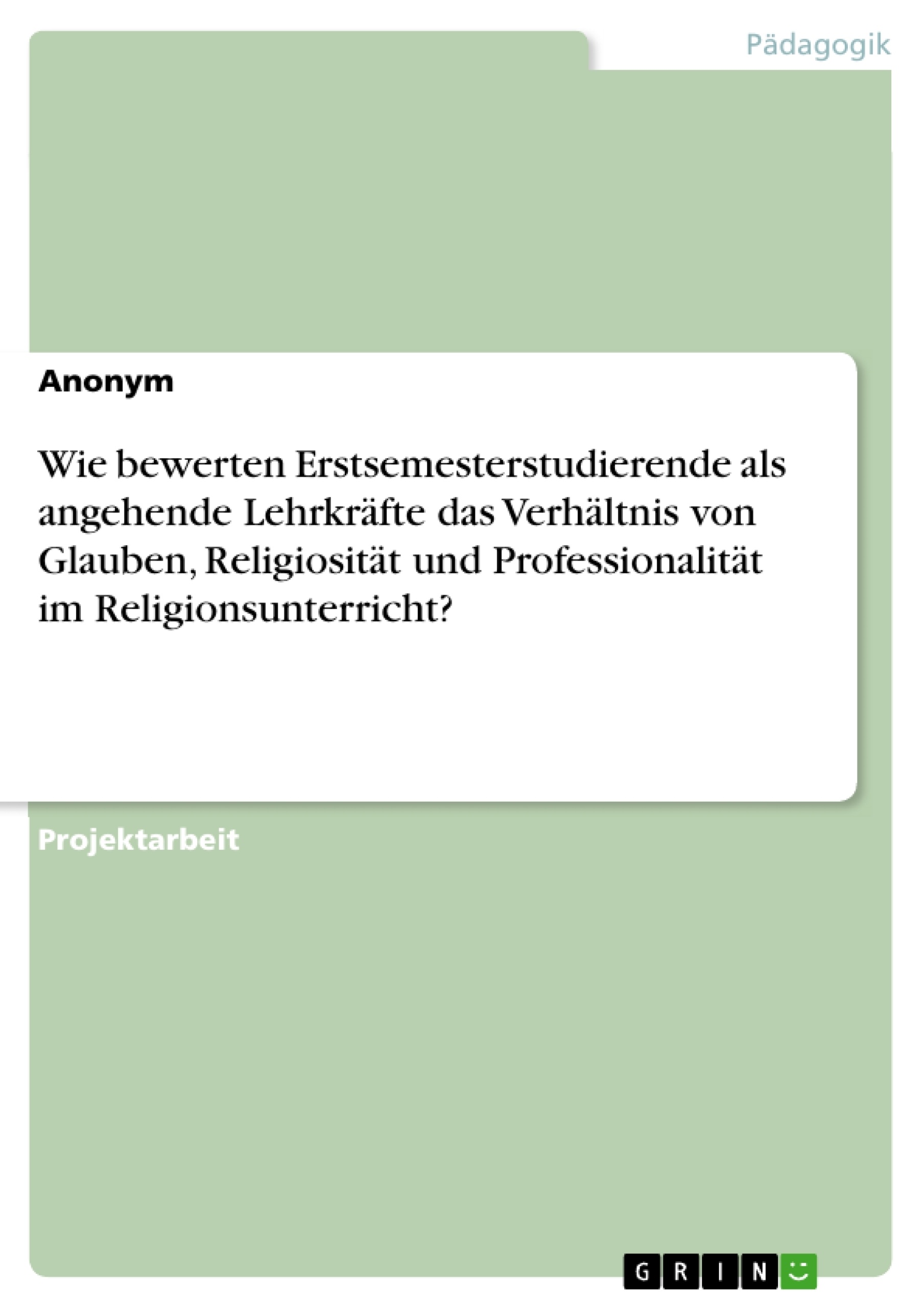Mit Antritt des Lehramtes an staatlichen Schulen müssen angehende Religionslehrkräfte die sogenannte "Vokation" der jeweiligen Landeskirche erteilt bekommen, wodurch sie in ihr Amt berufen werden. Wie im Grundgesetz verankert ist, sei es folglich Aufgabe der Religionslehrer:innen, den Unterricht in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaft zu erteilen. Angehende Religionslehrkräfte befinden sich somit von Beginn ihrer Ausbildung an in einem Zwist der Identitätsfrage: Fungieren sie in der Rolle der Religionslehrkraft nunmehr als Glaubens-Repräsentantin ihrer jeweiligen Religionsgemeinschaft? Wollen sie überhaupt Teil einer Religionsgemeinschaft sein? Oder haben sie mitunter andere Beweggründe für das Religionslehramt internalisiert, die kein individuelles Glaubensbekenntnis implizieren, wie z.B. das Interesse für religionswissenschaftliche, historische Aspekte?
Mit Blick auf die angehende Praxis als Religionslehrkraft erscheint es daher von besonderem Interesse, die Motivation der Studierenden für das Religionsstudium und ihre Vorstellungen einer idealen Religionslehrkraft – zwischen subjektiver Glaubensüberzeugung und wissenschaftlicher Neutralität – zu ergründen. Die subjektive Einstellung von angehenden Religionslehrkräften (Studierenden) zum Thema "Glaube und Religiosität der Lehrkraft im evangelischen Religionsunterricht" bildet in der Religionspädagogischen Forschung derzeit ein Desiderat. Untersucht wurden bis dato die Professionalität im Verständnis von Religionslehrerinnen und -lehrern (1997-2014), die Religiosität und Lehrerprofessionalität sowie die Professionalisierung des Religionslehrerberufs als Aufgabe und Gegenstand religionspädagogischer Forschung. Nicht fokussiert wurde bisher die Perspektive von jenen Studierenden, die ihre Schullaufbahn erst kürzlich beendeten und das Lehramt für Religion anstreben. Ins Zentrum rücken sodann ihre Erfahrungen aus dem Religionsunterricht und ihre Wahrnehmungen der ehemaligen Religionslehrkräfte, welche mitunter einen Nachahmungseffekt oder eine abgrenzende Haltung erzeugen.
Die Forschung soll daher einen Beitrag dazu leisten, die Perspektive angehender Religionslehrkräfte zu untersuchen. Hinsichtlich des primären Forschungsinteresses werden Erstsemesterstudierende, die das Fach Theologie studieren, in einem Interview dazu befragt, wie sie als angehende Lehrkräfte das Verhältnis von Glauben, Religiosität und Professionalität im Religionsunterricht einschätzen und bewerten.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Problemdarstellung
- 2 Theoretischer Hintergrund
- 2.1 Religion, Religiosität und Glaube
- 2.2 Religionspädagogischer Kontext: Diskussions- bzw. Forschungsstand
- 3 Methode
- 3.1 Studiendesign und Leitfaden
- 3.2 Stichprobe
- 3.3 Datenerhebung
- 3.4 Datenanalyse
- 3.4.1 Die objektive Hermeneutik
- 4 Auswertung
- 4.1 Probandin A
- 4.2 Probandin B
- 4.3 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Forschungsarbeit untersucht die Perspektive von Erstsemesterstudierenden der Theologie, die das Lehramt für Religion anstreben, hinsichtlich des Verhältnisses von Glaube, Religiosität und Professionalität im Religionsunterricht. Ziel ist es, ein tieferes Verständnis für die Einstellungen und Erwartungen dieser angehenden Lehrkräfte zu entwickeln, um den Diskurs über Professionalität und Religiosität im Religionsunterricht zu bereichern.
- Die Bedeutung von Glaube und Religiosität für die Identität und Rolle von angehenden Religionslehrkräften.
- Die Wahrnehmung von Professionalität im Religionsunterricht aus der Perspektive der Studierenden.
- Die Erfahrungen der Studierenden mit dem Religionsunterricht in ihrer Schullaufbahn und deren Einfluss auf ihre Erwartungen an den eigenen zukünftigen Unterricht.
- Die Spannungen zwischen subjektiver Glaubensüberzeugung und wissenschaftlicher Neutralität im Kontext des Religionsunterrichts.
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Problemdarstellung: Dieses Kapitel stellt die Forschungsfrage und den Forschungsgegenstand vor, indem es die Diskrepanz zwischen der erhofften „Vokation“ der Landeskirche und der tatsächlichen Motivation von angehenden Religionslehrkräften aufzeigt. Es werden Forschungsdesiderate in Bezug auf die Perspektive von Erstsemesterstudierenden der Theologie beleuchtet.
- Kapitel 2: Theoretischer Hintergrund: Dieses Kapitel legt den theoretischen Grundstein der Forschungsarbeit, indem es die Begriffe Religion, Religiosität und Glaube voneinander abgrenzt und definiert. Zudem wird der religionspädagogische Kontext und der aktuelle Forschungsstand im Bereich der Professionalität von Religionslehrkräften beleuchtet.
- Kapitel 3: Methode: Dieses Kapitel beschreibt das Studiendesign und die Methodik der Forschung. Es werden das Interviewleitfaden, die Stichprobe, die Datenerhebung und die Datenanalyse erläutert, wobei der Fokus auf der objektiven Hermeneutik als Analyseverfahren liegt.
- Kapitel 4: Auswertung: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Interviews mit den Probandinnen A und B. Es werden deren Aussagen im Hinblick auf das Verhältnis von Glaube, Religiosität und Professionalität im Religionsunterricht analysiert.
Schlüsselwörter
Die Forschung beschäftigt sich mit den zentralen Themen Glauben, Religiosität und Professionalität im Religionsunterricht aus der Perspektive von Erstsemesterstudierenden der Theologie. Dabei werden wichtige Begriffe wie „Vokation“, „Identität“, „subjektive Glaubensüberzeugung“, „wissenschaftliche Neutralität“ und „Religionspädagogik“ im Kontext des Forschungsprojektes beleuchtet. Die Analyse der Interviewdaten fokussiert auf die Erfahrungen und Einstellungen der Studierenden im Hinblick auf den Religionsunterricht und die Rolle der Religionslehrkraft.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2021, Wie bewerten Erstsemesterstudierende als angehende Lehrkräfte das Verhältnis von Glauben, Religiosität und Professionalität im Religionsunterricht?, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1253063