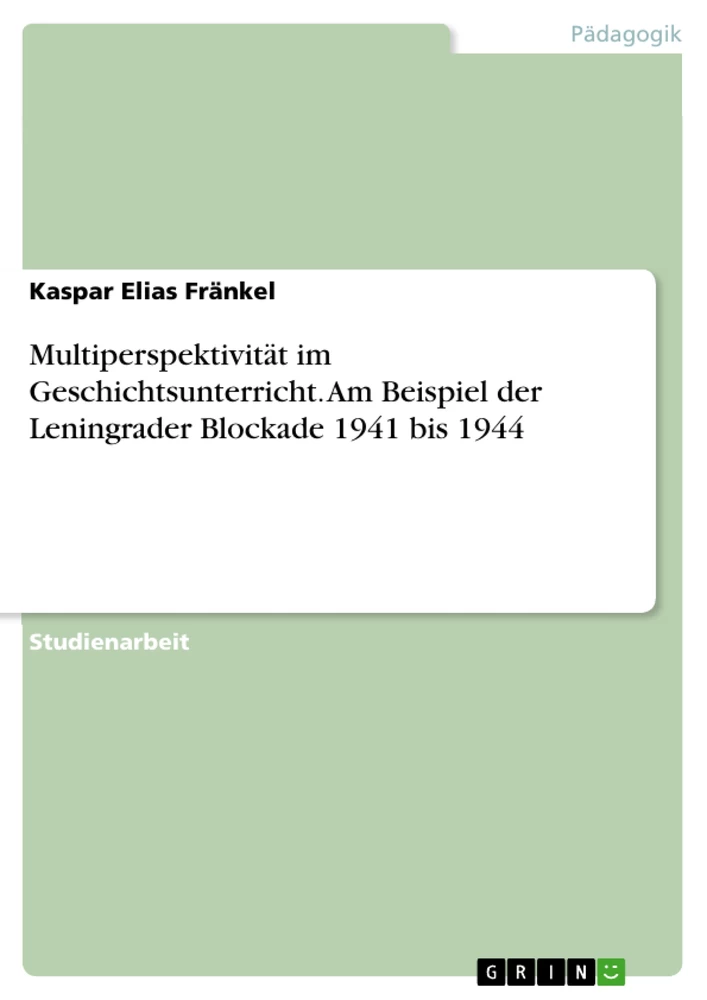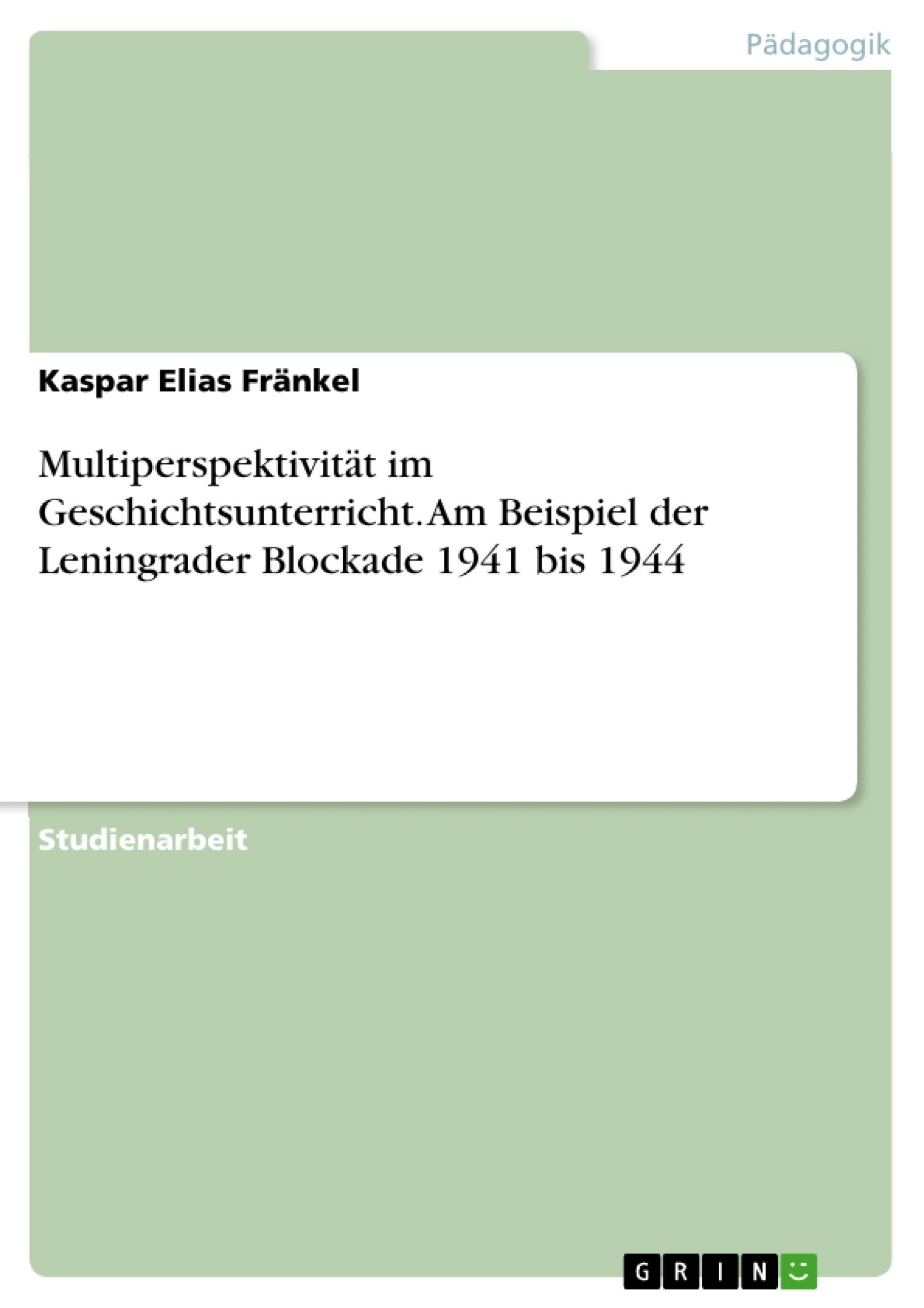In dieser Arbeit soll zunächst der Forschungsstand und die Theorie der Multiperspektivität beschriebenen werden, um dann den historischen Kontext zu skizzieren, anschließend die konkreten Quellen und ihre Autor*innen zu beschreiben, um schließlich anhand des Kompetenzmodells von Michael Sauer zu erläutern, welchen didaktischen Wert für den Geschichtsunterricht das Material konkret mit sich bringt.
Der Begriff Perspektivität bezeichnet in der Geschichtswissenschaft einen Grundsachverhalt menschlicher Wahrnehmung und Deutung: Je nach Geschlecht, Alter, Religion, Sozialisation usw. nehmen wir Ereignisse unterschiedlich wahr und berichten dementsprechend auch anders von ihnen. In der Geschichtswissenschaft, wie auch im Unterricht ist man bemüht, historische Ereignisse aus verschiedenen Perspektiven darzustellen, um so ein umfassenderes Bild des Geschehens zu liefern.
Die Leningrader Blockade hat erst seit den 90er-Jahren nach und nach Einzug in die deutsche Erinnerungskultur gefunden. Erst mit der zweiten „Wehrmachtaustellung“ begann man das Ereignis als Kriegsverbrechen zu klassifizieren. Hatte man die Blockade in der Schule zuvor in keiner Weise betrachtet, fand das Thema nun auch erstmals differenziert Eingang in den Geschichtsunterricht. Nichtsdestotrotz ist die Tragödie der Stadt Leningrad noch immer deutlich weniger in der deutschen Geschichtskultur verankert als Orte wie Stalingrad, Hiroshima und Dresden.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Forschungstand und theoretische Grundlage der Multiperspektivität
- III. Historischer Inhalt
- III.1 Der Überfall Nazi-Deutschlands auf die Sowjetunion
- III.2 Die Leningrader Blockade 1941-1944
- IV. Vorstellung der ausgewählten Quellen zur Leningrader Blockade
- IV.1 Feldpostbrief von Georg Fulde an seine Schwester und Schwager, 29.09.1941
- IV.2 Tagebuch von Lena Muchina
- V. Dimensionen des Lernens am Beispiel des Kompetenzmodells nach Michael Sauer
- V.1 Sachkompetenz
- V.2 Deutungs- und Reflexionskompetenz
- V.3 Medien-Methoden-Kompetenz
- VI. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Bedeutung von Multiperspektivität im Geschichtsunterricht am Beispiel der Leningrader Blockade. Sie untersucht, wie unterschiedliche Perspektiven auf ein historisches Ereignis helfen, ein umfassenderes Bild des Geschehens zu vermitteln und Schülerinnen und Schülern ein fundiertes historisches Urteil zu ermöglichen.
- Entwicklung des Prinzips der Multiperspektivität in der Geschichtswissenschaft
- Der Überfall Nazi-Deutschlands auf die Sowjetunion und die Leningrader Blockade als historischer Kontext
- Analyse von zwei unterschiedlichen Perspektiven auf die Leningrader Blockade: ein Feldpostbrief und ein Tagebuch
- Der didaktische Wert des Materials für den Geschichtsunterricht anhand des Kompetenzmodells von Michael Sauer
- Die Herausforderungen bei der Integration von Multiperspektivität im Unterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Multiperspektivität im Geschichtsunterricht ein und stellt die Leningrader Blockade als Fallbeispiel vor. Kapitel II beleuchtet den Forschungstand und die theoretischen Grundlagen der Multiperspektivität, insbesondere die Arbeiten von Klaus Bergmann. Kapitel III skizziert den historischen Kontext, indem es den Überfall Nazi-Deutschlands auf die Sowjetunion und die Leningrader Blockade beleuchtet. Kapitel IV stellt die ausgewählten Quellen – den Feldpostbrief von Georg Fulde und das Tagebuch von Lena Muchina – vor und erläutert die jeweiligen Perspektiven. Kapitel V analysiert den didaktischen Wert der Quellen anhand des Kompetenzmodells von Michael Sauer und zeigt, welche Kompetenzen Schülerinnen und Schüler durch die Beschäftigung mit diesen Quellen entwickeln können. Der Schluss wird nicht zusammengefasst.
Schlüsselwörter
Multiperspektivität, Geschichtsunterricht, Leningrader Blockade, Zweiter Weltkrieg, Feldpostbrief, Tagebuch, Kompetenzmodell, Michael Sauer, historisches Urteil, Perspektivenvielfalt, Kontroversität, Pluralität.
- Quote paper
- Kaspar Elias Fränkel (Author), 2021, Multiperspektivität im Geschichtsunterricht. Am Beispiel der Leningrader Blockade 1941 bis 1944, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1249636