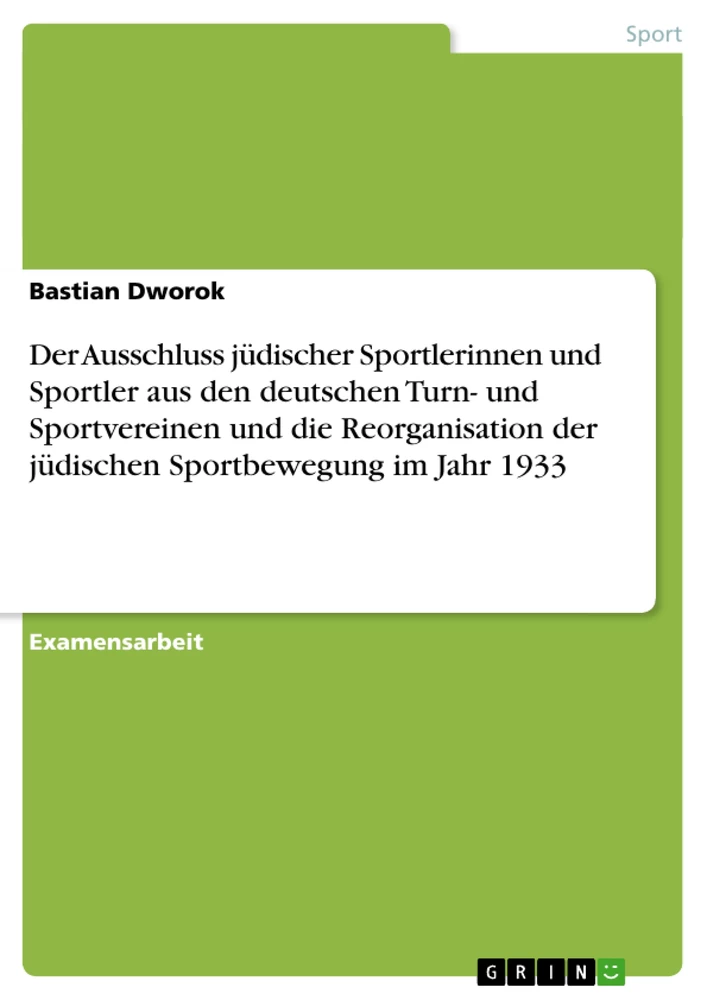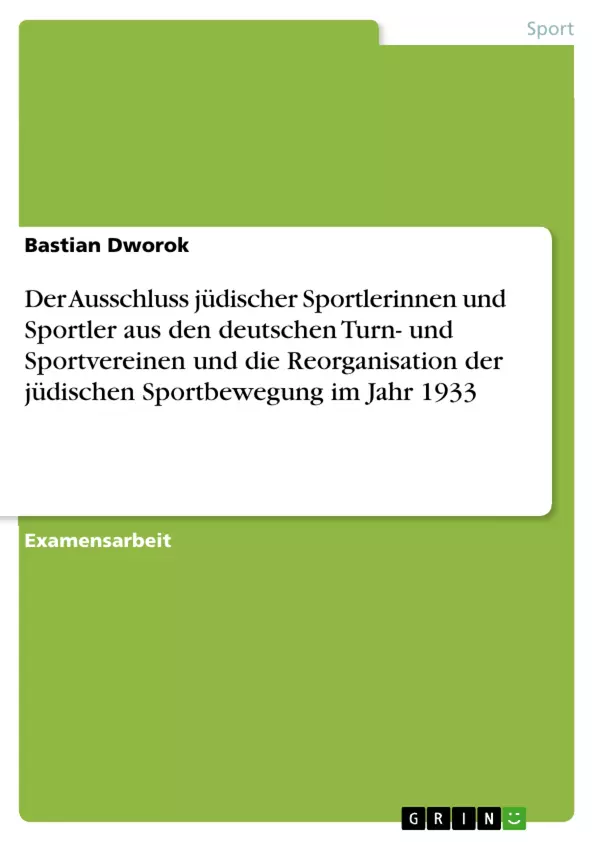1933 gilt als das Jahr der nationalsozialistischen Revolution und Errichtung der Hitlerdiktatur in Deutschland. Am 30.01.1933 wurde Hitler in einer Regierung aus Nationalsozialisten (NS) und Deutschnationalen (DNVP) zum deutschen Reichskanzler ernannt. Ende Februar 1933 festigte er seine Machtstellung durch die Notverordnung ′Zum Schutz von Volk und Staat′, am 23.03.1933 wurde das ′Ermächtigungsgesetz′ mit 441 Stimmen gegen 91 Stimmen der SPD im Deutschen Reichstag angenommen. Fünf Tage später erließ Hitler einen Aufruf an alle Parteiorganisationen der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP) zum Boykott gegen die Juden (BENZ 1988a, 15-33). Die politische Gleichschaltung erfasste in den folgenden Wochen alle gesellschaftlichen Bereiche, der Totalitätsanspruch wurde von den Nationalsozialisten rücksichtslos durchgesetzt.1
Diese politische Entwicklung bewirkte auch einschneidende Veränderungen in der bürgerlichen Sportbewegung. Obwohl sich das Turn- und Sportverbandswesen bis 1933 für politisch neutral erklärt hatte, machte die antidemokratische, militante und antisemitische NS–Politik nicht vor den deutschen Turn- und Sportvereinen halt. Ganz im Gegenteil: es entwickelte sich eine außerordentliche Eigendynamik in bezug auf die sportliche und organisatorische Umsetzung der nationalsozialistischen Ideologie. Man kann sogar von einem Wettlauf um die Einführung des Führerprinzips, der Wehrertüchtigung und den Ausschluss politischer Gegner (Kommunisten und Sozialdemokraten) innerhalb der deutschen Sportbewegung sprechen (PEIFFER 2000, 2). Im Zuge der ′Arisierung′2 mussten Tausende von jüdischen Sportlern aus ihren deutschen Vereinen und Verbänden ausscheiden. Sie standen vor der Wahl, ins Ausland zu flüchten oder sich in eigenen Sportvereinen zu organisieren.
Die von den Nationalsozialisten verfolgten Ziele – Zerstörung der Demokratie, Zerschlagung der organisierten Arbeiterbewegung, Militarisierung der deutschen Gesellschaft und ′Lösung der Judenfrage′ – mündeten schließlich in eine Neuordnung Europas auf der Grundlage der nationalsozialistischen Ideologie und Herrschaft (KWIET 1997, 50). Im NS-Programm nahm der Antisemitismus eine zentrale Stellung ein und wurde zur Staatsdoktrin erhoben. [...]
Inhaltsverzeichnis
- ABKÜRZUNGEN
- EINLEITUNG
- ZUR ABGRENZUNG DES THEMAS
- ZUM STAND DER FORSCHUNG
- ZUR BEHANDLUNG DES THEMAS
- ZUR ARBEITSWEISE
- ZUR BEGRIFFSWAHL
- DIE JUDEN IN DEUTSCHLAND VOR DER MACHTÜBERNAHME DURCH DIE NATIONALSOZIALISTEN
- DIE LAGE DER JUDEN IN DEUTSCHLAND VOR 1933
- SPORT IN DEUTSCHEN TURN- UND SPORTVERBÄNDEN
- JÜDISCHE ORGANISATIONEN
- Der Deutsche Makkabikreis
- Der Schild
- VINTUS
- DER AUSSCHLUSS JÜDISCHER SPORTLER IM JAHR DER MACHTERGREIFUNG
- DER ANTISEMITISMUS IN DEUTSCHLAND
- DIE NATIONALSOZIALISTISCHE MACHTERGREIFUNG
- DAS NATIONALSOZIALISTISCHE SPORTVERSTÄNDNIS
- DIE AUFLÖSUNG UND GLEICHSCHALTUNG DES DEUTSCHEN SPORTVERBANDWESENS
- Kommunistische und sozialistische Sportverbände
- Konfessionelle Sportverbände
- Der Deutsche Reichsausschuss für Leibesübungen (DRA)
- DIE UMSETZUNG DES ´ARIERPARAGRAPHEN` IN DEN DEUTSCHEN TURN- UND SPORTVEREINEN
- Der Ausschluss jüdischer Sportler aus den deutschen Turn- und Sportverbänden
- Der Ausschluss jüdischer Sportler aus den deutschen Turn- und Sportvereinen
- Ausgewählte Schicksale ausgeschlossener jüdischer Sportler
- FOLGEN DER NS-POLITIK IM JAHR 1933
- ERSTE REAKTIONEN JÜDISCHER SPORTORGANISATIONEN
- Der Sportbund Schild des Reichsbundes jüdischer Frontsoldaten
- Der Deutsche Makkabi-Kreis
- DIE KONKURRENZ ZWISCHEN DEN JÜDISCHEN SPORTVERBÄNDEN
- DER VERSUCH EINER GEMEINSAMEN NEUORDNUNG
- Selbstbestimmung und Optimismus
- Der Übungsstättennotstand
- Die Richtlinien der Reichssportführung zum jüdischen Sport
- Der Reichsausschuss jüdischer Sportverbände
- DIE OLYMPISCHEN SPIELE ALS REICHSANGELEGENHEIT
- DIE HALTUNG DER WELTÖFFENTLICHKEIT
- FAZIT UND AUSBLICK
- LITERATURVERZEICHNIS
- ANHANG
- ERKLÄRUNG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Ausschluss jüdischer Sportlerinnen und Sportler aus den deutschen Turn- und Sportvereinen im Jahr 1933 sowie der Selbstorganisation in der jüdischen Sportbewegung. Sie analysiert die Entwicklungen, die zur Marginalisierung und Ausgrenzung jüdischer Sportler führten und beleuchtet die Reaktionen der jüdischen Sportorganisationen.
- Die politische und gesellschaftliche Situation der Juden in Deutschland vor 1933
- Die Machtergreifung der Nationalsozialisten und deren Einfluss auf den Sport
- Die Umsetzung des 'Arierparagraphen' in den deutschen Turn- und Sportvereinen
- Die Selbstorganisation der jüdischen Sportbewegung
- Die Folgen des Ausschlusses für die jüdische Sportlandschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Ausschlusses jüdischer Sportlerinnen und Sportler aus den deutschen Turn- und Sportvereinen im Jahr 1933 ein. Das zweite Kapitel beleuchtet die Situation der Juden in Deutschland vor 1933 und analysiert die Rolle des Sports in den deutschen Turn- und Sportverbänden sowie die jüdische Sportorganisation. Das dritte Kapitel behandelt den Ausschluss jüdischer Sportler im Jahr der Machtergreifung, indem es die nationalsozialistische Ideologie, die Auflösung der Sportverbände und die Umsetzung des 'Arierparagraphen' analysiert. Das vierte Kapitel befasst sich mit den Folgen der NS-Politik für die jüdische Sportbewegung, insbesondere mit den Reaktionen der jüdischen Sportorganisationen und dem Versuch einer gemeinsamen Neuordnung.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Themenfelder dieser Arbeit sind: Ausschluss jüdischer Sportler, Selbstorganisation, jüdische Sportbewegung, Nationalsozialismus, 'Arierparagraph', Sportpolitik, Machtergreifung, Antisemitismus, Sportverbände, Sportorganisationen.
- Quote paper
- Bastian Dworok (Author), 2001, Der Ausschluss jüdischer Sportlerinnen und Sportler aus den deutschen Turn- und Sportvereinen und die Reorganisation der jüdischen Sportbewegung im Jahr 1933, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/12472