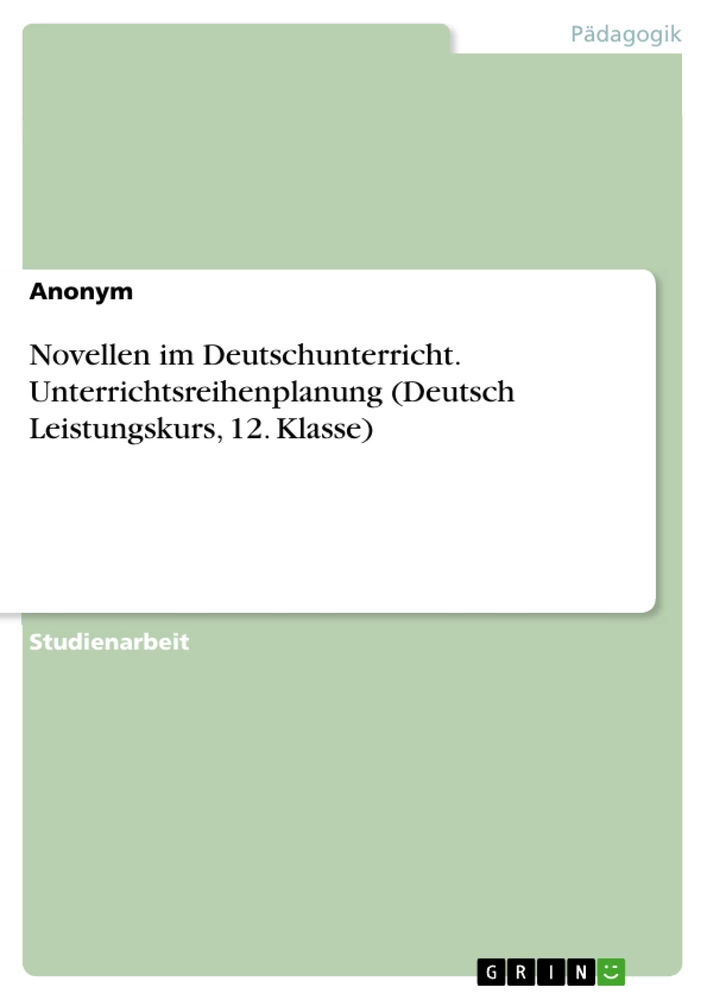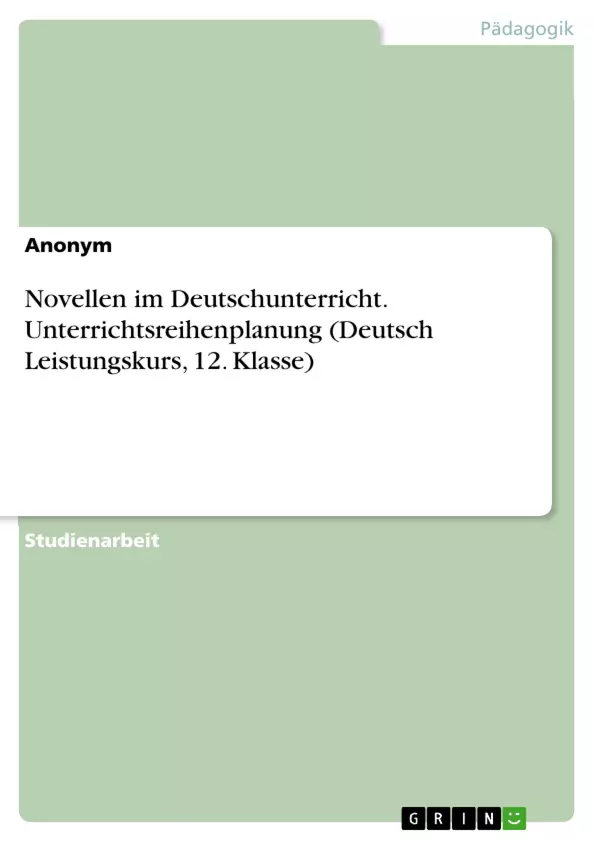Die Novelle ist eine Gattung, die aus didaktischer Sicht von besonderem Interesse ist. In dieser Arbeit wird diese These erläutert und belegt, um anschließend eine Reihenplanung aufzustellen und diese didaktisch wie auch methodisch zu begründen.
Dazu dient als Einstieg eine Sachanalyse der Gattung und Geschichte der Novelle anhand des "Decameron" und der "Falkennovelle" sowie eine kurze Sachanalyse der Novelle "Der Tod in Venedig" von Thomas Mann. Darauf folgt die didaktische Analyse der genannten Inhalte und eine Begründung der methodischen und unterrichtsdidaktischen Umsetzung in der Unterrichtsreihenplanung für einen Deutsch Leistungskurs der 12. Klasse.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Sachanalyse
- Gattung und Geschichte der Novelle
- Der Tod in Venedig von Thomas Mann
- Didaktische Analyse
- Literaturverzeichnis
- Anhang: tabellarische Reihenplanung
- Anhang: möglicher optischer Impuls
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit verfolgt das Ziel, die Novelle als didaktisch interessante Gattung zu beleuchten und anhand einer Reihenplanung für einen Deutsch Leistungskurs der 12. Klasse aufzuzeigen, wie sie im Unterricht behandelt werden kann. Hierfür werden zunächst die Gattungsgeschichte und -theorie der Novelle anhand des Decameron und der Falkennovelle sowie der Novelle „Der Tod in Venedig“ von Thomas Mann analysiert.
- Gattungsgeschichte und -theorie der Novelle
- Didaktisches Potential der Novelle
- Analyse und Interpretation des Decameron und der Falkennovelle
- Analyse und Interpretation von "Der Tod in Venedig" von Thomas Mann
- Entwicklung einer Unterrichtsreihenplanung für die 12. Klasse
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und stellt die Relevanz der Novelle als Gattung im Deutschunterricht dar. Sie beschreibt den Aufbau der Arbeit und erläutert die Methode, die zur Analyse und didaktischen Umsetzung der Novelle eingesetzt wird.
Sachanalyse
Gattung und Geschichte der Novelle
Dieses Kapitel beleuchtet die Gattung der Novelle anhand ihrer Geschichte und Definition. Es werden verschiedene Aspekte der Novelle wie ihr Wendepunkt, ihre Struktur, ihre Charaktere und ihr Inhalt betrachtet. Zudem wird die Bedeutung des Erzählrahmens und der Novellistik Boccaccios im Kontext der deutschen Novellentradition hervorgehoben.
Der Tod in Venedig von Thomas Mann
Das Kapitel widmet sich der Novelle „Der Tod in Venedig“ von Thomas Mann und untersucht die Thematik des inneren Kampfes zwischen Selbstdisziplin und Leidenschaft. Insbesondere werden die Todesboten als Leitmotive der Novelle analysiert und ihre Funktion im Kontext der Handlung erläutert. Die Analyse zeigt, wie die Todesboten den Protagonisten Gustav Aschenbach in Richtung seines tragischen Endes führen.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter und Themen der Arbeit sind: Novelle, Gattungsgeschichte, Gattungsdefinition, Wendepunkt, Struktur, Charaktere, Inhalt, Erzählrahmen, Decameron, Falkennovelle, „Der Tod in Venedig“, Thomas Mann, Selbstdisziplin, Leidenschaft, Todesboten, Leitmotive, Unterrichtsreihenplanung, didaktische Analyse, methodische Umsetzung.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist die Novelle für den Deutschunterricht besonders geeignet?
Die Novelle bietet durch ihren klaren Aufbau, den zentralen Wendepunkt und die überschaubare Länge ideale Möglichkeiten für literarische Analysen und Interpretationen im Unterricht.
Was sind die Merkmale einer "Falkennovelle"?
Der Begriff geht auf Boccaccio zurück und bezeichnet ein zentrales Dingsymbol (wie den Falken), das die Handlung zusammenfasst und eine tiefere symbolische Bedeutung hat.
Worum geht es in Thomas Manns "Der Tod in Venedig"?
Die Novelle thematisiert den inneren Kampf des Schriftstellers Gustav Aschenbach zwischen strenger Selbstdisziplin und einer verzehrenden Leidenschaft, die letztlich zu seinem Untergang führt.
Welche Rolle spielen die "Todesboten" in Thomas Manns Werk?
Die Todesboten fungieren als Leitmotive, die den Protagonisten schrittweise auf seinen Tod vorbereiten und die düstere Atmosphäre der Erzählung unterstreichen.
Wie sieht eine Unterrichtsplanung für Novellen in der 12. Klasse aus?
Die Planung umfasst meist eine Sachanalyse der Gattung, die Untersuchung historischer Beispiele (Decameron) und die vertiefte Analyse eines modernen Werks, ergänzt durch didaktische und methodische Begründungen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2020, Novellen im Deutschunterricht. Unterrichtsreihenplanung (Deutsch Leistungskurs, 12. Klasse), Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1247098