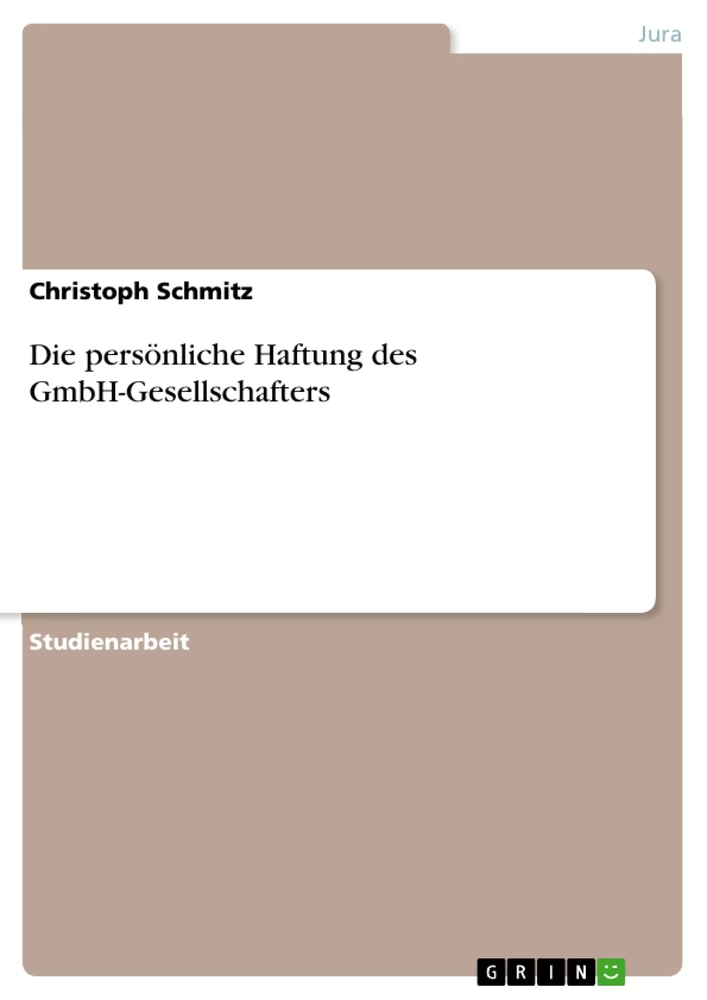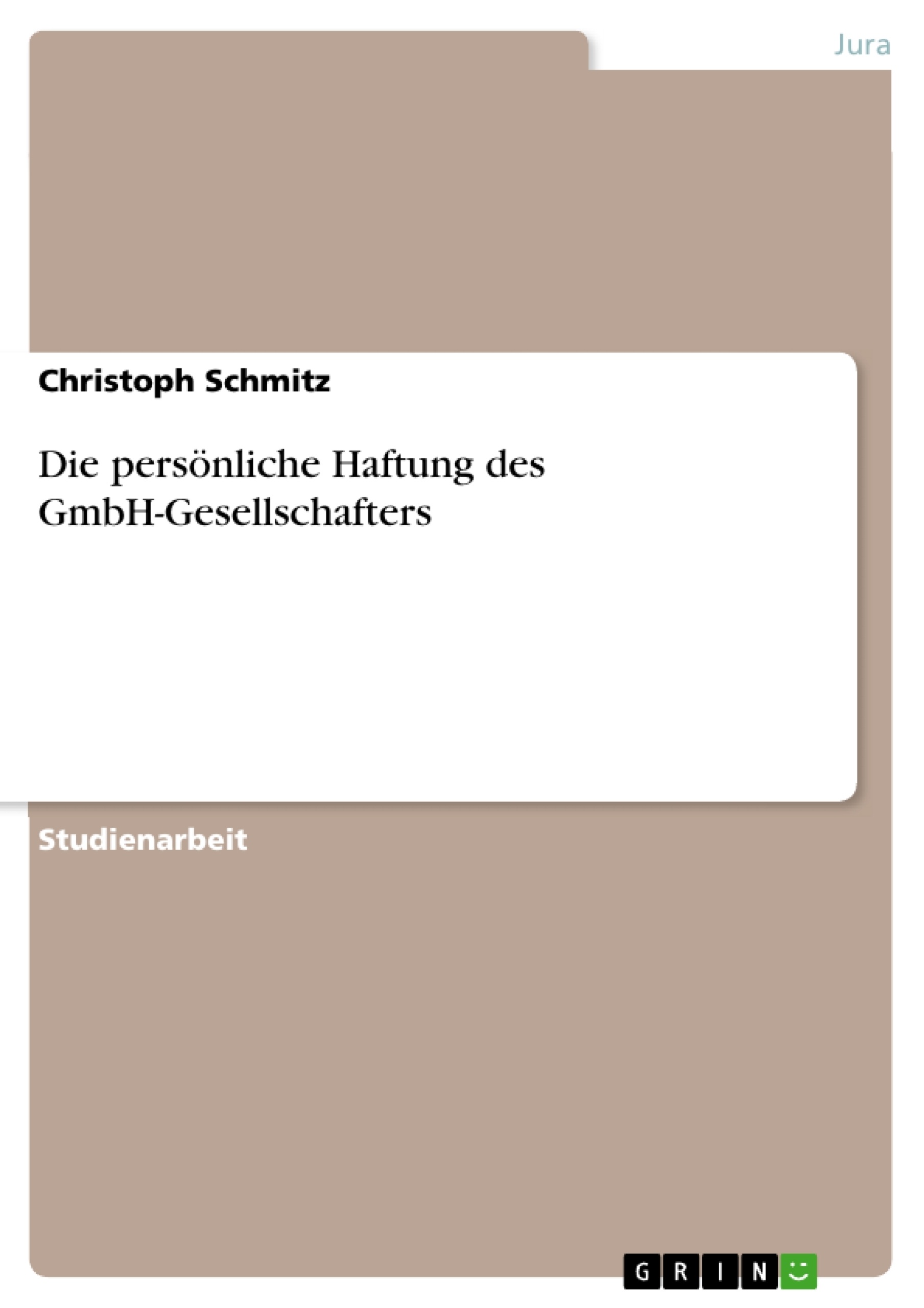Die vorliegende Hausarbeit setzt sich mit der Haftung der GmbH auseinander, insbesondere mit der persönlichen Haftung der Gesellschafter, den Inhabern der Gesellschaft, bei Verstößen gegen die Rechtsvorschriften. Zunächst wird in Kapitel 2 Allgemeines sowie die wirtschaftliche Bedeutung der GmbH erläutert und die Eigenschaften der Gesellschaft als juristische Person beschrieben. Da die Gesellschaft als juristische Person fungiert, benötigt sie ausführende Organe. Diese Organe, die der Gesellschafter und der Geschäftsführer, und deren Rechte und Pflichten werden anschließend beschrieben. Kapitel 3 gibt einen Einblick über die grundsätzliche Haftung der GmbH für ihre Verbindlichkeiten gegenüber Dritten, bevor nachfolgend die Durchgriffshaftung erläutert wird, in der die Gesellschafter der GmbH auch mit ihren Privatvermögen haften können und das Haftungsprivileg der GmbH durchbrochen wird.
Das Ziel dieser Hausarbeit ist es, die versteckten Gefahren der Haftung der GmbH-Gesellschafter zu präsentieren und aufzuklären, dass in Ausnahmefällen das vermeintlich geschützte Privatvermögen der Gesellschafter mit in die Haftung herangezogen werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Die GmbH im Überblick
- 2.1 Allgemeines
- 2.2 Organe der GmbH
- 3 Die persönliche Haftung des GmbH-Gesellschafters
- 3.1 Trennungsprinzip / Durchgriffshaftung
- 3.2 Rechtsform- und Institutsmissbrauch
- 3.3 Haftung im Gründungsstadium
- 3.4 Unterbilanzhaftung, Vorbelastungshaftung, Differenzhaftung
- 3.5 Verlustdeckungshaftung
- 3.6 Differenzhaftung bei Einlage
- 3.7 Vermögensvermischung
- 3.8 Existenzvernichtungshaftung
- 4 Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der Haftung der GmbH, insbesondere mit der persönlichen Haftung der Gesellschafter. Das Ziel der Arbeit ist es, die versteckten Gefahren der Haftung für GmbH-Gesellschafter aufzuzeigen und zu verdeutlichen, dass in Ausnahmefällen auch das vermeintlich geschützte Privatvermögen der Gesellschafter in die Haftung gezogen werden kann.
- Die GmbH als Rechtsform und ihre wirtschaftliche Bedeutung
- Die Organe der GmbH und ihre Aufgaben
- Das Trennungsprinzip und die Durchgriffshaftung
- Verschiedene Haftungsformen des GmbH-Gesellschafters
- Der Schutz des Privatvermögens des Gesellschafters
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 gibt einen Überblick über die GmbH als Rechtsform. Es erläutert die wirtschaftliche Bedeutung der GmbH und beschreibt die Eigenschaften der Gesellschaft als juristische Person. Des Weiteren werden die Organe der GmbH, Gesellschafter und Geschäftsführer, vorgestellt und deren Rechte und Pflichten erläutert.
Kapitel 3 beschäftigt sich mit der Haftung der GmbH für ihre Verbindlichkeiten gegenüber Dritten. Im Mittelpunkt steht die Durchgriffshaftung, bei der die Gesellschafter der GmbH mit ihrem Privatvermögen haften können und das Haftungsprivileg der GmbH durchbrochen wird.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die Themen GmbH, Gesellschaftsrecht, Haftung, Durchgriffshaftung, Rechtsformmissbrauch, Institutsmissbrauch, Gründungsstadium, Unterbilanzhaftung, Vorbelastungshaftung, Differenzhaftung, Verlustdeckungshaftung, Vermögensvermischung, Existenzvernichtungshaftung.
Häufig gestellte Fragen
Wann haften GmbH-Gesellschafter persönlich mit ihrem Privatvermögen?
Dies geschieht in Ausnahmefällen durch die sogenannte Durchgriffshaftung, etwa bei Vermögensvermischung, Existenzvernichtung oder Rechtsformmissbrauch.
Was versteht man unter dem Trennungsprinzip bei einer GmbH?
Das Trennungsprinzip besagt, dass die GmbH als juristische Person ein eigenständiges Vermögen besitzt, das strikt vom Privatvermögen der Gesellschafter getrennt ist.
Was ist die Unterbilanzhaftung im Gründungsstadium?
Gesellschafter haften persönlich für Verluste, die zwischen der Errichtung der GmbH und ihrer Eintragung im Handelsregister entstehen, wenn das Stammkapital dadurch gemindert wird.
Was bedeutet Existenzvernichtungshaftung?
Diese Haftungsform greift, wenn Gesellschafter der GmbH gezielt Vermögen entziehen und dadurch die Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft herbeiführen.
Welche Pflichten haben Geschäftsführer im Hinblick auf die Haftung?
Geschäftsführer müssen die Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmannes walten lassen; bei Verstößen gegen gesetzliche Vorschriften können auch sie haftbar gemacht werden.
- Quote paper
- Christoph Schmitz (Author), 2021, Die persönliche Haftung des GmbH-Gesellschafters, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1247052