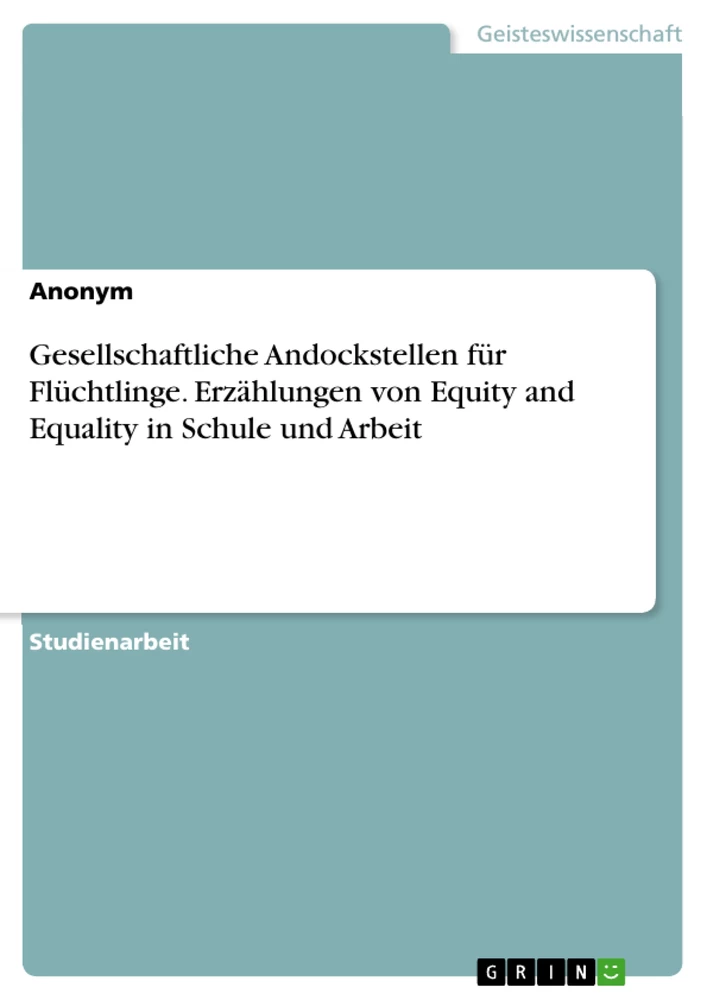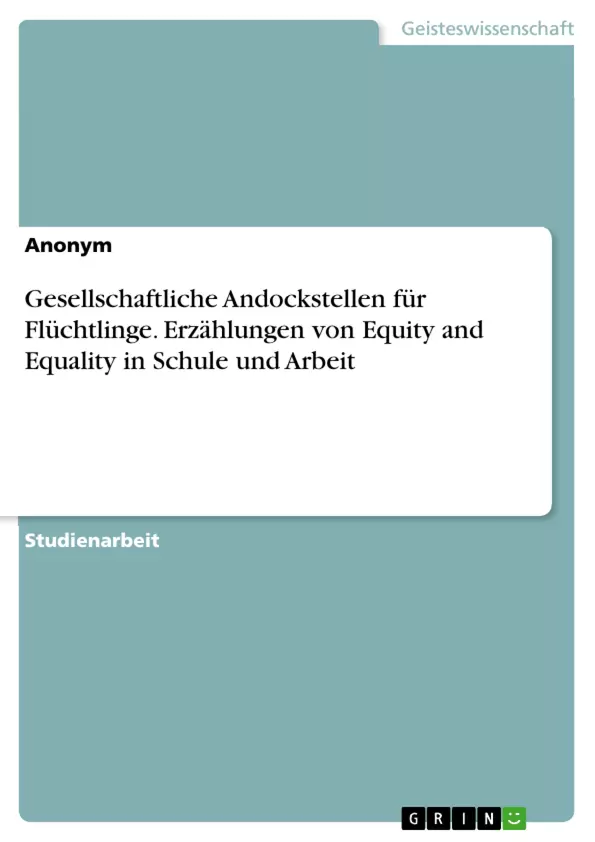Inklusion findet in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen statt, welche die unterschiedlichsten Herausforderungen aufwerfen. Wie sich die Inklusionsprozesse von Geflüchteten in diesen Orten – beispielsweise in der Schule, der Arbeit, der Arztpraxis, im Theater und auf dem Amt – genau gestalteten und unterscheiden, ist der Untersuchungsgegenstand eines Forschungsprojektes der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), durchgeführt an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Im Rahmen derselben Unternehmung findet eine Lehrveranstaltung statt, in der Studierende mit eigenen Forschungsarbeiten zum Vorhaben beitragen sollen.
Diese Arbeit entsteht im Auftrag des Seminars „Gesellschaftliche Andockstellen für Flüchtlinge“. Sie soll auf zwei Andockstellen scharfstellen, welchen immer wieder ein hohes Maß an Bedeutung zugeschrieben werden, nämlich auf die Schule und die Arbeit. Der Besuch von Bildungs- und Arbeitsstätten scheint ein integraler Bestandteil des Erfolgsrezepts einer „gelungenen Integration“ zu sein. Im Mittelpunkt der Analyse sollen verschiedene Gleichheits- und Ungleichheitserzählungen von Expert*innen der beiden Andockstellen stehen. Angeleitet wird die Untersuchung durch die zwei sozialwissenschaftlichen Gleichberechtigungskonzepte "Equality" und Equity. Sie sollen dabei helfen, mögliche Grenzziehungen zwischen Migrant*innen und Deutschen in der Inklusionspraxis von Schulen und Unternehmen zu identifizieren. Zuerst wird dafür das zugrundeliegende systemtheoretische Inklusionsverständnis erläutert. Im Anschluss folgt die Vorstellung der Denkfiguren Equality und Equity, sowie die Präsentation des methodischen Vorgehens, welches die hermeneutische Analyse von sechs leitfadengestützten Expert*inneninterviews vorsieht. Abschließend werden die Gleichheits- und Ungleicheitsnarrative bzgl. geflüchteter Schüler*innen und Arbeitnehmer*innen verglichen und zusammengefasst.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretischer Rahmen
- 2.1 Der Systemtheoretische Inklusionsbegriff
- 2.2 Equality vs. Equity in Schule und Arbeit
- 3. Methodisches Vorgehen
- 4. Erzählungen von Equality und Equity im Vergleich
- 4.1 in der Schule
- 4.2 in der Arbeit
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Inklusion von Geflüchteten in Schule und Arbeitswelt anhand der Konzepte "Equality" und "Equity". Sie analysiert Expert*inneninterviews, um Gleichheits- und Ungleichheitserzählungen zu identifizieren und zu vergleichen. Der systemtheoretische Inklusionsbegriff nach Luhmann bildet den theoretischen Rahmen.
- Systemtheoretischer Inklusionsbegriff nach Luhmann
- Vergleich der Konzepte Equality und Equity
- Analyse von Inklusionserfahrungen in Schule und Arbeit
- Identifizierung von Gleichheits- und Ungleichheitserzählungen
- Kontextualisierung der Erzählungen im Rahmen des gewählten theoretischen Rahmens
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der gesellschaftlichen Integration von Geflüchteten ein und beschreibt den Fokus der Arbeit auf Schule und Arbeit als zentrale Andockstellen. Sie hebt die Bedeutung von Bildungs- und Arbeitsstätten für gelungene Integration hervor und benennt die sozialwissenschaftlichen Konzepte "Equality" und "Equity" als analytische Werkzeuge. Die Arbeit basiert auf einem Forschungsprojekt der DFG an der LMU München und untersucht Gleichheits- und Ungleichheitserzählungen von Expert*innen aus Schule und Arbeitswelt, um mögliche Grenzziehungen zwischen Migrant*innen und Deutschen zu identifizieren. Die methodische Vorgehensweise, die hermeneutische Analyse von Expert*inneninterviews, wird kurz skizziert.
2. Theoretischer Rahmen: Dieses Kapitel legt den theoretischen Grundstein der Arbeit. Es erläutert zunächst den systemtheoretischen Inklusionsbegriff nach Luhmann, der auf funktionaler Differenzierung und autopoietischen sozialen Systemen basiert. Die verschiedenen Funktionssysteme der Gesellschaft und ihre spezifischen Perspektiven werden beschrieben, wobei die Interdependenzen zwischen den Systemen betont werden. Im Anschluss werden die Konzepte "Equity" und "Equality" vorgestellt, die als analytische Werkzeuge für den Vergleich von Inklusionserfahrungen dienen. Der Unterschied zum Assimilationsbegriff wird aufgezeigt und kritisch diskutiert, wobei die transnationale Theorieschule und deren Kritik an einem nationalstaatlich begrenzten Gesellschaftsverständnis erwähnt werden.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Inklusion von Geflüchteten in Schule und Arbeit
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Inklusion von Geflüchteten in Schule und Arbeitswelt. Sie analysiert Expert*inneninterviews, um Gleichheits- und Ungleichheitserzählungen zu identifizieren und zu vergleichen, wobei die Konzepte "Equality" und "Equity" als analytische Werkzeuge dienen.
Welcher theoretische Rahmen wird verwendet?
Der systemtheoretische Inklusionsbegriff nach Luhmann bildet den theoretischen Rahmen. Die Arbeit erläutert die funktionalen Differenzierungen und autopoietischen sozialen Systeme und beschreibt die Interdependenzen zwischen verschiedenen Funktionssystemen. Der Unterschied zwischen "Equity" und "Equality" wird detailliert dargestellt und kritisch im Vergleich zum Assimilationsbegriff diskutiert, unter Berücksichtigung der transationalen Theorieschule.
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit basiert auf der hermeneutischen Analyse von Expert*inneninterviews. Die Interviews dienen der Identifizierung von Gleichheits- und Ungleichheitserzählungen im Kontext von Schule und Arbeit.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Theoretischer Rahmen, Methodisches Vorgehen, Erzählungen von Equality und Equity im Vergleich (in Schule und Arbeit) und Fazit.
Was sind die zentralen Themenschwerpunkte?
Zentrale Themen sind der systemtheoretische Inklusionsbegriff nach Luhmann, der Vergleich der Konzepte "Equality" und "Equity", die Analyse von Inklusionserfahrungen in Schule und Arbeit, die Identifizierung von Gleichheits- und Ungleichheitserzählungen und die Kontextualisierung dieser Erzählungen im gewählten theoretischen Rahmen.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung führt in das Thema der gesellschaftlichen Integration von Geflüchteten ein, beschreibt den Fokus auf Schule und Arbeit, hebt deren Bedeutung für gelungene Integration hervor und benennt "Equality" und "Equity" als analytische Werkzeuge. Sie erwähnt die Basis der Arbeit in einem Forschungsprojekt der DFG an der LMU München und skizziert die methodische Vorgehensweise.
Was wird im Kapitel zum theoretischen Rahmen erläutert?
Dieses Kapitel erläutert den systemtheoretischen Inklusionsbegriff nach Luhmann, beschreibt verschiedene Funktionssysteme der Gesellschaft und deren Perspektiven, und stellt die Konzepte "Equity" und "Equality" vor. Es zeigt den Unterschied zum Assimilationsbegriff auf und diskutiert kritisch die transnationale Theorieschule.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2022, Gesellschaftliche Andockstellen für Flüchtlinge. Erzählungen von Equity and Equality in Schule und Arbeit, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1244961