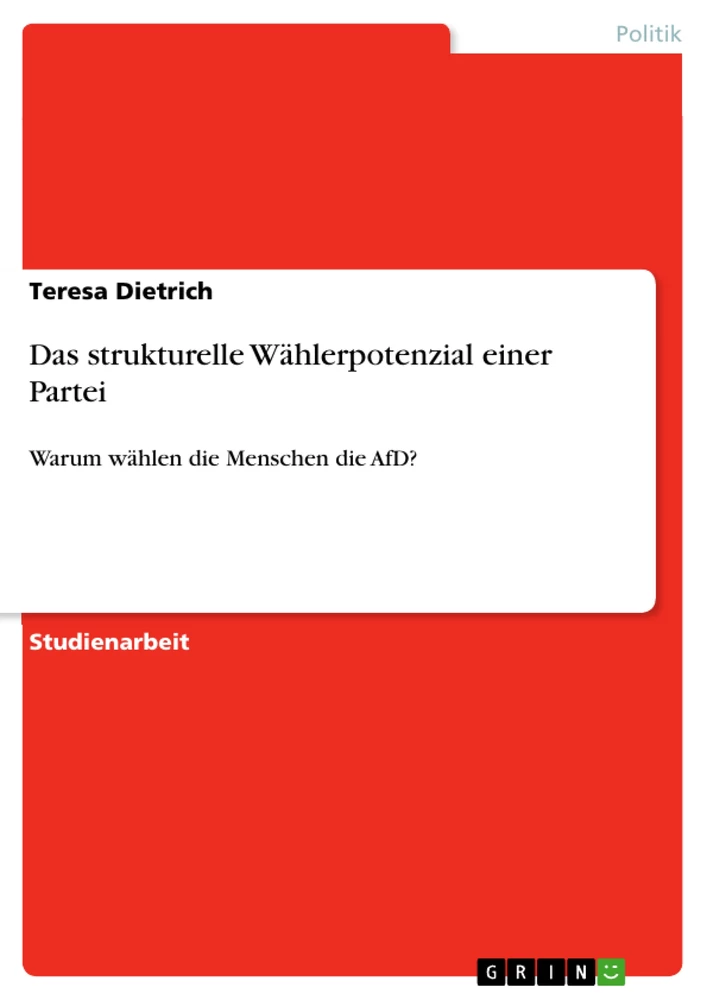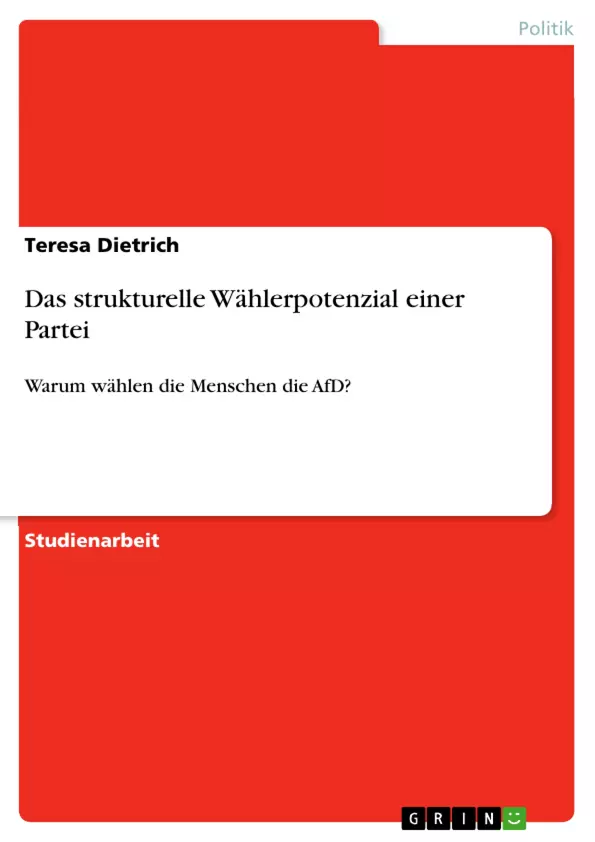Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem strukturellen Wählerpotenzial einer Partei und stellt sich die Frage, warum Menschen die AfD wählen.
Was wie eine aufgeladene Debatte wirkt, sind in Wahrheit zwei, unabhängig voneinander formulierte Aussagen - Bekundungen, welche die Existenz einer dichotomen politischen Plattform offenlegen.
Neu gegründete Parteien fristen oftmals ein Nischendasein. Im parteipolitischen Mächteverhältnis sind junge Parteien oft nicht fähig, lange zu überleben. Einzig „Challenger-Parteien“ scheinen etablierungsfähig zu sein, wenn sie der Nachfrageseite ein Angebot liefern können, das bisher unzureichend war.
Im Folgenden wird argumentiert, dass die im Jahre 2013 gegründete Partei „Alternative für Deutschland“ ein derartiges Angebot liefern kann, und sich damit einhergehend auf ein strukturelles Wählerpotenzial beruft.
Um die Nachfragekonstellation zu erklären, werden die sozialstrukturellen Grundlagen politischen Handelns beschrieben, einhergehend mit der Konzeption Pierre Bourdieus von dem „sozialen Raum“ und „Habitus“. Dies wird zwei bekannten politikwissenschaftlichen Erklärungen populistischen Wahlverhaltens gegenübergestellt.
Der zweite Teil der Arbeit bezieht Sekundäranalysen empirischer Studien ein, mit einem Fokus auf die Wählerverortung im politischen Raum, gefolgt von eigenständigen bi- und multivariaten Analysen. Diese untersuchen die Verbindung zwischen AfD Parteiverbundenheit und dem Gefühl eines Exkludiert-Seins aus dem sozial-politischen Raum, basierend auf Daten der European Social Survey 2018.
Inhaltsverzeichnis
- Kapitel 1: Einführung in die Thematik
- Kapitel 2: Historischer Überblick
- 2.1 Frühe Entwicklungen
- 2.2 Das 20. Jahrhundert
- Kapitel 3: Aktuelle Entwicklungen
- Kapitel 4: Fallstudien
- 4.1 Fallstudie A
- 4.2 Fallstudie B
- Kapitel 5: Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit verfolgt das Ziel, einen umfassenden Überblick über die Entwicklung und den aktuellen Stand der Thematik zu geben. Es werden sowohl historische als auch aktuelle Entwicklungen beleuchtet und anhand von Fallstudien veranschaulicht.
- Historische Entwicklung der Thematik
- Aktuelle Trends und Herausforderungen
- Analyse von Fallstudien
- Diskussion der Ergebnisse
- Ausblick auf zukünftige Entwicklungen
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Einführung in die Thematik: Dieses Kapitel legt den Grundstein für die gesamte Arbeit. Es definiert die zentrale Thematik, beschreibt den Forschungsansatz und skizziert die Struktur der folgenden Kapitel. Es werden wichtige Begriffe eingeführt und der Kontext der Thematik im größeren wissenschaftlichen Diskurs erläutert. Die Einleitung dient als Orientierungshilfe und vermittelt dem Leser ein Verständnis für die Bedeutung der Forschungsfrage. Sie bereitet den Leser auf die detaillierte Auseinandersetzung mit der Thematik in den folgenden Kapiteln vor.
Kapitel 2: Historischer Überblick: Kapitel 2 bietet einen detaillierten Überblick über die historische Entwicklung der Thematik. Es werden die wichtigsten Meilensteine und Einflussfaktoren analysiert, beginnend mit den frühen Entwicklungen bis hin zu den Ereignissen des 20. Jahrhunderts. Der Fokus liegt auf dem Verständnis der historischen Wurzeln und der Entwicklung des aktuellen Zustands. Die Analyse dieser historischen Entwicklung ermöglicht es, den aktuellen Stand besser zu verstehen und zukünftige Entwicklungen einzuschätzen. Die Darstellung berücksichtigt sowohl positive als auch negative Aspekte der historischen Entwicklung.
Kapitel 3: Aktuelle Entwicklungen: In Kapitel 3 werden die gegenwärtigen Trends und Entwicklungen der Thematik umfassend dargestellt und analysiert. Es werden aktuelle Statistiken und Forschungsdaten herangezogen, um den aktuellen Stand der Thematik präzise zu beschreiben. Ein besonderer Fokus liegt auf den Herausforderungen und Problemen, die sich gegenwärtig stellen. Es wird aufgezeigt, welche Faktoren die Entwicklung beeinflussen und welche Perspektiven sich für die Zukunft abzeichnen. Kapitel 3 liefert somit eine aktuelle Momentaufnahme des Themas.
Kapitel 4: Fallstudien: Dieses Kapitel präsentiert detaillierte Fallstudien, die die theoretischen Überlegungen der vorherigen Kapitel veranschaulichen und empirisch untermauern. Die ausgewählten Fallstudien repräsentieren unterschiedliche Aspekte und Facetten der Thematik und erlauben eine differenzierte Betrachtung. Durch die Analyse der Fallstudien werden die theoretischen Konzepte konkretisiert und ihre praktische Relevanz verdeutlicht. Die Fallstudien dienen als Beleg für die in den vorherigen Kapiteln dargestellten Argumentationen.
Kapitel 5: Diskussion: Kapitel 5 fasst die Ergebnisse der vorherigen Kapitel zusammen und diskutiert ihre Implikationen. Es werden die wichtigsten Erkenntnisse und Schlussfolgerungen noch einmal hervorgehoben und kritisch reflektiert. Offene Fragen und zukünftige Forschungsansätze werden diskutiert. Der Fokus liegt auf der Einordnung der Ergebnisse in den bestehenden wissenschaftlichen Diskurs und auf der Bewertung ihrer Relevanz für Praxis und Forschung.
Schlüsselwörter
Historische Entwicklung, aktuelle Trends, Fallstudien, Herausforderungen, zukünftige Perspektiven, [weitere relevante Schlüsselwörter hinzufügen]
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: [Titel des Dokuments einfügen]
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über ein bestimmtes Thema. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und die wichtigsten Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und abschließend eine Liste von Schlüsselbegriffen. Der Fokus liegt auf der Darstellung der historischen Entwicklung, aktueller Trends und Herausforderungen, sowie der Analyse von Fallstudien zur Veranschaulichung der Thematik.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument gliedert sich in fünf Kapitel: Kapitel 1 (Einführung), Kapitel 2 (Historischer Überblick), Kapitel 3 (Aktuelle Entwicklungen), Kapitel 4 (Fallstudien) und Kapitel 5 (Diskussion). Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt des Themas, beginnend mit einer grundlegenden Einführung und endend mit einer zusammenfassenden Diskussion und einem Ausblick.
Welche Zielsetzung verfolgt das Dokument?
Die Zielsetzung des Dokuments besteht darin, einen vollständigen Überblick über die Entwicklung und den aktuellen Stand des behandelten Themas zu geben. Es werden sowohl historische als auch aktuelle Entwicklungen beleuchtet und durch Fallstudien veranschaulicht, um ein umfassendes Verständnis zu vermitteln.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die wichtigsten Themenschwerpunkte sind die historische Entwicklung des Themas, aktuelle Trends und Herausforderungen, die Analyse von ausgewählten Fallstudien, die Diskussion der Ergebnisse und ein Ausblick auf zukünftige Entwicklungen.
Wie werden die einzelnen Kapitel zusammengefasst?
Jedes Kapitel wird im Dokument kurz zusammengefasst. Die Zusammenfassungen beschreiben den Inhalt und die Ziele jedes Kapitels, beispielsweise die Einführung des Themas in Kapitel 1, die detaillierte Analyse der historischen Entwicklung in Kapitel 2, die Darstellung aktueller Trends in Kapitel 3, die Analyse von Fallstudien in Kapitel 4 und die abschließende Diskussion und Schlussfolgerungen in Kapitel 5.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für dieses Dokument?
Relevante Schlüsselwörter sind unter anderem: Historische Entwicklung, aktuelle Trends, Fallstudien, Herausforderungen, zukünftige Perspektiven, [weitere relevante Schlüsselwörter hinzufügen]. Diese Begriffe ermöglichen eine gezielte Suche nach Informationen zum Thema.
Welche Art von Fallstudien werden präsentiert?
Das Dokument beinhaltet detaillierte Fallstudien, die die theoretischen Überlegungen der vorherigen Kapitel veranschaulichen und empirisch untermauern. Diese Fallstudien repräsentieren verschiedene Aspekte der Thematik und ermöglichen eine differenzierte Betrachtung. Sie dienen als Beleg für die dargestellten Argumentationen.
Für wen ist dieses Dokument bestimmt?
Dieses Dokument richtet sich an ein akademisches Publikum, das sich für eine detaillierte und strukturierte Auseinandersetzung mit dem Thema interessiert. Es eignet sich für wissenschaftliches Arbeiten, Recherchen und als Informationsquelle für Experten auf dem Gebiet.
- Arbeit zitieren
- Teresa Dietrich (Autor:in), 2021, Das strukturelle Wählerpotenzial einer Partei, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1243276