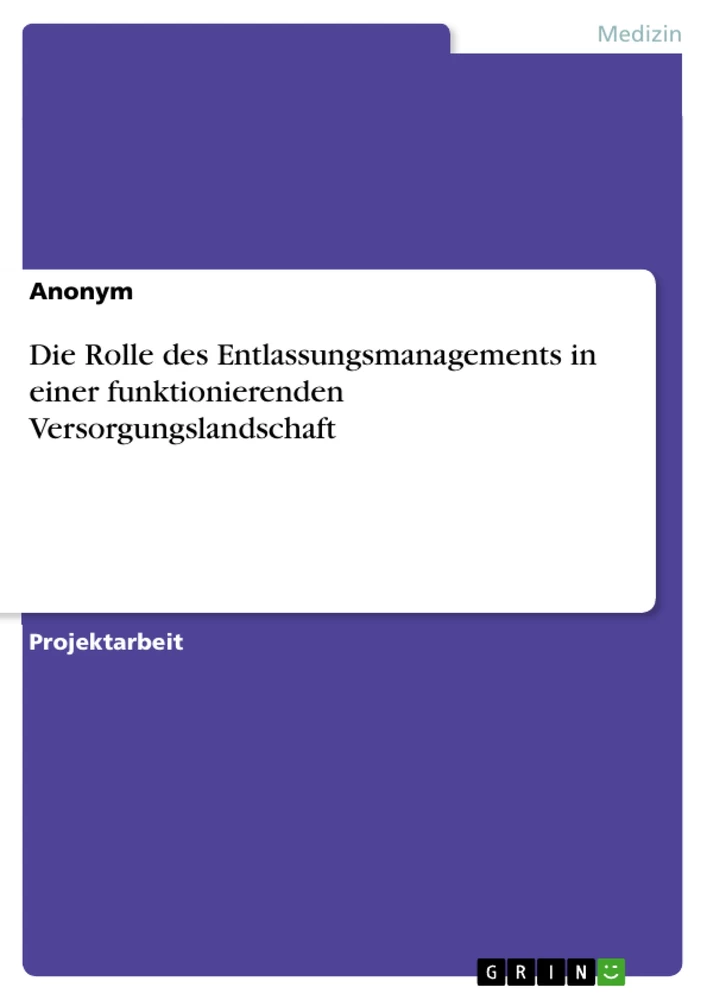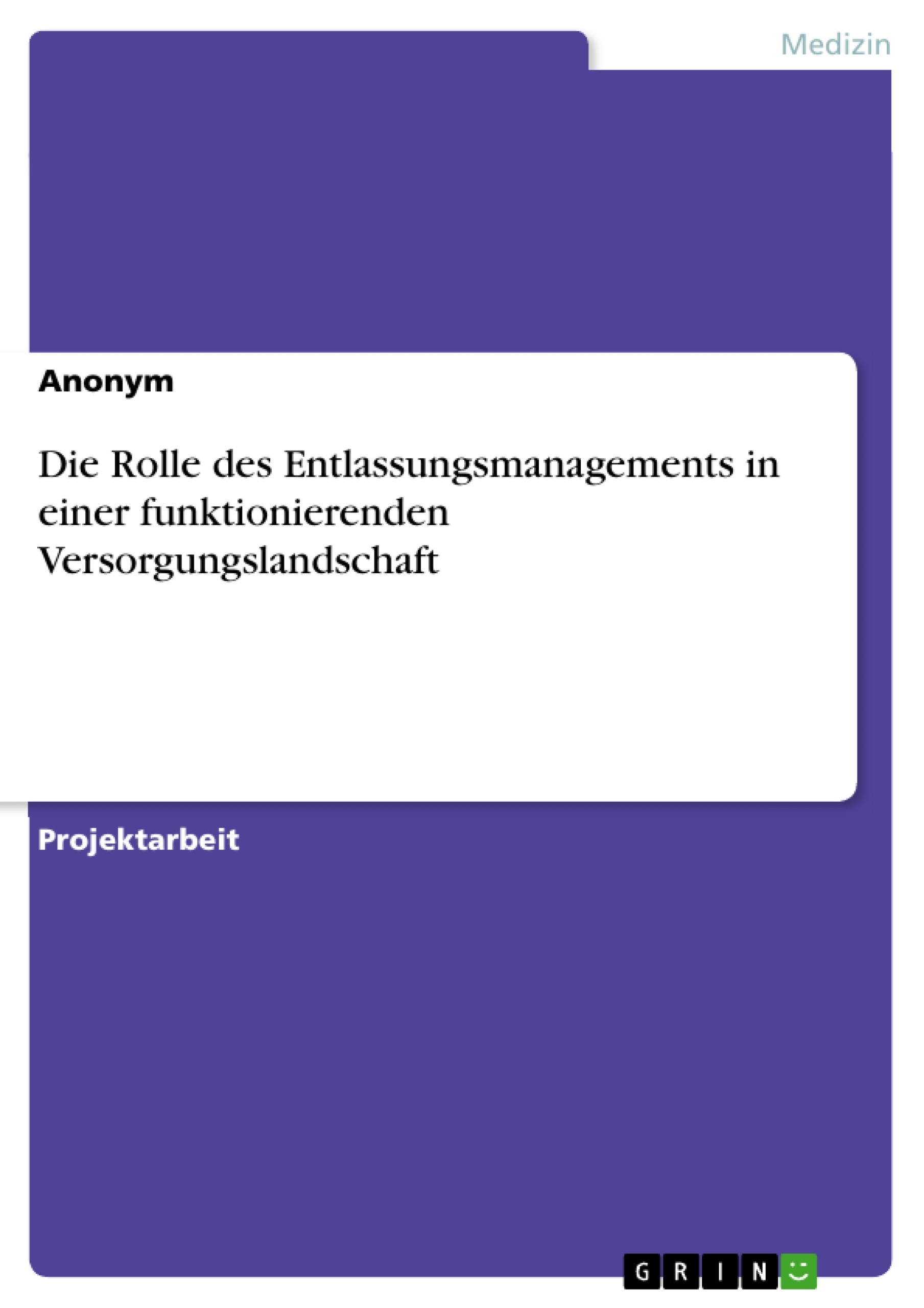Ziel der Hausarbeit ist es, die Rolle des Entlassungsmanagements im Zusammenhang mit der Versorgungslandschaft und in Hinsicht auf die Senkung der Wiederweinweisungsrate in Krankenhäuser anhand wissenschaftlich fundierter Literatur aufzuzeigen.
Das Entlassungsmanagement im Gesundheitswesen handelt unter anderem von Entlassungen von PatientInnen, welche vorher meistens im stationären Bereich versorgt wurden. Hierbei soll die Patientenversorgung beispielsweise nach einer Entlassung aus dem Krankenhaus gewährleistet werden, da hilfsbedürftige Personen ansonsten auf sich selbst gestellt sind und mit der eigenen Versorgungssituation überfordert werden. Hierbei werden mehrere Schritte eingeleitet, um diverse Möglichkeiten bezüglich der Bewältigung der Versorgung nach einer potentiellen Entlassung aufzustellen. Häufig beginnt das Entlassungsmanagement bereits im Rahmen der Pflegeanamnese, indem die bisherige Versorgung der PatientInnen und deren Hilfsbedürftigkeit eruiert wird. Falls die Einschätzung ergibt, dass der/die Patient/In nach der Entlassung weitere Hilfestellung bezüglich der Versorgung benötigt, wird das pflegerische Entlassungsmanagement zur Beratung der PatientInnen herangezogen. Im Rahmen von mehreren Beratungsgesprächen können diese eine Unterstützung in zahlreichen Bereichen erhalten, wie zum Beispiel bei der Antragstellung von Leistungen durch die Pflegeversicherung. Hierbei muss vor Augen geführt werden, dass das Phänomen des Entlassungsmanagements nicht ausschließlich PatientInnen betrifft sondern auch oftmals deren Angehörige davon betroffen sind.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Hauptteil / Ergebnisse
- 2.1 Aufgaben des Entlassungsmanagements
- 2.2 Beispiele für das Entlassungsmanagement
- 2.3 Problemfelder des Entlassungsmanagements
- 2.4 Einfluss auf die Versorgungslandschaft
- 2.5 Zukunftsperspektiven
- 2.6 Persönliche Reflexion
- 3 Zusammenfassung der Ergebnisse und Fazit
- 4 Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Projektarbeit untersucht die Rolle des Entlassungsmanagements in der Verbesserung der Versorgungslandschaft im Gesundheitswesen. Das Ziel ist aufzuzeigen, inwiefern das Entlassungsmanagement zur Senkung der Wiedereinweisungsrate in Krankenhäuser beiträgt. Die Arbeit analysiert dazu die Aufgaben des Entlassungsmanagements, präsentiert praxisrelevante Beispiele und beleuchtet zukünftige Perspektiven.
- Aufgaben und Tätigkeitsfelder des Entlassungsmanagements
- Beispiele für die praktische Anwendung des Entlassungsmanagements
- Der Einfluss des Entlassungsmanagements auf die Versorgungsqualität
- Herausforderungen und Problemfelder im Entlassungsmanagement
- Zukunftsaussichten und Entwicklungspotenziale des Entlassungsmanagements
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Entlassungsmanagements im Gesundheitswesen ein und beschreibt dessen Bedeutung für die Versorgung von Patienten nach einem Krankenhausaufenthalt. Sie hebt die Notwendigkeit des Entlassungsmanagements zur Vermeidung von Überforderung bei hilfsbedürftigen Personen hervor und skizziert die verschiedenen Schritte und Beteiligten im Prozess. Die Einleitung formuliert die zentrale Forschungsfrage, ob das Entlassungsmanagement die Qualität der Versorgung verbessern und die Wiedereinweisungsrate senken kann.
2 Hauptteil / Ergebnisse: Der Hauptteil präsentiert die Ergebnisse der Untersuchung. Die Aufgaben des Entlassungsmanagements werden detailliert erläutert, wobei Beratung, die Erhebung von Informationen über den Patienten und die Festlegung des Pflegebedarfs im Mittelpunkt stehen. Es wird betont, wie wichtig die Berücksichtigung des Gesundheitszustands, der Ressourcen und des sozialen Umfelds des Patienten für eine erfolgreiche Versorgung ist. Die Rolle der Überleitungspflege als Teil des Entlassungsmanagements wird erklärt und die Bedeutung der Zusammenführung von Krankenhausversorgung und Nachsorge hervorgehoben. Die Kapitel 2.2 - 2.5 werden in einer zusammenfassenden Betrachtung der Kapitel 2 zusammengefasst und beleuchten wichtige Aspekte wie Beispiele für das Entlassungsmanagement (z.B. im Kontext von Long-COVID), Problemfelder, den Einfluss auf die Versorgungslandschaft und Zukunftsperspektiven.
Schlüsselwörter
Entlassungsmanagement, Gesundheitswesen, Patientenversorgung, Wiedereinweisungsrate, Versorgungslandschaft, Überleitungspflege, Pflegebedürftigkeit, Beratung, Long-COVID.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument: Entlassungsmanagement im Gesundheitswesen
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über das Thema Entlassungsmanagement im Gesundheitswesen. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel sowie Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Analyse der Rolle des Entlassungsmanagements bei der Verbesserung der Versorgungslandschaft und der Senkung der Wiedereinweisungsrate.
Welche Kapitel sind im Dokument enthalten?
Das Dokument gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Hauptteil/Ergebnisse (mit Unterkapiteln zu Aufgaben, Beispielen, Problemfeldern, Einfluss auf die Versorgungslandschaft, Zukunftsperspektiven und persönlicher Reflexion), Zusammenfassung der Ergebnisse und Fazit, und Literaturverzeichnis.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Rolle des Entlassungsmanagements bei der Verbesserung der Versorgungslandschaft im Gesundheitswesen und zielt darauf ab aufzuzeigen, wie es zur Senkung der Wiedereinweisungsrate in Krankenhäuser beiträgt. Die Analyse umfasst die Aufgaben des Entlassungsmanagements, praxisrelevante Beispiele und zukünftige Perspektiven.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Aufgaben und Tätigkeitsfelder des Entlassungsmanagements, Beispiele für die praktische Anwendung, der Einfluss auf die Versorgungsqualität, Herausforderungen und Problemfelder, sowie Zukunftsaussichten und Entwicklungspotenziale.
Was wird in der Einleitung beschrieben?
Die Einleitung führt in das Thema Entlassungsmanagement ein, beschreibt dessen Bedeutung für die Patientenversorgung nach einem Krankenhausaufenthalt und hebt die Notwendigkeit zur Vermeidung von Überforderung bei hilfsbedürftigen Personen hervor. Sie skizziert den Prozess und formuliert die zentrale Forschungsfrage bezüglich der Verbesserung der Versorgungsqualität und der Senkung der Wiedereinweisungsrate.
Was beinhaltet der Hauptteil?
Der Hauptteil präsentiert detailliert die Aufgaben des Entlassungsmanagements (Beratung, Informationserhebung, Festlegung des Pflegebedarfs), betont die Berücksichtigung des Gesundheitszustands, der Ressourcen und des sozialen Umfelds des Patienten, erläutert die Rolle der Überleitungspflege und beleuchtet wichtige Aspekte wie Beispiele (z.B. im Kontext von Long-COVID), Problemfelder, den Einfluss auf die Versorgungslandschaft und Zukunftsperspektiven.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die Schlüsselwörter umfassen: Entlassungsmanagement, Gesundheitswesen, Patientenversorgung, Wiedereinweisungsrate, Versorgungslandschaft, Überleitungspflege, Pflegebedürftigkeit, Beratung, Long-COVID.
Gibt es eine Zusammenfassung der Ergebnisse?
Ja, das Dokument enthält eine Zusammenfassung der Ergebnisse und ein Fazit, die die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammenfassen.
Für wen ist dieses Dokument gedacht?
Dieses Dokument richtet sich an Personen, die sich akademisch mit dem Thema Entlassungsmanagement im Gesundheitswesen auseinandersetzen möchten. Die bereitgestellten Informationen dienen der Analyse von Themen in strukturierter und professioneller Weise.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2022, Die Rolle des Entlassungsmanagements in einer funktionierenden Versorgungslandschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1234648