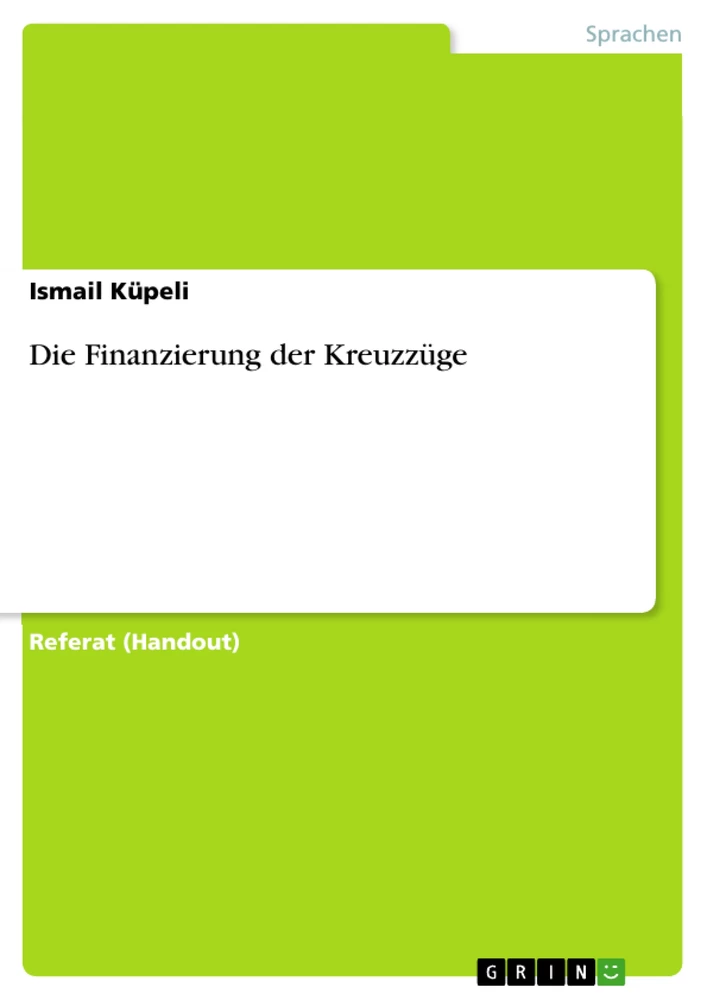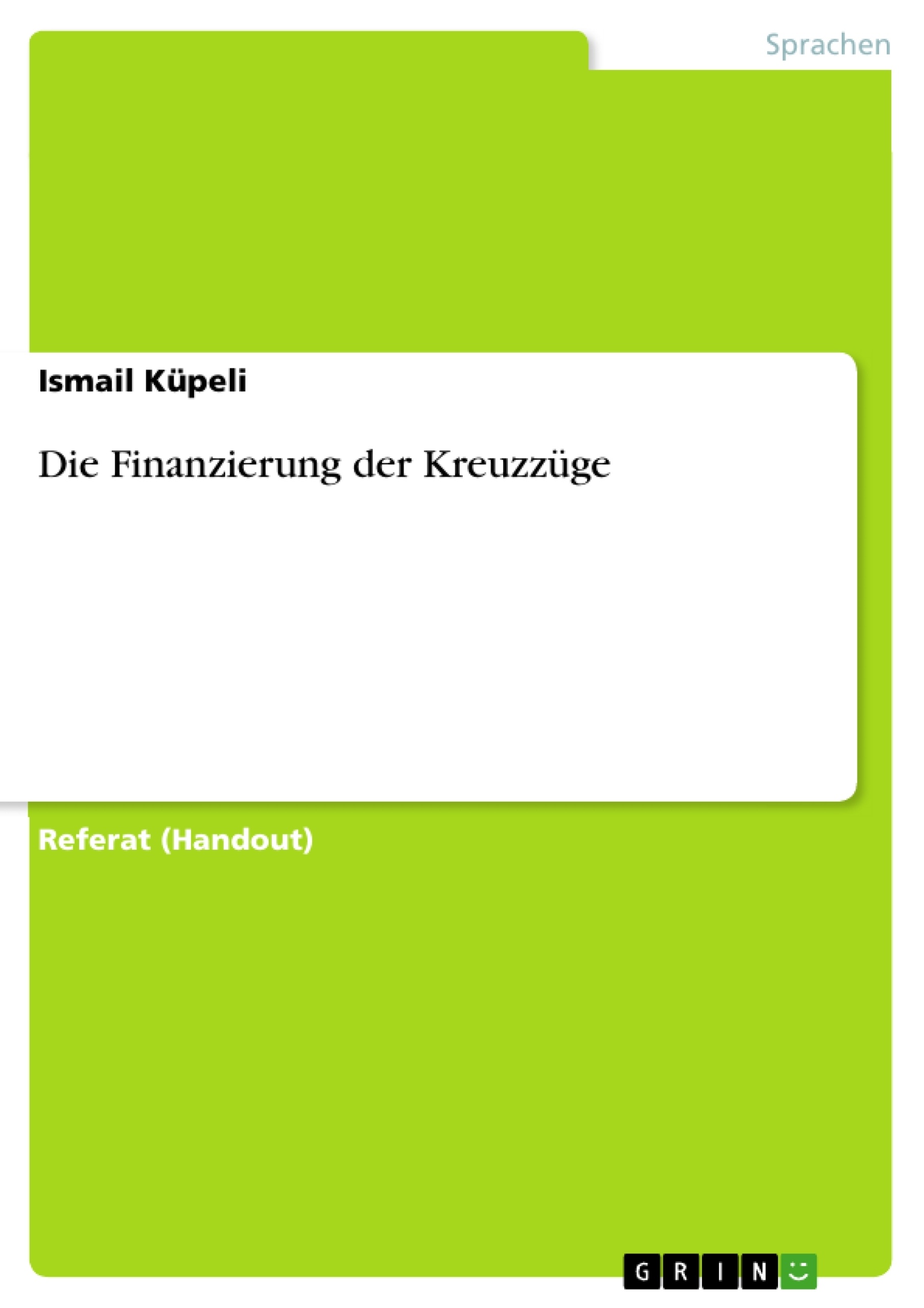Die erste allgemeine Steuer für die Unterstützung der Kreuzzüge wurde 1166 in Frankreich (1%) und in England (2%) erhoben. Es war keine direkte Finanzierung eines Kreuzzuges. Die Einnahmen wurden nach Jerusalem geschickt, für Militärausgaben wie z.B. Söldnerlöhne und den Bau von Festungen.
Der Saladin-Zehnte von 1188 ist dagegen die erste Steuer, die explizit für einen Kreuzzug eingetrieben werden sollte. Alle Nicht-Kreuzfahrer sollten 10% ihrer Einnahmen und des Wertes ihrer beweglichen Eigentümer abgeben. In Frankreich waren die Fürsten, die an den Kreuzzügen teilnahmen, von der Steuer selbst befreit und konnten die Steuern, die von ihren Untergebenen zu bezahlen waren, einbehalten. Dies führte dazu, dass viele Fürsten zuerst angaben, bei den Kreuzzügen teilnehmen zu wollen, um so die Steuereinnahmen zu erhalten. Später erfüllten sie ihre Versprechen nicht.
Staatliche Finanzierung der Kreuzzüge
Die erste allgemeine Steuer für die Unterstützung der Kreuzzüge wurde 1166 in Frankreich (1%) und in England (2%) erhoben. Es war keine direkte Finanzierung eines Kreuzzuges. Die Einnahmen wurden nach Jerusalem geschickt, für Militärausgaben wie z.B. Söldnerlöhne und den Bau von Festungen.
Der Saladin-Zehnte von 1188 ist dagegen die erste Steuer, die explizit für einen Kreuzzug eingetrieben werden sollte. Alle Nicht-Kreuzfahrer sollten 10% ihrer Einnahmen und des Wertes ihrer beweglichen Eigentümer abgeben. In Frankreich waren die Fürsten, die an den Kreuzzügen teilnahmen, von der Steuer selbst befreit und konnten die Steuern, die von ihren Untergebenen zu bezahlen waren, einbehalten. Dies führte dazu, dass viele Fürsten zuerst angaben, bei den Kreuzzügen teilnehmen zu wollen, um so die Steuereinnahmen zu erhalten. Später erfüllten sie ihre Versprechen nicht.
Private Finanzierung der Kreuzzüge
Die Kreuzzüge, insbesondere im 12. und 13. Jh., wurden hauptsächlich privat finanziert. Die wenigsten Kreuzfahrer verfügten über genügend finanzielle Mittel, um ihre Reise zu finanzieren. Die häufigste Vorgehensweise war deswegen der Verkauf oder die Verpfändung von Eigentum (Grundstücke, Gebäude, Einnahmen, Werkzeuge, Rechte). Kreuzfahrer boten ihr Eigentum an, und religiöse Einrichtungen (Kirchen, Klöster etc.) boten im Gegenzug die Mittel an, die für den Kreuzzug benötigt wurden. Neben Geld konnte dies in Form von Ausrüstungen oder etwa Pferden geschehen. Die Kreuzfahrer waren dabei auch bereit, ihr Eigentum bei schlechten Konditionen zu verpfänden.
Um diese Prozesse noch weiter zu erleichtern und für die Kreuzfahrer attraktiver zu machen, wurden die Kreuzfahrer von Zinszahlungen befreit, und sie durften (anders als bis dahin) ihr Eigentum ohne Zustimmung ihrer Angehörigen oder Herrscher verkaufen, bzw. verpfänden. Die Zinsbefreiung war für die Geldverleiher jedoch kein größeres Problem, weil sie die Einnahmen aus den verpfändeten Objekten (z.B. Grundstücken) behalten durften, so dass die effektiven Zinsen bei etwa 7,5% lagen.
Die Kirchen ihrerseits verkauften ihre Schätze in Form von Gold, Silber und Edelsteinen, damit sie genug finanzielle Mittel hatten, um den Kreuzfahrern Darlehen gegen Pfand anzubieten. Die Kreuzzüge waren für Kirchen und Klöster eine günstige Gelegenheit, um Eigentum (z.B. Grundstücke) zu erwerben. Die Verträge waren oft so gestaltet, dass die verpfändeten Güter der Kirche zufielen, wenn der ehemalige Schuldner (ohne Nachkommen) starb, auch dann wenn die Schulden zurückbezahlt waren.
Die Kreuzfahrer fragten neben (Geld-)Mitteln für ihre Reise auch spirituelle Dienstleistungen nach. So haben die Kreuzfahrer für ihre Spenden an die Kirche die Zusicherung für Begräbnisse, Andachten, Gebete und Leichenrückführungen erhalten. Ein weiterer Grund für Spenden an die Kirche war die Sorge um Seelenheil und Erlösung. So haben Gläubige, die nicht in der Lage waren an den Kreuzzügen teilzunehmen, stattdessen gespendet.
Orden und Stiftungen
Die Kirche half nicht nur dabei, Kreuzfahrern die Mittel für ihre Reisen zur Verfügung zu stellen. Über zwei Orden (Templer und Johanniter) beteiligte sie sich in institutioneller Form militärisch an den Kreuzzügen. Die Orden bauten feste Kontingente im Osten mit Reserven in Europa auf.
Die Orden gründeten Stiftungen in Europa, um sich zu finanzieren. Die Stiftungen bekamen Almosen und Erbschaften von den Christen in Europa. Weiterhin leitete die Kirche die Spenden[1], die sie für den Kreuzzug erhielt, bald nur noch ausschließlich an diese Orden. Die Stiftungen verfügten so schnell über große Einnahmequellen (wie etwa Land, Felder, Wälder). Schließlich ermöglichte die Verbreiterung der Stiftungen in Europa und in den Kreuzfahrerstaaten, dass die Orden Geld verleihen und transferieren konnten. So konnte etwa in Jerusalem ein Darlehen gewährt werden, das dann in Frankreich zurückbezahlt wurde.
Nachwirkungen der Finanzierung der Kreuzzüge
Die alten Besitzverhältnisse wurden grundlegend geändert. Durch die privaten Formen der Finanzierung verloren feudale Adelige vielfach ihre Eigentümer. Kirchenschätze (Gold, Silber, Edelsteine) wurden in flüssige Geldmittel verwandelt, die Zirkulation von Kapital nahm zu. Durch die staatlichen Formen der Finanzierung wurden die zentralisierten finanziellen Verwaltungen vorangetrieben und Steuererhebungen wurden etabliert.
Literatur:
Constable, Giles: Monks, hermits and crusaders in Medieval Europe. London (1988), S.64-88
Cazel, Fred A.: Financing the Crusades, in: Setton, Kenneth M.: A History of the Crusades – Volume VI. Wisconsin (1989), S.116-149
[...]
Häufig gestellte Fragen
Wie wurden die Kreuzzüge staatlich finanziert?
Die erste allgemeine Steuer zur Unterstützung der Kreuzzüge wurde 1166 in Frankreich (1%) und England (2%) erhoben, obwohl sie nicht direkt für einen Kreuzzug bestimmt war. Die Einnahmen wurden nach Jerusalem geschickt und für militärische Ausgaben verwendet.
Der Saladin-Zehnte von 1188 war die erste Steuer, die explizit für einen Kreuzzug erhoben wurde. Nicht-Kreuzfahrer mussten 10% ihrer Einnahmen und ihres beweglichen Eigentums abgeben. In Frankreich waren teilnehmende Fürsten von der Steuer befreit und durften die Steuern ihrer Untergebenen einbehalten, was zu Missbrauch führte.
Wie lief die private Finanzierung der Kreuzzüge ab?
Die Kreuzzüge wurden hauptsächlich privat finanziert. Kreuzfahrer verkauften oder verpfändeten Eigentum (Grundstücke, Gebäude, Einnahmen, Werkzeuge, Rechte) an religiöse Einrichtungen. Diese boten im Gegenzug Geld, Ausrüstung oder Pferde an. Kreuzfahrer akzeptierten oft schlechte Konditionen.
Kreuzfahrer waren von Zinszahlungen befreit und durften ihr Eigentum ohne Zustimmung verkaufen oder verpfänden. Geldverleiher behielten die Einnahmen aus verpfändeten Objekten, was effektive Zinsen von etwa 7,5% ergab.
Kirchen verkauften Schätze, um Darlehen zu vergeben. Die Kreuzzüge boten Kirchen und Klöstern die Möglichkeit, Eigentum zu erwerben, oft zu ihren Gunsten, wenn Schuldner ohne Nachkommen starben.
Kreuzfahrer spendeten an die Kirche, um spirituelle Dienstleistungen wie Begräbnisse und Gebete zu erhalten. Spenden dienten auch dem Seelenheil, besonders für diejenigen, die nicht an den Kreuzzügen teilnehmen konnten.
Welche Rolle spielten Orden und Stiftungen bei der Finanzierung der Kreuzzüge?
Die Kirche beteiligte sich über Orden wie Templer und Johanniter militärisch an den Kreuzzügen. Diese Orden bauten feste Kontingente im Osten auf und gründeten Stiftungen in Europa zur Finanzierung.
Die Stiftungen erhielten Almosen und Erbschaften. Die Kirche leitete Spenden an diese Orden weiter. Die Stiftungen verfügten über große Einnahmequellen und konnten Geld verleihen und transferieren.
Welche Nachwirkungen hatte die Finanzierung der Kreuzzüge?
Die alten Besitzverhältnisse änderten sich. Feudale Adelige verloren Eigentum durch private Finanzierung. Kirchenschätze wurden in Geldmittel umgewandelt, was die Kapitalzirkulation erhöhte. Staatliche Finanzierung förderte zentralisierte Finanzverwaltungen und etablierte Steuererhebungen.
Welche Literatur wird im Text genannt?
Constable, Giles: Monks, hermits and crusaders in Medieval Europe. London (1988), S.64-88
Cazel, Fred A.: Financing the Crusades, in: Setton, Kenneth M.: A History of the Crusades – Volume VI. Wisconsin (1989), S.116-149
- Quote paper
- Ismail Küpeli (Author), 2005, Die Finanzierung der Kreuzzüge, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/123012