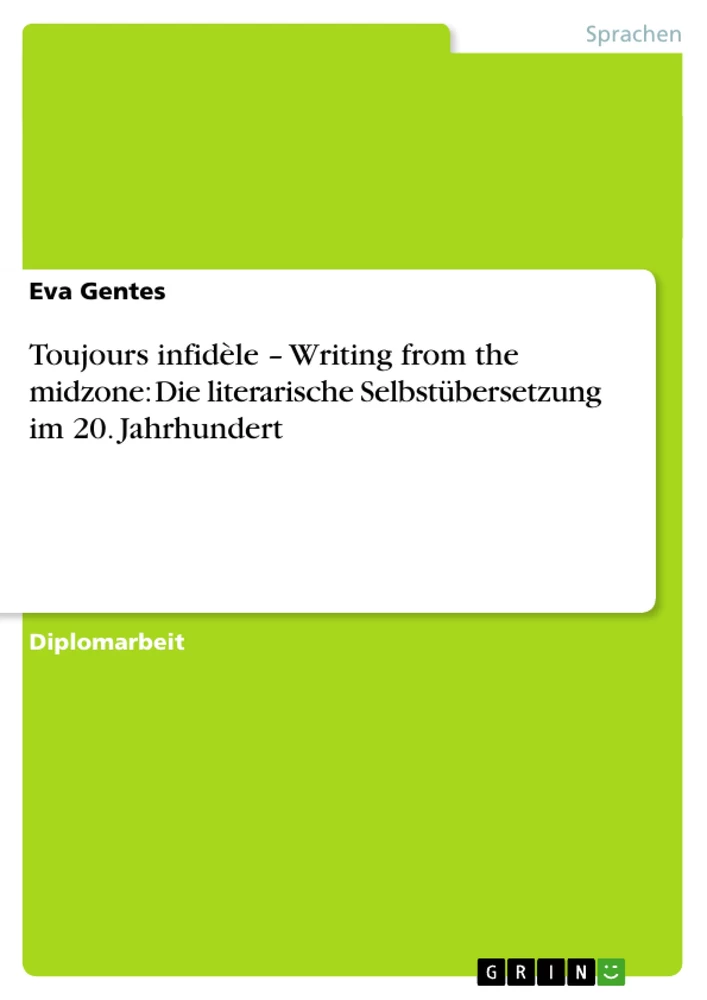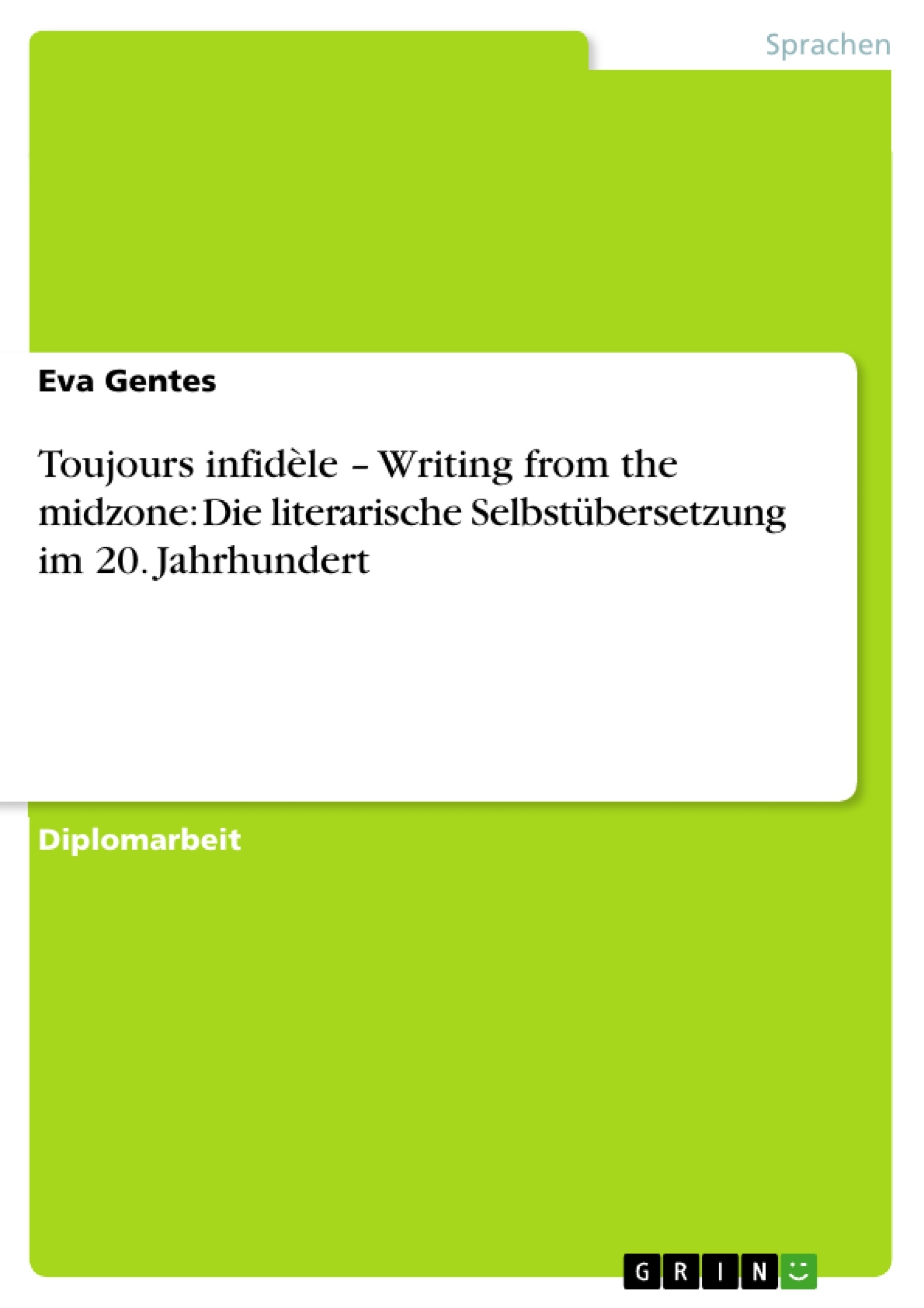In der allgemeinen Übersetzungswissenschaft wird die literarische Selbstübersetzung häufig gar nicht oder nur am Rande thematisiert. Erst in jüngster Zeit findet sie zunehmend mehr Beachtung. Vielfach stützen sich diese Analysen allerdings auf nur einen einzigen Autor oder auf die bekanntesten Selbstübersetzer wie Samuel Beckett, Vladimir Nabokov oder Julien Green. Raymond Federman betonte 1987, dass es nötig sei, eine Poetik der Selbstübersetzungen Becketts zu entwickeln. Diese Diplomarbeit möchte Federmans Forderung aufgreifen, sie jedoch angesichts einer Vielzahl von literarischen Selbstübersetzern im 20. Jahrhundert ausweiten und aufzeigen, dass die dringende Notwendigkeit besteht, eine allgemeine Poetik der literarischen Selbstübersetzung zu entwickeln. Hierzu wird ein umfassender Überblick über das Forschungsdesiderat ‚Literarische Selbstübersetzung‘ gegeben. Betrachtet werden sowohl die theoretischen wie auch praktischen Aspekte; der Schwerpunkt liegt hierbei auf dem 20. Jahrhundert. Zentrale Fragestellungen sind hierbei: Aus welchen Gründen übersetzen sich Autoren selbst? Wie gehen sie bei dabei vor? Welche Unterschiede bestehen zwischen einem Selbstübersetzer und einem Fremdübersetzer? Welches Verhältnis entsteht zwischen Originaltext und Selbstübersetzung? Welche Anforderungen ergeben sich für den Fremdübersetzer aus dem besonderen Verhältnis von Originaltext und Selbstübersetzung?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Forschungsstand
- Sprachwahl und Sprachkompetenz bilingualer Autoren
- Optionen der Sprachwahl
- Gründe der Sprachwahl
- Grenzen der Sprachwahl
- Literarische Sprachkompetenz
- Literarische Mehrsprachigkeit
- Geschichte der literarischen Selbstübersetzung
- Die literarische Selbstübersetzung im 20. Jahrhundert
- Raymond Federman
- Nancy Huston
- Vassilis Alexakis
- Rosario Ferré
- Aspekte der literarischen Selbstübersetzung
- Gründe für die Selbstübersetzung
- Methodik der Selbstübersetzung
- 'Traduction auctoriale' oder 'Traduction allographe'
- Theorie der literarischen Selbstübersetzung
- Verhältnis Autor - Selbstübersetzer - Fremdübersetzer
- Freiheiten des Selbstübersetzers
- Verhältnis Original - Selbstübersetzung
- Konsequenzen der literarischen Selbstübersetzung für den Fremdübersetzer
- Helena Tanqueiro als Übersetzerin von Antoni Mari
- Elmar Tophoven als Übersetzer von Samuel Beckett
- Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die literarische Selbstübersetzung im 20. Jahrhundert. Ziel ist es, aufzuzeigen, dass dieses Phänomen weit verbreitet ist und über die bekannten Fälle hinausgeht. Die Arbeit beleuchtet verschiedene Aspekte der Selbstübersetzung, untersucht die Entscheidungen der Autoren in Bezug auf Sprachwahl und -kompetenz und analysiert die Auswirkungen auf den Prozess und das Ergebnis der Übersetzung.
- Die Verbreitung und Geschichte der literarischen Selbstübersetzung im 20. Jahrhundert
- Die Motivlagen und Methoden der Selbstübersetzung
- Der Einfluss der kulturellen Kontexte auf die Übersetzungsentscheidungen
- Das Verhältnis von Originaltext und Selbstübersetzung
- Die Konsequenzen der Selbstübersetzung für den Fremdübersetzer
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der literarischen Selbstübersetzung ein und stellt fest, dass dieses Thema in der Übersetzungswissenschaft lange vernachlässigt wurde. Sie hebt die Bedeutung von Samuel Beckett als prominentestes Beispiel hervor, betont aber gleichzeitig, dass viele weitere Autoren Selbstübersetzungen geschaffen haben, die einer genaueren Betrachtung bedürfen. Die Arbeit erklärt die Notwendigkeit einer umfassenderen Untersuchung des Phänomens und skizziert den weiteren Aufbau der Arbeit.
Forschungsstand: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über den bisherigen Forschungsstand zur literarischen Selbstübersetzung. Es werden frühere Einzelstudien zu Autoren wie Nabokov und Beckett erwähnt, welche oft auf einen einzelnen Autor fokussierten. Der Kapitel beschreibt den Wandel der Forschung, vom Fokus auf Einzelstudien hin zu umfassenderen Analysen, die mehrere Autoren und verschiedene Aspekte berücksichtigen. Es werden die wichtigsten Beiträge zu dieser Thematik zusammengefasst und deren Schwerpunkte herausgestellt, wie beispielsweise die Berücksichtigung des kulturellen Kontexts bei den Übersetzungsentscheidungen oder die Frage nach dem Status der Selbstübersetzung.
Sprachwahl und Sprachkompetenz bilingualer Autoren: Dieses Kapitel analysiert die verschiedenen Aspekte der Sprachwahl bilingualer Autoren. Es beleuchtet die Optionen, die diesen Autoren zur Verfügung stehen, die Gründe für ihre jeweiligen Sprachentscheidungen und die Grenzen, denen sie dabei begegnen. Darüber hinaus wird die literarische Sprachkompetenz der Autoren untersucht, um zu verstehen, wie ihre Beherrschung mehrerer Sprachen ihre Schreibweise und Übersetzungspraktiken beeinflusst. Der Abschnitt betrachtet die sprachlichen Herausforderungen und Möglichkeiten, die sich aus dem Umgang mit mehreren Sprachen ergeben.
Literarische Mehrsprachigkeit: Dieses Kapitel vertieft das Verständnis von Mehrsprachigkeit im literarischen Kontext. Es geht um die Auswirkungen der Beherrschung mehrerer Sprachen auf den kreativen Prozess und das literarische Werk. Es wird diskutiert, wie die Mehrsprachigkeit die literarische Identität und die Wahl des Ausdrucks prägt. Die Kapitel untersucht auch, wie sich die literarische Mehrsprachigkeit im Werk der behandelten Autoren widerspiegelt und wie es ihre Selbstübersetzungen beeinflusst.
Geschichte der literarischen Selbstübersetzung: Dieser Abschnitt verfolgt die historische Entwicklung der literarischen Selbstübersetzung. Es geht um den Wandel dieses Phänomens im Laufe der Zeit und die sich verändernden Bedingungen und Kontexte, in denen es stattfindet. Es werden unterschiedliche Epochen und literarische Strömungen beleuchtet und deren Einfluss auf die Praxis der Selbstübersetzung untersucht. Das Kapitel bietet einen chronologischen Überblick mit Einordnung in literaturgeschichtliche Zusammenhänge.
Die literarische Selbstübersetzung im 20. Jahrhundert: Dieses Kapitel präsentiert Fallstudien von verschiedenen Autoren des 20. Jahrhunderts, die sich der literarischen Selbstübersetzung widmeten. Es werden die individuellen Strategien und Herangehensweisen dieser Autoren untersucht und verglichen. Die detaillierten Analysen der Werke dieser Autoren zeigen die Vielfalt und die Komplexität des Phänomens der Selbstübersetzung im 20. Jahrhundert auf. Die Kapitel dient als empirische Grundlage für die weiteren theoretischen Überlegungen der Arbeit.
Aspekte der literarischen Selbstübersetzung: Dieses Kapitel beleuchtet die verschiedenen Aspekte der literarischen Selbstübersetzung. Es geht sowohl um die Gründe, warum Autoren ihre Werke selbst übersetzen, als auch um die Methoden, die sie dabei anwenden. Darüber hinaus wird die Debatte um die Bezeichnungen "Traduction auctoriale" und "Traduction allographe" diskutiert und ihre Bedeutung für das Verständnis des Übersetzungsprozesses erörtert. Der Kapitel bietet eine differenzierte Betrachtung der verschiedenen Aspekte des Phänomens.
Theorie der literarischen Selbstübersetzung: Dieses Kapitel befasst sich mit der theoretischen Fundierung der literarischen Selbstübersetzung. Es analysiert das komplexe Verhältnis zwischen Autor, Selbstübersetzer und Fremdübersetzer. Es geht um die Freiheiten, die der Selbstübersetzer im Vergleich zu einem Fremdübersetzer hat, und die Veränderungen die durch den Übersetzungsprozess am Originaltext vorgenommen werden. Die Kapitel stellt die zentralen theoretischen Fragestellungen und Debatten dar.
Konsequenzen der literarischen Selbstübersetzung für den Fremdübersetzer: Dieses Kapitel befasst sich mit den Auswirkungen der literarischen Selbstübersetzung auf die Arbeit von Fremdübersetzern. Es werden Fallbeispiele präsentiert, um die Herausforderungen und Chancen aufzuzeigen, die mit der Übersetzung von bereits selbstübersetzten Werken verbunden sind. Es wird diskutiert, wie Fremdübersetzer mit den Entscheidungen des Autors umgehen und wie sie ihre eigene Arbeit in diesem Kontext gestalten. Der Kapitel verdeutlicht die Interdependenz zwischen Selbst- und Fremdübersetzung.
Schlüsselwörter
Literarische Selbstübersetzung, Bilingualität, Mehrsprachigkeit, Übersetzungstheorie, 20. Jahrhundert, Raymond Federman, Nancy Huston, Vassilis Alexakis, Rosario Ferré, Samuel Beckett, Vladimir Nabokov, Julien Green, Sprachwahl, Übersetzungsmethode, kultureller Kontext.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Literarische Selbstübersetzung im 20. Jahrhundert
Was ist der Gegenstand der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit untersucht die literarische Selbstübersetzung im 20. Jahrhundert. Sie geht über bekannte Fälle hinaus und beleuchtet verschiedene Aspekte dieses Phänomens, analysiert die Entscheidungen der Autoren hinsichtlich Sprachwahl und -kompetenz und deren Auswirkungen auf den Übersetzungs-prozess und das Ergebnis.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Verbreitung und Geschichte der literarischen Selbstübersetzung im 20. Jahrhundert, die Motivlagen und Methoden der Selbstübersetzung, den Einfluss kultureller Kontexte auf die Übersetzungsentscheidungen, das Verhältnis von Originaltext und Selbstübersetzung sowie die Konsequenzen der Selbstübersetzung für den Fremdübersetzer.
Welche Autoren werden im Detail untersucht?
Die Arbeit analysiert detailliert die Selbstübersetzungen von Raymond Federman, Nancy Huston, Vassilis Alexakis und Rosario Ferré. Zusätzlich werden Samuel Beckett und Vladimir Nabokov als prominente Beispiele erwähnt und in den Kontext eingeordnet. Die Arbeit von Julien Green wird ebenfalls thematisiert.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung und einem Überblick über den Forschungsstand. Es folgen Kapitel zur Sprachwahl und Sprachkompetenz bilingualer Autoren, zur literarischen Mehrsprachigkeit, zur Geschichte und dem 20. Jahrhundert der literarischen Selbstübersetzung. Weitere Kapitel befassen sich mit Aspekten der literarischen Selbstübersetzung, der Theorie der literarischen Selbstübersetzung und den Konsequenzen für den Fremdübersetzer. Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung und einem Ausblick.
Welche Aspekte der Selbstübersetzung werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die Gründe für die Selbstübersetzung, die Methoden der Selbstübersetzung, den Unterschied zwischen "Traduction auctoriale" und "Traduction allographe", das Verhältnis zwischen Autor, Selbstübersetzer und Fremdübersetzer, die Freiheiten des Selbstübersetzers und das Verhältnis zwischen Original und Selbstübersetzung.
Welche Rolle spielt der kulturelle Kontext?
Der kulturelle Kontext spielt eine wichtige Rolle bei den Übersetzungsentscheidungen der Autoren. Die Arbeit analysiert, wie kulturelle Einflüsse die Sprachwahl, die Methoden und das Ergebnis der Selbstübersetzung beeinflussen.
Wie werden die Fallstudien präsentiert?
Die Fallstudien zu den genannten Autoren im 20. Jahrhundert dienen als empirische Grundlage. Sie zeigen die Vielfalt und Komplexität des Phänomens der Selbstübersetzung auf und werden detailliert analysiert, um die individuellen Strategien und Herangehensweisen zu vergleichen.
Welche Konsequenzen hat die literarische Selbstübersetzung für den Fremdübersetzer?
Die Arbeit untersucht die Herausforderungen und Chancen für Fremdübersetzer, die mit der Übersetzung bereits selbstübersetzter Werke konfrontiert sind. Anhand von Fallbeispielen (z.B. Helena Tanqueiro/Antoni Mari, Elmar Tophoven/Samuel Beckett) wird die Interdependenz zwischen Selbst- und Fremdübersetzung beleuchtet.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Literarische Selbstübersetzung, Bilingualität, Mehrsprachigkeit, Übersetzungstheorie, 20. Jahrhundert, Raymond Federman, Nancy Huston, Vassilis Alexakis, Rosario Ferré, Samuel Beckett, Vladimir Nabokov, Julien Green, Sprachwahl, Übersetzungsmethode, kultureller Kontext.
Was ist das Fazit der Arbeit?
Die Arbeit zeigt, dass die literarische Selbstübersetzung ein weit verbreitetes Phänomen im 20. Jahrhundert ist, das einer umfassenderen Betrachtung bedarf. Sie analysiert die komplexen Aspekte dieses Phänomens und seine Auswirkungen auf den Übersetzungsprozess und das Ergebnis.
- Arbeit zitieren
- Eva Gentes (Autor:in), 2008, Toujours infidèle – Writing from the midzone: Die literarische Selbstübersetzung im 20. Jahrhundert , München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/122638