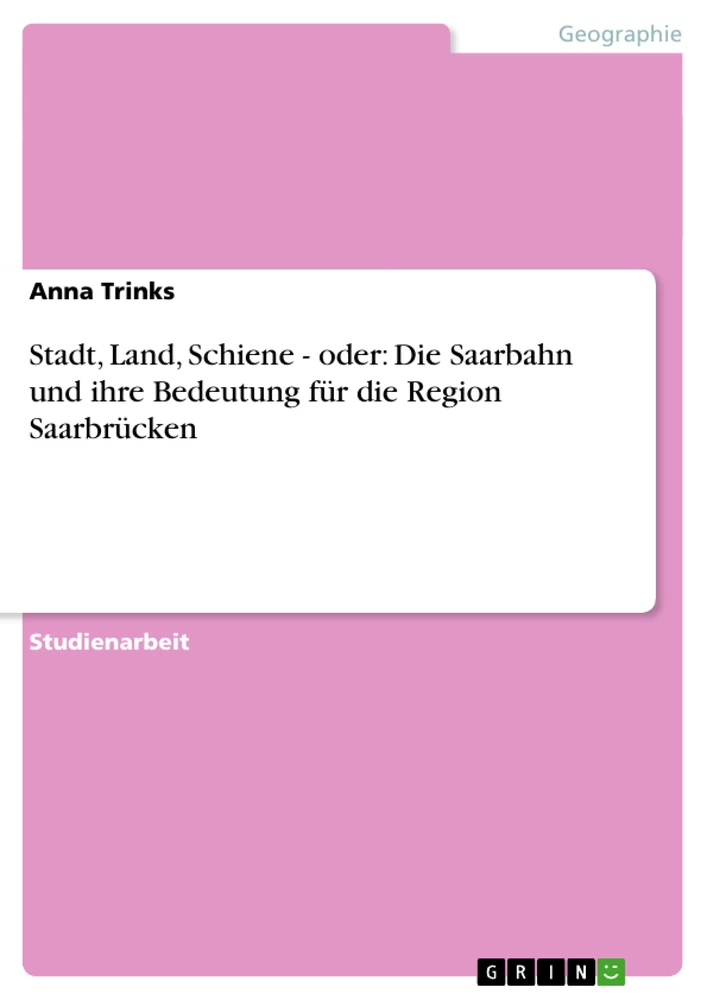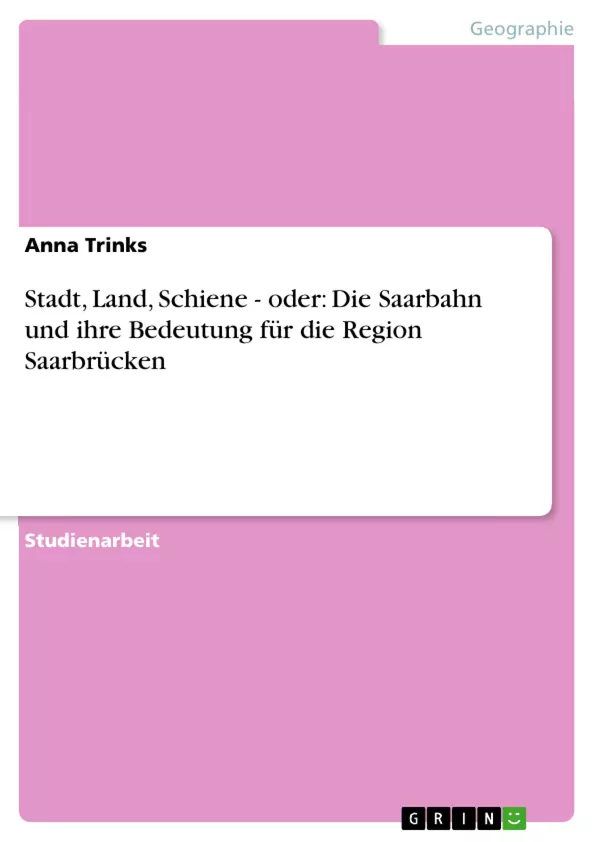Mit dem stetigen Wachstum der meisten Städte in Deutschland im 20. Jahrhundert wuchs auch die Mobilität ihrer Bewohner und die der angrenzenden Gemeinden. Es wurde selbstverständlich in einem anderen Ort zu wohnen als zu arbeiten, woanders einzukaufen als sich zu erholen. Die Suburbanisierung expandierte und das Automobil wurde zu dem beliebtesten Beförderungsmittel um die so genannten „Daseinsgrundfunktionen“ (HEINEBERG 2001:152) an den dafür qualitativ besten Orten aufsuchen zu können.
Heute, im 21. Jahrhundert, können die Mobilitätsansprüche der Bevölkerung nicht mehr durch den Individualverkehr bewältigt werden und die lange Zeit propagierte autogerechte Stadt hat sich als Irrweg entpuppt.
Die Stadt Saarbrücken und ihre Region gelten als Ballungszentrum mit hohen Ein- sowie Auspendlerraten innerhalb des Saarlandes und auch über die französische Grenze hinweg, weshalb man auch von einem „grenzüberschreitenden Verdichtungsraum“ (HUNSICKER 1998:12) spricht. Überfüllte Autobahnen und lähmende Staus zur rush-hour sollten teilweise mit einem busgestützten ÖPNV regional abgeschwächt werden aber der steigende Mobilitätsbedarf brachte dieses System bald an seine Grenzen.
Die Stadt und das Umland verlärmten, es wurden bundesweite Höchstraten der Kfz-Dichte gemessen von bis zu 610 Kfz pro 1000 Einwohner (nach: SAARBAHN GmbH 1997:6). Das Ziel wurde nun, die Stadt wieder lebenswerter zu gestalten und die Pendlerzahlen durch andere Transportmöglichkeiten in den Griff zu bekommen.
1991 wurde mit einer Grundsatzentscheidung der Gesellschaft der Straßenbahnen im Saartal AG der Grundstein für eine Einführung einer neuen Lösung für den öffentlichen Personennahverkehr gelegt. Eine „Saarbahn“ sollte gebaut werden, die ähnlich wie in den Städten Karlsruhe und Kassel mit einer „Verknüpfung zweier Systemvorteile funktionieren sollte - hohe Geschwindigkeit in der Region und dichte Haltestellenabstände in der Innenstadt“ (HUNSICKER 1998:57). [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Das Gesamtkonzept
- 2.1 Das Pendlerproblem
- 2.2 Vorhandene Infrastruktur
- 2.3 Wichtige Beschlussfassungen
- 2.4 Die Ausbaustufen
- 3 Statistiken zu Voraussetzungen, Tendenzen und Einschätzungen
- 3.1 Grundlage der Statistiken
- 3.2 Mobilität
- 3.2.1 Verkehrsmittelwahl
- 3.2.2 Wege von und nach Saarbrücken
- 3.3 Einschätzungen
- 3.3.1 Kommunale Probleme
- 3.3.2 Entwicklung Straßenverkehr
- 3.4 Die Saarbahn
- 3.4.1 Persönliche Einschätzung
- 3.4.2 Einschätzung der allgemeinen Stimmung
- 3.4.3 Aktuelle Zahlen und Fakten
- 4 Probleme bei der Stadtgestaltung im Innenstadtbereich von Saarbrücken
- 4.1 Die Stadt und ihre Stadtgestaltung
- 4.2 Die Saarbahn im Straßenraum
- 4.3 Stadtgestaltung und die Saarbahn
- 4.3.1 Der Hauptbahnhof
- 4.3.2 Haltestelle Rathaus/Johanniskirche
- 4.3.3 Haltestelle Hellwigstraße
- 4.3.4 Allgemeine Probleme im Zusammenhang mit der Stadtgestaltung
- 5 Die Saarbahn in der Region: Bedeutung für den Grenzraum
- 5.1 Die Stadtbahn und die Verknüpfung mit Frankreich
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Einführung der Saarbahn in Saarbrücken und die damit verbundenen Herausforderungen und Chancen. Sie analysiert die Notwendigkeit des Projekts vor dem Hintergrund des Pendlerproblems und der bestehenden Infrastruktur. Die Studie beleuchtet die stadtplanerischen Auswirkungen der Saarbahn und deren Bedeutung für die gesamte Region, insbesondere im grenzüberschreitenden Kontext.
- Das Pendlerproblem in Saarbrücken und der angrenzenden Region
- Die Rolle der Saarbahn als Lösung für Verkehrsüberlastung
- Stadtplanerische Herausforderungen durch die Integration der Saarbahn
- Die Bedeutung der Saarbahn für den grenzüberschreitenden Verkehr
- Bewertung des Gesamtkonzepts der Saarbahn
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung beschreibt das Wachstum der Mobilität im 20. Jahrhundert und die daraus resultierende Suburbanisierung. Sie führt in das Problem der Verkehrsüberlastung in Saarbrücken ein, das durch hohe Pendlerzahlen, sowohl innerhalb des Saarlandes als auch aus Frankreich, verursacht wird. Die unzureichende Bewältigung des Verkehrsaufkommens durch den Individualverkehr und das bestehende Bussystem wird dargelegt. Die Einführung der Saarbahn als innovative Lösung für den öffentlichen Personennahverkehr wird als Hauptthema der Arbeit vorgestellt.
2 Das Gesamtkonzept: Dieses Kapitel präsentiert das Gesamtkonzept der Saarbahn, beginnend mit der Beschreibung des Pendlerproblems als zentrale Herausforderung. Es analysiert die bereits bestehende Infrastruktur, wie das Eisenbahnnetz und das Autobahnnetz, und wie diese mit dem neuen System interagieren. Wichtige Beschlussfassungen zur Umsetzung des Projekts werden beleuchtet, einschließlich der Gründe für die Ablehnung eines rein busbasierten Systems und der strategischen Planung der Saarbahntrasse zur Beeinflussung des Verkehrsflusses.
3 Statistiken zu Voraussetzungen, Tendenzen und Einschätzungen: Dieses Kapitel liefert statistische Daten zu den Voraussetzungen, Tendenzen und Erwartungen vor der Einführung der Saarbahn. Es analysiert verschiedene Aspekte der Mobilität, wie die Verkehrsmittelwahl und die Pendelwege, sowie die Einschätzungen kommunaler Probleme und der Entwicklung des Straßenverkehrs. Die Rolle der Saarbahn im Kontext dieser Statistiken wird ausführlich diskutiert, inklusive der persönlichen und öffentlichen Meinungen zum Projekt.
4 Probleme bei der Stadtgestaltung im Innenstadtbereich von Saarbrücken: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Auswirkungen der Saarbahn auf die Stadtgestaltung im Innenstadtbereich von Saarbrücken. Es analysiert die Integration der Saarbahn in das Stadtbild an ausgewählten Haltestellen und beleuchtet die damit verbundenen Herausforderungen und Probleme. Die Diskussion umfasst Aspekte wie den Einfluss auf den Verkehrsfluss, die Gestaltung des öffentlichen Raums und die Bedürfnisse der Fußgänger.
5 Die Saarbahn in der Region: Bedeutung für den Grenzraum: Das Kapitel behandelt die regionale Bedeutung der Saarbahn, insbesondere im Hinblick auf den grenzüberschreitenden Verkehr mit Frankreich. Es untersucht die Verknüpfung der Saarbahn mit dem französischen Verkehrssystem und analysiert die Chancen und Herausforderungen dieser grenzüberschreitenden Anbindung.
Schlüsselwörter
Saarbahn, öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV), Pendlerverkehr, Stadtgestaltung, Saarbrücken, Grenzraum, Frankreich, Mobilität, Verkehrsmittelwahl, Stadtplanung, Infrastruktur, Verkehrsprobleme.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Saarbahn in Saarbrücken
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet eine umfassende Übersicht über eine Studie zur Saarbahn in Saarbrücken. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Analyse der Einführung der Saarbahn, der damit verbundenen Herausforderungen und Chancen für die Stadt und die Region, insbesondere im Hinblick auf den Pendlerverkehr und den grenzüberschreitenden Verkehr nach Frankreich.
Welche Themen werden in der Studie behandelt?
Die Studie untersucht das Pendlerproblem in Saarbrücken und der Umgebung, die Rolle der Saarbahn als Lösung für Verkehrsüberlastung, die stadtplanerischen Herausforderungen durch die Integration der Saarbahn, die Bedeutung der Saarbahn für den grenzüberschreitenden Verkehr und eine Bewertung des Gesamtkonzepts der Saarbahn. Es werden Statistiken zu Mobilität, Verkehrsmittelwahl und den Einschätzungen der Kommunen analysiert. Die Auswirkungen auf die Stadtgestaltung im Innenstadtbereich von Saarbrücken, insbesondere an verschiedenen Haltestellen, werden ebenfalls detailliert betrachtet.
Welche Kapitel umfasst die Studie?
Die Studie gliedert sich in fünf Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung) beschreibt das Problem der Verkehrsüberlastung und die Saarbahn als Lösungsansatz. Kapitel 2 (Gesamtkonzept) erläutert das Konzept der Saarbahn, die bestehende Infrastruktur und wichtige Entscheidungen. Kapitel 3 (Statistiken) präsentiert Daten zu Mobilität, Verkehrsmittelwahl und Einschätzungen. Kapitel 4 (Stadtgestaltung) konzentriert sich auf die Auswirkungen der Saarbahn auf die Stadtgestaltung in Saarbrücken. Kapitel 5 (Regionale Bedeutung) behandelt die Bedeutung der Saarbahn für den grenzüberschreitenden Verkehr mit Frankreich.
Welche Probleme bei der Stadtgestaltung werden angesprochen?
Die Studie analysiert die Integration der Saarbahn in das Stadtbild Saarbrückens, insbesondere an den Haltestellen Hauptbahnhof, Rathaus/Johanniskirche und Hellwigstraße. Es werden allgemeine Probleme im Zusammenhang mit der Stadtgestaltung und den Auswirkungen auf den Verkehrsfluss, den öffentlichen Raum und die Bedürfnisse der Fußgänger diskutiert.
Welche Rolle spielt die Saarbahn für den grenzüberschreitenden Verkehr?
Die Studie untersucht die Bedeutung der Saarbahn für den grenzüberschreitenden Verkehr zwischen Saarbrücken und Frankreich. Es wird analysiert, wie die Saarbahn mit dem französischen Verkehrssystem verknüpft ist und welche Chancen und Herausforderungen sich daraus ergeben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Studie am besten?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Saarbahn, öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV), Pendlerverkehr, Stadtgestaltung, Saarbrücken, Grenzraum, Frankreich, Mobilität, Verkehrsmittelwahl, Stadtplanung, Infrastruktur und Verkehrsprobleme.
Für wen ist diese Studie relevant?
Diese Studie ist relevant für Stadtplaner, Verkehrsexperten, Entscheidungsträger in der Kommunalpolitik, Wissenschaftler und alle, die sich für die Entwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs, Stadtgestaltung und die grenzüberschreitende Mobilität in der Region Saarbrücken interessieren.
- Arbeit zitieren
- Dipl. Geogr, Anna Trinks (Autor:in), 2005, Stadt, Land, Schiene - oder: Die Saarbahn und ihre Bedeutung für die Region Saarbrücken, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/122538