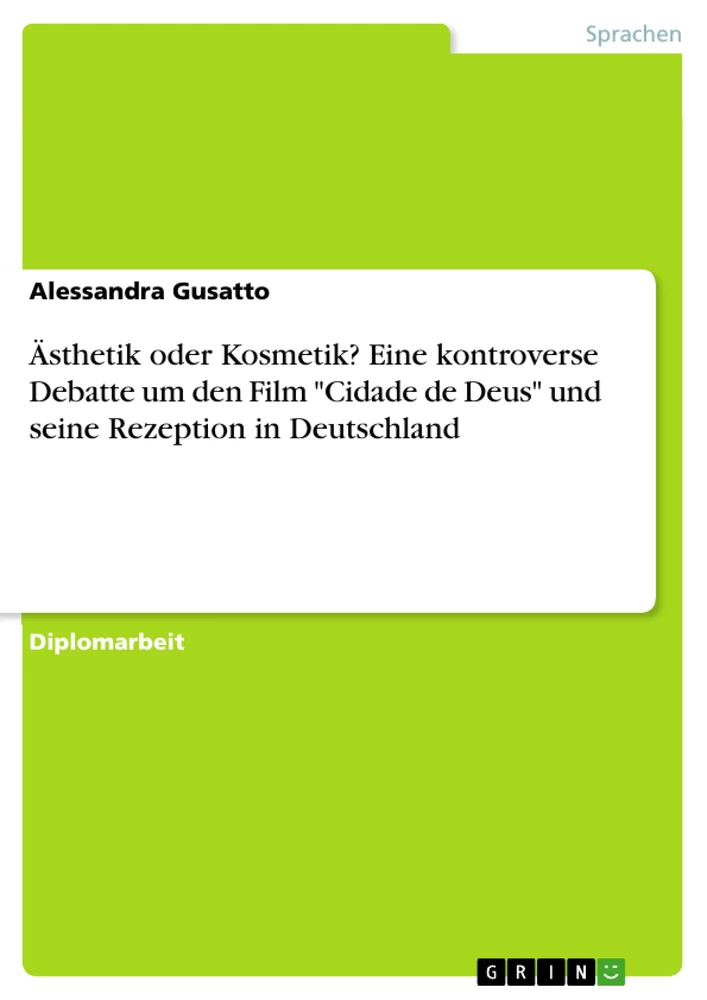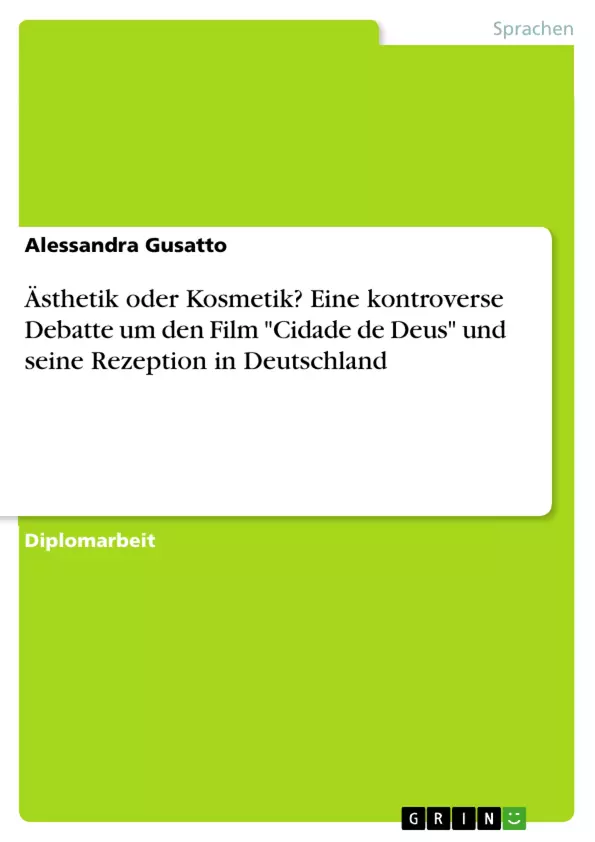Cidade de Deus wird zu City of God: „Deutsche“ Titelübersetzung als Ideengeber für die vorliegende Arbeit.
Als der Film Cidade de Deus 2003 in Deutschland anlief, war ich sehr überrascht, dass der Film die entsprechende englische Titelübersetzung, City of God, bekommen hat. Dies hat mich sehr beschäftigt und ich sah in der Diplomarbeit die Möglichkeit zur Ausarbeitung des Themas. Ausgangspunkt war eine potenzielle Fehlrezeption. Bereits durch die Titelübernahme unterstützt von mangelden Hintergrundkenntnissen seitens des deutschen Publikums konnte ich nicht verstehen, dass man einen brasilianischen Titel aus dem Englischen übernimmt ohne weitere Erklärungen dafür zu geben. Die kommerziellen Absichten, die damit verbunden sind, waren mir von Anfang an bekannt, jedoch wurde die Gefahr einen deutschen Fehlrezeption vergrößert. Der Film wurde vom Publikum und von der Kritik insgesamt gut aufgenommen und 2003 in Deutschland laut einer Statistik aus der Lumiere-Datenbank von 447.001 Zuschauern gesehen. In Europa war der Film nur in Großbritanien noch erfolgreicher. Als Vergleich kann man Central do Brasil (1998) von Walter Salles heranziehen, auch ein weiterer erfolgreicher Film der brasilianischen retomada, der im Vergleich jedoch nur ca. 293.000 Zuschauer in Deutschland erreichte.
Die Arbeit ist in vier Kapitel gegliedert. Das erste Kapitel bildet einen Überblick über die Entstehung des Films Cidade de Deus und seinen Inhalt. Im zweiten Kapitel wird der brasilianische Film chronologisch dargestellt, um eine Grundlage für das bessere Verständnis des Kapitelschwerpunktes vorzubereiten: Die Auseinandersetzung um den heutigen brasilianischen Film.
Die Wiederbelebung und Verstärkung dieser Debatte durch Cidade de Deus verursachte außerdem eine interdisziplinäre Debatte: Von einer Ästhetik zu einer Kosmetik des Hungers. Diese Diskussion hat in Brasilien für enorme Auseinandersetzungen v. a. im Bereich der Medienwissenschaft gesorgt und kennzeichnet sie auch heute noch. Die Wissenschaftlerin Ivana Bentes prägte diese theoretische Welle mit ihrer Kosmetik des Hungers in Anlehnung an der von Glauber Rocha in den 60er Jahren entstandenen revolutionären Theorie der Ästhetik des Hungers. Die Ästhetik des Hungers fungierte als eine Art Manifest für das brasilianische cinema novo und diente als theoretische Grundlage der Bewegung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Entstehung der Cidade de Deus: Realer und fiktiver Ort
- Filmgeschichte in Brasilien
- Entstehung des brasilianischen Films
- Realitätsfilm in Brasilien: Eine Geschichte der Gattung
- Realität im Film: Ein kurzer Überblick
- Realität im brasilianischen Film: Eine Tradition?
- Allegorie der Realität: Das Cinema Novo
- Die letzten Jahrzehnte: Ein kurzer Überblick
- Estética vs. Cosmética da Fome
- Estética da Fome
- Cosmética da Fome
- Debatte über den heutigen brasilianischen Film und die Cosmética da Fome: Cidade de Deus als Vorreiter
- Cidade de Deus: Zwischen Fiktion und Realität
- Gewalt im brasilianischen Film
- Gewalt in Cidade de Deus
- Realitätseffekt in Cidade de Deus: Dokumentarische Fiktion und fiktive Dokumentation
- Kosmetik des Hungers durch die Übersetzung des Films?
- Ein kurzer Überblick über die Filmübersetzung
- Untertitelung
- Synchronisation
- City of God: Ein mittelalterlich theologischer Titel oder Die Kirche lässt grüßen
- Eigennamen: Eine Sache für sich
- Die Synchronisation und Untertitelung im Film Cidade de Deus
- Die Synchronisation in Cidade de Deus
- Die Untertitelung in Cidade de Deus
- Ausgewählte Beispielszenen für die Übersetzungsanalyse
- Szene 1: Die Entstehung der Stadt Gottes (00:01:59 bis 00:07:52)
- Szene 2: Der Überfall auf das Motel (00:10:21 bis 00:11:27)
- Szene 3: Die Cocotas am Strand (00:32:53 bis 00:34:22)
- Ein kurzer Überblick über die Filmübersetzung
- Rezeption des Films Cidade de Deus in Deutschland: Eine Fehlrezeption?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Rezeption des brasilianischen Films "Cidade de Deus" in Deutschland, insbesondere im Hinblick auf die Titelübersetzung "City of God". Die zentrale Frage ist, ob die englische Titelübernahme zu einer Fehlrezeption geführt hat. Die Arbeit analysiert den Film im Kontext der brasilianischen Filmgeschichte und der Debatte um "Ästhetik" und "Kosmetik des Hungers".
- Die Entstehung und der Inhalt von "Cidade de Deus"
- Die Geschichte des brasilianischen Realismusfilms
- Die Debatte um "Ästhetik" und "Kosmetik des Hungers" im brasilianischen Film
- Die Auswirkungen der Filmübersetzung auf die Rezeption
- Die Rezeption von "Cidade de Deus" in Deutschland
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit untersucht die Rezeption des brasilianischen Films "Cidade de Deus" in Deutschland und fragt nach möglichen Fehlrezeptionen, die durch die englische Titelübersetzung "City of God" entstanden sein könnten. Der Fokus liegt auf der Analyse der Übersetzung und deren Einfluss auf das Verständnis des Films im deutschen Kontext. Die überraschend hohe Zuschauerzahl im Vergleich zu anderen brasilianischen Filmen in Deutschland wird ebenfalls thematisiert.
Entstehung der Cidade de Deus: Realer und fiktiver Ort: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die Entstehung des Films "Cidade de Deus", indem es die realen und fiktiven Aspekte der Geschichte beleuchtet. Es beschreibt den Hintergrund und die Inspirationsquellen des Films, um einen Kontext für die anschließende Analyse zu schaffen. Der Bezug zur Realität wird als Ausgangspunkt für die spätere Diskussion über die "Realitätseffekte" im Film gelegt.
Filmgeschichte in Brasilien: Dieses Kapitel präsentiert eine chronologische Darstellung der brasilianischen Filmgeschichte, um das Verständnis des Films "Cidade de Deus" im Kontext seiner nationalen Tradition zu erleichtern. Es werden wichtige Strömungen wie das Cinema Novo und die Debatte um "Ästhetik" und "Kosmetik des Hungers" detailliert behandelt. Die Bedeutung dieser Debatte für die Interpretation von "Cidade de Deus" wird hervorgehoben.
Kosmetik des Hungers durch die Übersetzung des Films?: Dieses Kapitel analysiert die Übersetzung des Filmtitels und die Auswirkungen auf die Rezeption in Deutschland. Es wird die Frage nach einer möglichen "Fehlrezeption" aufgrund der englischen Titelübernahme untersucht. Der Kapitel vergleicht verschiedene Aspekte der Übersetzung (Untertitelung und Synchronisation) und analysiert exemplarisch ausgewählte Szenen. Die Auswirkung der gewählten Titelübersetzung auf das Verständnis des deutschen Publikums wird im Detail untersucht.
Rezeption des Films Cidade de Deus in Deutschland: Eine Fehlrezeption?: Dieses Kapitel untersucht die Rezeption des Films "Cidade de Deus" im deutschen Kontext, mit besonderem Fokus auf der möglichen Fehlrezeption aufgrund der englischen Titelübersetzung. Es wird die kritische und öffentliche Resonanz analysiert, und der Vergleich mit anderen brasilianischen Filmen soll die Besonderheiten der Rezeption verdeutlichen.
Schlüsselwörter
Cidade de Deus, City of God, brasilianischer Film, Realitätsfilm, Cinema Novo, Ästhetik des Hungers, Kosmetik des Hungers, Filmübersetzung, Synchronisation, Untertitelung, Rezeption, Fehlrezeption, Deutschland, Brasilien.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Cidade de Deus": Rezeptionsanalyse im deutschsprachigen Raum
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Rezeption des brasilianischen Films "Cidade de Deus" ("City of God") im deutschsprachigen Raum. Der Schwerpunkt liegt auf der Untersuchung möglicher Fehlrezeptionen, die durch die Übernahme des englischen Titels "City of God" entstanden sein könnten. Die Arbeit betrachtet den Film im Kontext der brasilianischen Filmgeschichte und der Debatte um "Ästhetik" und "Kosmetik des Hungers".
Welche Aspekte werden in der Arbeit untersucht?
Die Arbeit untersucht verschiedene Aspekte, darunter die Entstehung und den Inhalt von "Cidade de Deus", die Geschichte des brasilianischen Realismusfilms, die Debatte um "Ästhetik" und "Kosmetik des Hungers", die Auswirkungen der Filmübersetzung (insbesondere Titelübersetzung, Synchronisation und Untertitelung) auf die Rezeption, und schließlich die Rezeption von "Cidade de Deus" in Deutschland im Vergleich zu anderen brasilianischen Filmen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Entstehung der Cidade de Deus: Realer und fiktiver Ort, Filmgeschichte in Brasilien, Kosmetik des Hungers durch die Übersetzung des Films?, und Rezeption des Films Cidade de Deus in Deutschland: Eine Fehlrezeption?. Jedes Kapitel befasst sich mit einem spezifischen Aspekt der Rezeptionsanalyse.
Wie wird die Filmübersetzung analysiert?
Die Analyse der Filmübersetzung konzentriert sich auf die Auswirkungen der Titelübersetzung von "Cidade de Deus" zu "City of God". Es werden die Unterschiede zwischen Untertitelung und Synchronisation betrachtet und exemplarisch ausgewählte Szenen analysiert, um den Einfluss der Übersetzung auf das Verständnis des Films im deutschen Kontext zu beleuchten.
Welche zentrale Forschungsfrage wird gestellt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet, ob die Übernahme des englischen Titels "City of God" zu einer Fehlrezeption des Films "Cidade de Deus" im deutschsprachigen Raum geführt hat. Die Arbeit untersucht, ob die Übersetzung die Wahrnehmung und das Verständnis des Films im deutschen Kontext beeinflusst hat.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Cidade de Deus, City of God, brasilianischer Film, Realitätsfilm, Cinema Novo, Ästhetik des Hungers, Kosmetik des Hungers, Filmübersetzung, Synchronisation, Untertitelung, Rezeption, Fehlrezeption, Deutschland, Brasilien.
Welche Methode wird zur Analyse verwendet?
Die Arbeit verwendet eine qualitative Methode, die die Analyse der Filmübersetzung, die Einordnung in die brasilianische Filmgeschichte und die Untersuchung der Rezeptionsgeschichte im deutschsprachigen Raum kombiniert. Die Auswertung von ausgewählten Szenen dient als empirische Grundlage für die Analyse.
Warum ist die Rezeption von "Cidade de Deus" in Deutschland von Interesse?
Die Rezeption von "Cidade de Deus" in Deutschland ist von Interesse, da der Film, im Gegensatz zu anderen brasilianischen Filmen, eine überraschend hohe Zuschauerzahl erreichte. Diese Tatsache legt die Frage nach den Gründen für diesen Erfolg und nach möglichen Einflüssen der Übersetzung nahe.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
(Die konkrete Schlussfolgerung ist in der bereitgestellten Textvorlage nicht explizit formuliert und müsste aus der vollständigen Arbeit entnommen werden.) Die Arbeit zielt darauf ab, die potentiellen Auswirkungen der Titelübersetzung und anderer Übersetzungsaspekte auf die Rezeption im deutschsprachigen Raum zu untersuchen und zu bewerten.
- Quote paper
- Dipl. Übersetzerin Alessandra Gusatto (Author), 2006, Ästhetik oder Kosmetik? Eine kontroverse Debatte um den Film "Cidade de Deus" und seine Rezeption in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/122529