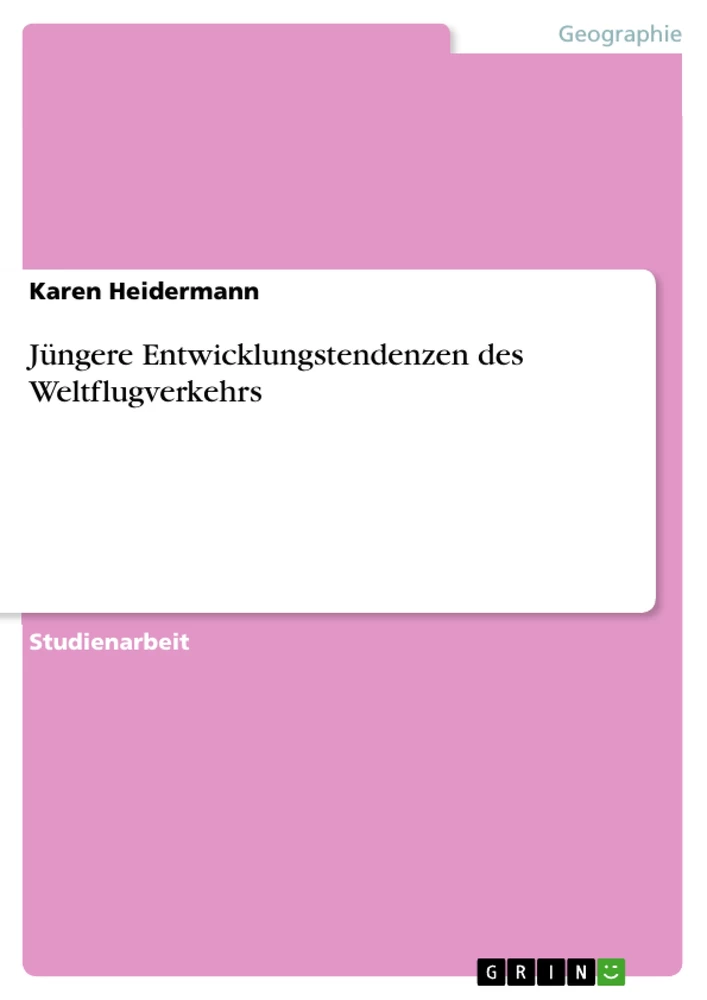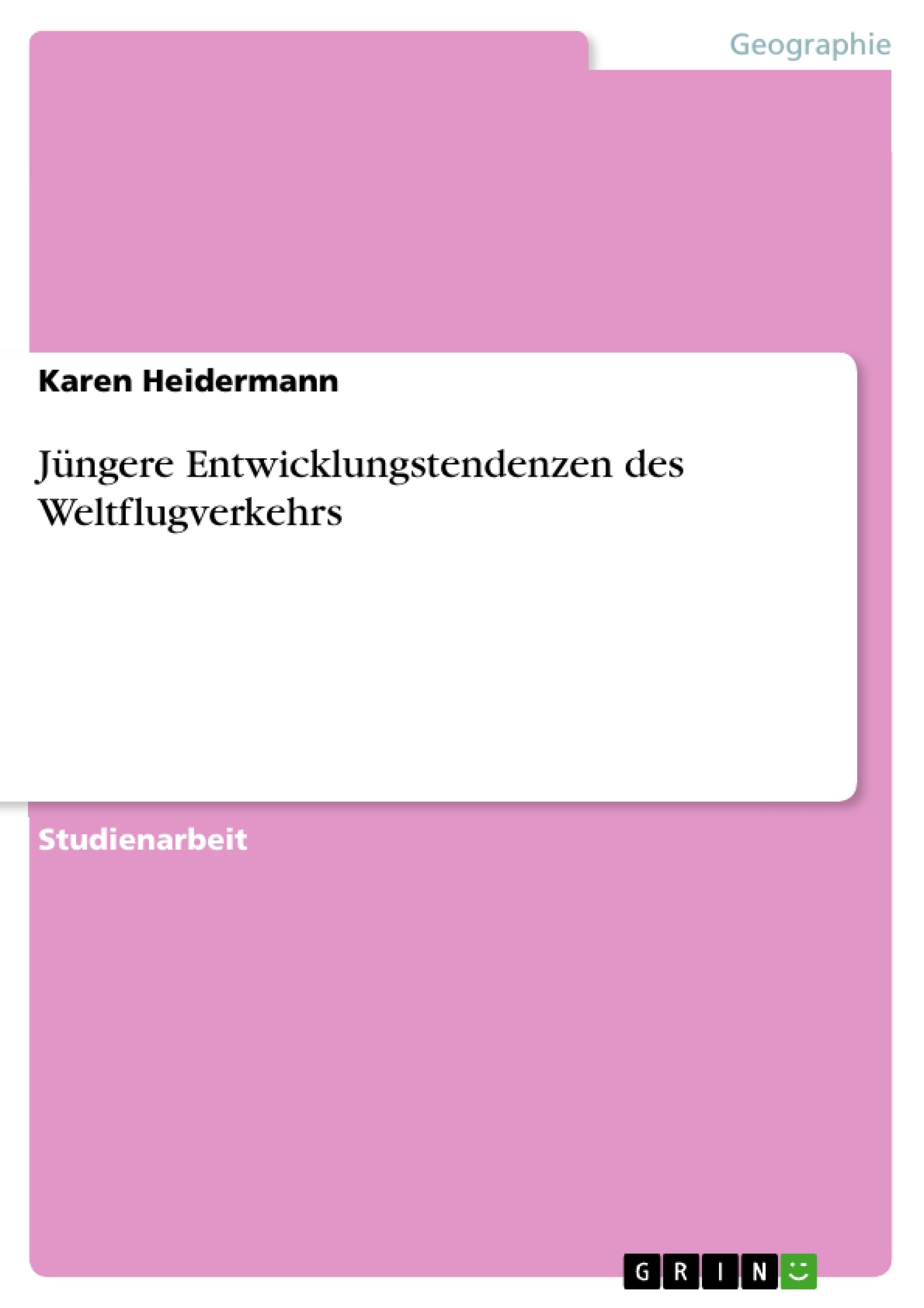Wer heutzutage einen Flug bucht, muss damit rechnen, mit SAS zu fliegen, obwohl er Lufthansa gebucht hat. Flüge sind schon ab einem Euro erhältlich und über das Internet einfach zu buchen. Verpflegung auf Kurzstreckenflügen gehört längst der Vergangenheit an und wieso nicht bequem online einchecken, statt am Check-In-Schalter Schlange zu stehen?
Dies sind nur einige der Phänomene, die durch die Entwicklungen der Luftverkehrsbranche, von globalen Allianzen über Low-Cost-Carrier bis hin zu Hub-and-Spoke Verbindungen, seit den 1990er Jahren hervorgerufen wurden.
Die vorliegende Arbeit stellt zunächst die allgemeine Entwicklung des weltweiten Luftverkehrs während der letzten 20 Jahre dar.
Im zweiten Teil werden dann spezielle Entwicklungen erläutert, wovon zwei wesentliche Entwicklungen im dritten Teil anhand von Fallbeispielen erneut aufgegriffen werden.
In der Schlussbetrachtung wird ein kurzer Blick auf die zukünftige Entwicklung der Branche geworfen.
Gliederung
1. Einleitung
2. Allgemeine Entwicklung des weltweiten Luftverkehrs
3. Spezielle Entwicklungen des weltweiten Luftverkehrs
3.1 Die Liberalisierung der Luftverkehrsbranche
3.2 Strategische Allianzen
3.3 Hub-and-Spoke und Punkt-zu-Punkt Verbindungen
3.4 Low-Cost-Carrier
3.5 Entwicklungen der Flughäfen
3.6 Wachstumsmarkt Ost- und Südostasien
3.7 Luftverkehr und Klimaschutz
4. Fallbeispiele
4.1 Star Alliance
4.2 Ryanair
5. Schlussbetrachtung
Literaturverzeichnis
Internetquellen
Abbildungsverzeichnis
1. Einleitung
Wer heutzutage einen Flug bucht, muss damit rechnen, mit SAS zu fliegen, obwohl er Lufthansa gebucht hat. Flüge sind schon ab einem Euro erhältlich und über das Internet einfach zu buchen. Verpflegung auf Kurzstreckenflügen gehört längst der Vergangenheit an und wieso nicht bequem online einchecken, statt am Check-In-Schalter Schlange zu stehen?
Dies sind nur einige der Phänomene, die durch die Entwicklungen der Luftverkehrsbranche, von globalen Allianzen über Low-Cost-Carrier bis hin zu Hub-and-Spoke Verbindungen, seit den 1990er Jahren hervorgerufen wurden.
Die vorliegende Arbeit stellt zunächst die allgemeine Entwicklung des weltweiten Luftverkehrs während der letzten 20 Jahre dar.
Im zweiten Teil werden dann spezielle Entwicklungen erläutert, wovon zwei wesentliche Entwicklungen im dritten Teil anhand von Fallbeispielen erneut aufgegriffen werden.
In der Schlussbetrachtung wird ein kurzer Blick auf die zukünftige Entwicklung der Branche geworfen.
2. Allgemeine Entwicklung des weltweiten Luftverkehrs
Die Luftverkehrsbranche ist ein durch starkes Wachstum gekennzeichneter Wirtschaftszweig. Während die ersten Jahre des 21. Jahrhunderts durch Krisen (Terroranschläge in den USA, SARS, Golfkrieg, allgemeine Schwäche der Weltkonjunktur) gekennzeichnet waren, die deutliche Auswirkungen auf den Luftverkehr hatten, befindet sich die Branche seit 2004/2005 wieder auf Wachstumskurs ( 2004: 4). Abbildung 1 stellt die Entwicklung des internationalen Luftverkehrs ab 1970 in geflogenen Passagierkilometern dar und prognostiziert einen Anstieg zwischen 2005 und 2024 um 4,8%.
Während Airlines, die Mitglied der International Air Transport Association (IATA) sind, zwischen 2001 und 2003 einen Verlust an Passagieren um 5% verzeichneten, steigen die Passagierzahlen seit 2004 wieder an ( 2004: 4; 2007: 28).
Abb. 1: Entwicklung und Prognose des internationalen Flugverkehrs
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Begründet wird das Wachstum vor allem in vier Punkten:
- Globalisierung, die ohne den internationalen Luftverkehr nicht denkbar wäre
- Die Erschließung von wirtschaftlich aufstrebenden Regionen wie Asien und Osteuropa
- Die Liberalisierung der Branche, die mehr Wettbewerb ermöglicht und somit für niedrigere Ticketpreise sorgt
- Die expandierende Low-Cost-Carrier Branche, die neue Zielgruppen anspricht (Heymann 2004: 6 f.; Feldhoff 2007: 28).
Weltweit agieren über 120 Linienflugunternehmen, von denen ungefähr ein Viertel internationale Routen fliegen. Abbildung 2 gibt einen Überblick über die 20 größten Linienfluggesellschaften und ihre Transportleistung, wobei American Airlines mit 193,1 Mio. Passagierkilometern den Markt anführt ( & 2006: 150).
Trotz der steigenden Passagierzahlen, die auch mittel- bis langfristig prognostiziert werden, hat die Luftverkehrsbranche mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu kämpfen. 2005 verzeichnete die Branche einen Gesamtverlust von 3,2 Mrd. US$ ( 2007: 29). Die Gründe hierfür liegen zum einen bei den Krisenereignissen, die neben den Einbußen durch Rückgang der Passagierzahlen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2: Die Transportleistung der 20 größten Airlines
auch die Kosten für Versicherungsprämien und Sicherheitsmaßnahmen ansteigen
ließen ( 2004: 5). Zum Anderen sind der stetig steigende Kerosinpreis,
Überangebote und die durch die Liberalisierung der Branche steigende Konkurrenz für die wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Branche verantwortlich ( 2007: 29).
Die Luftfrachtbranche ist ebenfalls durch ein stetiges Wachstum gekennzeichnet. Zwischen 1986 und 2000 ist das Luftfrachtaufkommen von 5,1 Mio t. auf 17,9 Mio t. angestiegen. Boeing schätzt das Wachstum bis 2020 auf jährlich 6,4%. Unter den Fluggesellschaften ist seit dem Zusammenschluss von Air France und KLM nicht mehr Lufthansa Cargo der Marktführer im Luftfrachtgeschäft. Zieht man die reinen Luftfrachtspeditionen in die Betrachtung mit ein, führte FedEx im Jahre 2002 den Markt mit ungefähr 13.000 Mio Fracht TKT[1] an ( 2003: 199, 204; & 2006: 153). Auf die Entwicklungen in der Luftfrachtbranche wird im weiteren Verlauf der Arbeit nicht näher eingegangen.
3. Spezielle Entwicklungen des weltweiten Luftverkehrs
Der Luftverkehr ist ein sehr dynamischer Sektor. Dies zeigen die zahlreichen Entwicklungen, die während der letzten 20 Jahre stattgefunden haben. Erst die Liberalisierung der Luftverkehrsbranche ermöglichte den Großteil dieser Entwicklungen, welche in den folgenden Unterkapiteln näher beleuchtet werden.
3.1 Die Liberalisierung der Luftverkehrsbranche
Die Luftverkehrsbranche war lange Zeit weltweit einer der am stärksten regulierten Wirtschaftssektoren. Erst in den 1970er Jahren machten wirtschaftliche Schwierigkeiten eine Liberalisierung der Branche unumgänglich (Oechsle 2005: 50).
Die Liberalisierung, die zunächst in den USA einsetzte und später in Europa, betrifft sowohl Fluggesellschaften, als auch die Flughäfen (Feldhoff 2007: 34). Der EU-Luftverkehr ist seit 1997 vollständig liberalisiert (Heymann 2004: 13). Trotz fortgeschrittener Liberalisierung der Luftverkehrsmärkte der EU und der USA, ist der Großteil der Branche, der interkontinentale Flugverkehr, noch weitestgehend reguliert. Der internationale Luftverkehr basiert auf bilateralen Abkommen, die die Bedingungen der Flüge zwischen zwei Ländern festlegen.
Derzeit gibt es zwischen den USA und der EU Verhandlungen über ein gemeinsames „Open Sky“-Abkommen. „Ziel der EU-Kommission ist es, zwischen den USA und der EU einen freien Marktzugang für die Fluggesellschaften ohne Beschränkungen der Relationen, der Kapazitäten und der Frequenzen zu etablieren.“ (Heymann 2004: 14). Solch ein Abkommen wäre ein erster Schritt in Richtung „Globaler Open Sky“, was nach Heymann jedoch eher ein langfristiges Ziel wäre. Probleme würden dabei in schwächer entwickelten Ländern auftreten, deren Airlines in einem völlig freien Wettbewerb nicht bestehen könnten. Die Region Asien-Pazifik ist ebenfalls bis heute weitestgehend reguliert, da ein starkes Konkurrenzdenken der Länder untereinander und große sozioökonomische sowie politische Disparitäten einem gemeinsamen Luftraum entgegenstehen (Heymann 2004: 15; Feldhoff 2007: 34).
Die Liberalisierung im Luftverkehr ist die Grundlage für zahlreiche Entwicklungen, die in den folgenden Kapiteln näher beschrieben werden.
3.2 Strategische Allianzen
Seit gut einem Jahrzehnt agieren die Netzwerk-Carrier des weltweiten Luftverkehrs nicht mehr als einzelne Airlines, sondern in Bündnissen, den sogenannten strategischen Allianzen. Die Airlines einer Allianz kooperieren auf verschiedenen Ebenen miteinander: im Vertrieb, im Marketing, im Kundenservice und auch im technischen Bereich (Feldhoff 2007: 30). Ein zentrales Instrument der strategischen Allianzen ist das Codesharing. Beim Codesharing führen zwei oder mehrere Airlines einen Flug gemeinsam durch, verwalten diesen aber jeweils unter einer eigenen Flugnummer. Neben der Netzausweitung und –vertiefung und somit weltweiten Marktpräsenz ist die gemeinsame Erschließung von Wachstumsmärkten, allen voran China, ein weiteres Ziel der strategischen Allianzen (Ehmer & Berster 2002: 185 f.; Feldhoff 2007: 30 f.; Heymann 2004: 9).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 3: Anteile der globalen Airlines am Passagieraufkommen
(Star Alliance 2008: 5)
1994 gab es bereits 280 Allianzen, die bis 1999 auf insgesamt 513 Allianzen anstiegen. 1997 wurde mit der Star Alliance die erste globale Allianz ins Leben gerufen, bestehend aus Lufthansa, United Airlines, SAS, Air Canada und Thai Airways International. Heute führt die Star Alliance den Markt mit über 20 Mitgliedern an (Feldhoff 2007: 31; Nuhn 2007: 9). Ihr folgten 1999 die Allianz One World, zu der u.a. British Airways und Cathay Pacific gehören und 2004 Sky Team mit u.a. Air France und KLM. Diese drei größten Bündnisse machen heute über 70% der Passagierflugleistungen unter sich aus (Nuhn 2007: 9).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Vorteile bieten strategische Allianzen vor allem aus betriebswirtschaftlicher Sicht. In der Fachliteratur wird von den sogenannten „economies of scale“, „economies of scope“, „economies of density“, also Größenvorteilen, Verbundvorteilen, Dichtevorteilen und zuletzt Vorteilen bei betriebsabhängigen Kostengrößen gesprochen (Ehmer & Berster 2002: 187). Das Streckennetz der einzelnen Airlines vergrößert sich durch die Übernahme von Angeboten der Allianzpartner enorm. Die Allianzen können zeitlich aufeinander abgestimmte Flugverbindungen an Hub-Flughäfen anbieten, wovon letztendlich der Kunde profitiert (Feldhoff 2007: 30; Oechsle 2005: 55).
Zukünftig werden einige Anforderungen auf die Allianzen im Weltflugverkehr zukommen. Wie schon beschrieben steht die Erschließung Chinas im Fokus der Allianzen. Hier haben die asiatischen Airlines allerdings ebenfalls Interesse, so dass europäische Airlines in Zukunft wohl eher Marktanteile einbüßen werden (Feldhoff 2007: 31). Die Koordination innerhalb der Allianzen stellt bei zunehmender Zahl der Mitglieder eine Herausforderung dar. Von den Aufsichtsbehörden in den Vereinigten Staaten von Amerika und in Europa werden Allianzen geduldet, da zur Zeit noch die Vorteile für den Kunden überwiegen. Aus wettbewerbspolitischer Sicht schränken sie jedoch den Wettbewerb auf dem Weltflugmarkt erheblich ein, so dass hier in Zukunft ebenfalls Probleme auftauchen könnten (Nuhn 2007: 9; Heymann 2004: 17 f.).
[...]
[1] Maß für die Beförderungsleistung im Frachtverkehr (Ton Kilometers Transported)
- Arbeit zitieren
- Karen Heidermann (Autor:in), 2008, Jüngere Entwicklungstendenzen des Weltflugverkehrs, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/122467