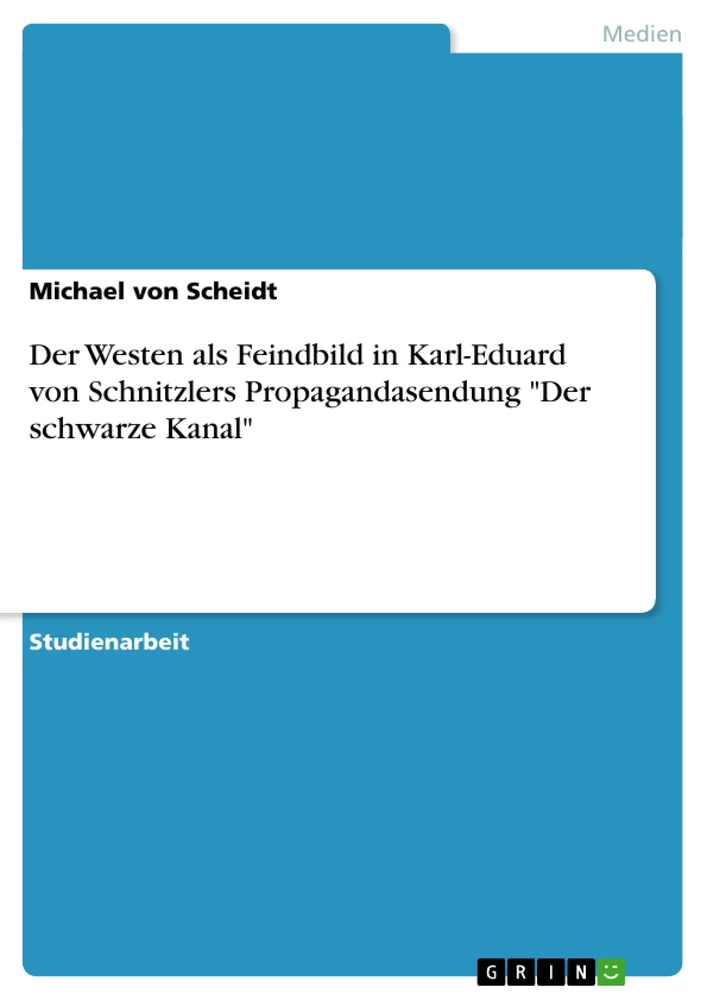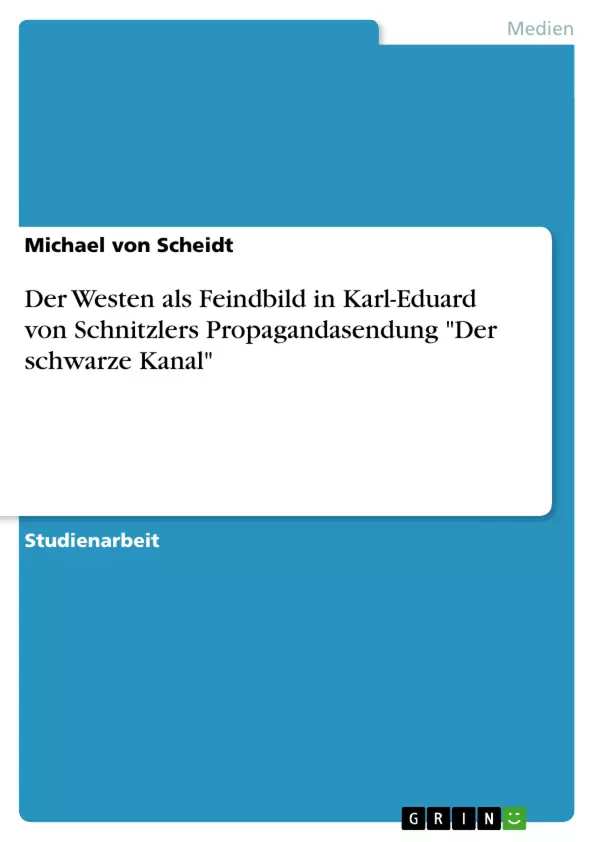In einem Artikel, der anlässlich des Todes Karl-Eduard von Schnitzlers im September 2001 im "Spiegel" erschien, wurde seine Fernsehsendung "Der Schwarze Kanal" als "das Bösartigste, was das DDR-Fernsehen zu bieten hatte" beschrieben (o.V. 2001). In ähnlicher Weise schrieb "Die Welt", es falle bei einem Mann wie von Schnitzler schwer, die antike Anstandsregel "De mortuis nil nisi bene" zu befolgen (vgl. Möller 2001). Dass der Autor und Moderator auch über ein Jahrzehnt nach dem Untergang der DDR noch auf so viel Ablehnung seitens seiner westdeutschen Kollegen stieß, lag dabei nicht nur daran, dass er auch noch nach der Wende als Anwalt der SED-Politik "wie ein Leitfossil aus den kältesten Tagen des Kalten Krieges in die Gegenwart ragte" (ebd.). Es war vielmehr vor allem auf die polemische Art der Auseinandersetzung des "Chefpropagandisten der DDR" (o.V. 2001) mit der BRD in seiner Sendung zurückzuführen, die von 1960 bis 1989 insgesamt 1519 mal (vgl. Grape 2000) ausgestrahlt wurde und damit eine der traditionsreichsten Sendungen des DDR-Fernsehens war.
In dieser Arbeit soll versucht werden, den "Schwarzen Kanal" und seinen Moderator nicht, wie häufig geschehen, als besonders skurrile televisionäre Ausnahmeerscheinungen zu betrachten, sondern die Sendereihe in den Kontext der Funktionen des DDR-Journalismus im Allgemeinen und der Rolle des Fernsehens im Klassenkampf im Speziellen einzuordnen. Bevor am Beispiel dreier Sendungen, die sich im August 1961 mit dem Bau der Berliner Mauer befassen, illustriert wird, wie sich von Schnitzlers Umgang mit dem Westen als Feindbild im konkreten Fall darstellte, soll daher zunächst die Anwendung von Lenins Pressetheorie auf die DDR-Medien durch die SED und anschließend die Nutzung des Fernsehens zur Auseinandersetzung mit dem Westen vor dem Hintergrund politischer und gesellschaftlicher Entwicklungen betrachtet werden.
Zur Anfertigung dieser Arbeit standen neben der angegebenen Literatur Sendemanuskripte einzelner Ausgaben des "Schwarzen Kanals" zur Verfügung, die vom Deutschen Rundfunkarchiv im Internet zur Verfügung gestellt werden. Die herangezogenen Skripte sind inklusive der entsprechenden URLs im Quellenverzeichnis aufgelistet. Auf eine Bereitstellung der Materialien in einem Anhang wurde jedoch verzichtet, da sie zum einen einfach zugänglich sind und zum anderen, trotz der unvermeidbaren Beschränkung auf einen vergleichsweise kurzen Untersuchungszeitraum, recht umfangreich sind.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Journalismus in der DDR
- Lenin über die Aufgaben der Presse neuen Typs
- Lenins Pressetheorie als Grundlage des Journalismus in der DDR
- Kontrollmechanismen
- Arbeitssituation von Journalisten
- Fernsehen als Instrument zur ideologischen Auseinandersetzung mit dem Westen
- Der DDR-Antifaschismus als Argumentationsbasis
- Aufstieg des Fernsehens zum Massen- und Leitmedium
- Westfernsehen als Problem und publizistische Frühformen des „Fernsehkrieges“
- Massenwirksamkeit und kulturtheoretische Überlegungen im Konflikt
- „Der Schwarze Kanal“
- Karl-Eduard von Schnitzler
- Der Mauerbau als Gegenstand des „Schwarzen Kanals“ im August 1961
- Von Schnitzlers Sondersendung vom 13. August 1961
- „Der Schwarze Kanal“ vom 21. und 28. August 1961
- Schlussbetrachtung
- Literaturverzeichnis
- Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Propagandasendung „Der Schwarze Kanal“ von Karl-Eduard von Schnitzler und untersucht deren Rolle im Kontext des DDR-Journalismus und der ideologischen Auseinandersetzung mit dem Westen. Sie analysiert die Anwendung von Lenins Pressetheorie auf die DDR-Medien und beleuchtet die Funktion des Fernsehens im Klassenkampf. Anhand dreier Sendungen, die sich mit dem Bau der Berliner Mauer im August 1961 befassen, wird illustriert, wie sich von Schnitzlers Umgang mit dem Westen als Feindbild im konkreten Fall darstellte.
- Die Rolle des „Schwarzen Kanals“ im DDR-Journalismus
- Die Anwendung von Lenins Pressetheorie auf die DDR-Medien
- Das Fernsehen als Instrument der ideologischen Auseinandersetzung mit dem Westen
- Die Darstellung des Westens als Feindbild in „Der Schwarze Kanal“
- Die Verwendung von Feindbildern in der politischen Propaganda
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Relevanz der Thematik dar und beschreibt die Zielsetzung und den Aufbau der Arbeit. Es wird auf die kontroversen Reaktionen auf von Schnitzler und seine Sendung hingewiesen und die Notwendigkeit einer Einordnung in den Kontext des DDR-Journalismus betont.
Journalismus in der DDR
Dieses Kapitel widmet sich der Pressetheorie Lenins und ihrer Bedeutung für den Journalismus in der DDR. Es beleuchtet die Rolle der Partei neuen Typs, die Aufgaben der Presse neuen Typs und die Kontrollmechanismen, die im DDR-Journalismus zur Anwendung kamen.
Fernsehen als Instrument zur ideologischen Auseinandersetzung mit dem Westen
In diesem Kapitel wird die Entwicklung des Fernsehens in der DDR und seine Funktion im ideologischen Kampf gegen den Westen beleuchtet. Es werden die Argumentationsbasis des DDR-Antifaschismus, der Aufstieg des Fernsehens zum Massenmedium und die Problematik des Westfernsehens als „Fernsehkrieg“ behandelt.
„Der Schwarze Kanal“
Dieses Kapitel fokussiert auf die Sendung „Der Schwarze Kanal“ und seinen Moderator Karl-Eduard von Schnitzler. Es werden die Gestaltung und die Inhalte der Sendung im Kontext des Mauerbaus im August 1961 genauer beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen: Journalismus, Propaganda, DDR, Karl-Eduard von Schnitzler, „Der Schwarze Kanal“, Feindbild, Westen, Lenin, Pressetheorie, Massenmedien, Fernsehen, Ideologie, Klassenkampf, Mauerbau, Berlin, Antifaschismus.
Häufig gestellte Fragen
Was war das Ziel der DDR-Sendung „Der schwarze Kanal“?
Die Sendung diente der ideologischen Auseinandersetzung mit dem Westen. Sie sollte westdeutsche Fernsehbeiträge im Sinne der SED-Propaganda kommentieren und entlarven.
Wer war Karl-Eduard von Schnitzler?
Von Schnitzler war der „Chefpropagandist der DDR“ und Moderator des „Schwarzen Kanals“. Er war bekannt für seine polemische Art und seine unerschütterliche Treue zur SED-Politik.
Wie wurde der Westen in der Sendung als Feindbild dargestellt?
Der Westen wurde oft als militaristisch, revanchistisch und faschistisch porträtiert, wobei der DDR-Antifaschismus als moralische Argumentationsbasis diente.
Welche Rolle spielte Lenins Pressetheorie für den DDR-Journalismus?
Lenins Theorie definierte die Presse als kollektiven Organisator, Agitator und Propagandisten der Partei, was die Grundlage für die Medienkontrolle in der DDR bildete.
Wie kommentierte der „Schwarze Kanal“ den Bau der Berliner Mauer?
Im August 1961 rechtfertigte von Schnitzler den Mauerbau als notwendigen „antifaschistischen Schutzwall“ gegen die vermeintliche Aggression des Westens.
- Arbeit zitieren
- Michael von Scheidt (Autor:in), 2002, Der Westen als Feindbild in Karl-Eduard von Schnitzlers Propagandasendung "Der schwarze Kanal", München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/12160