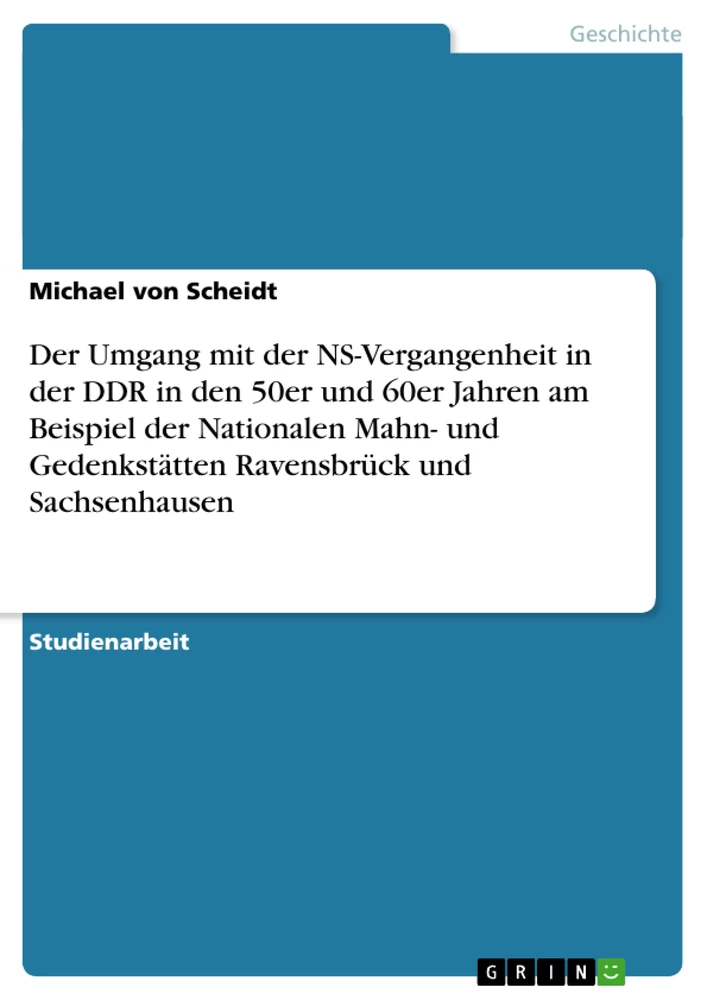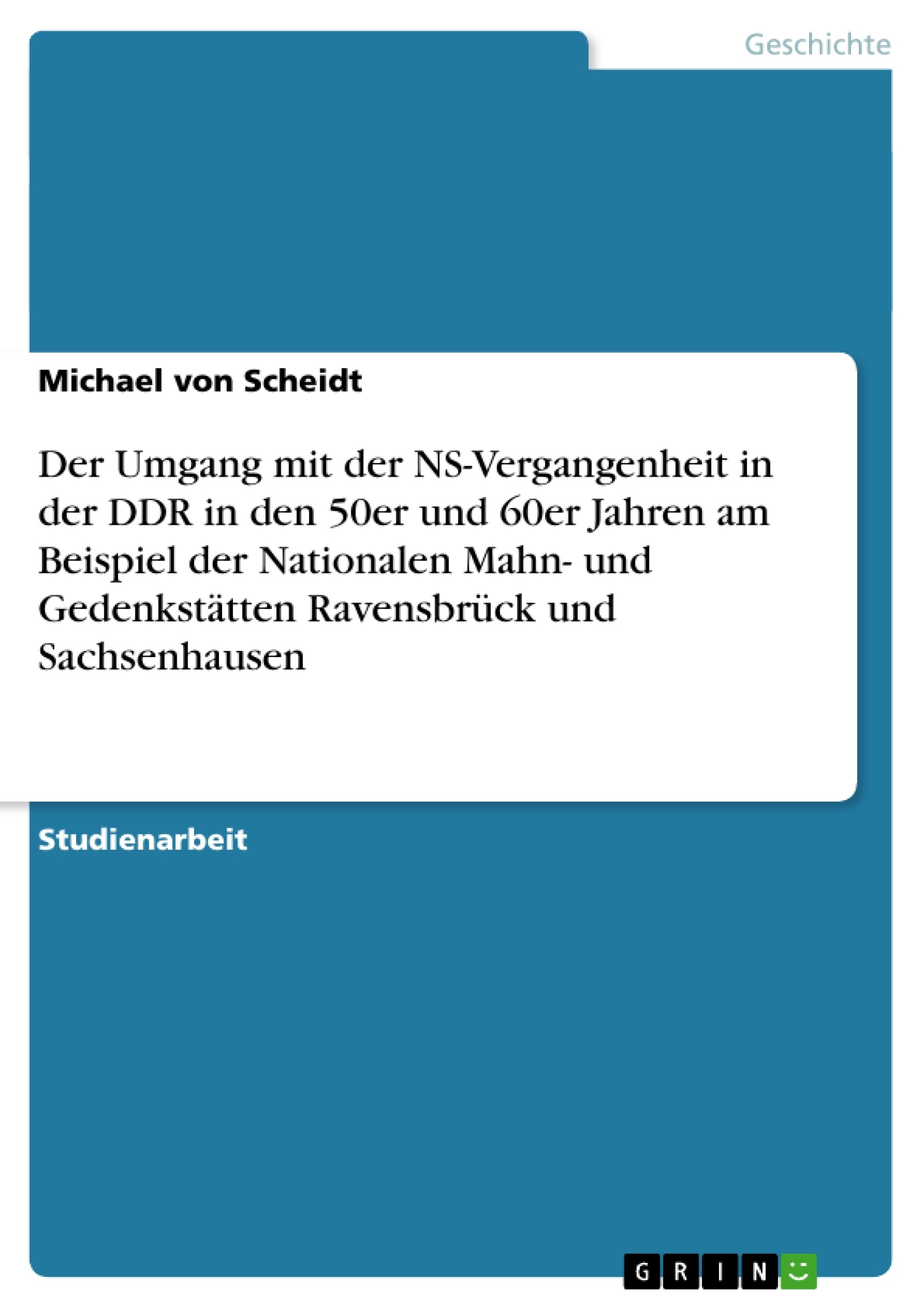Der unterschiedliche Umgang mit der nationalsozialistischen Vergangenheit in den beiden deutschen Staaten manifestiert sich nirgendwo deutlicher als in der Art der Gestaltung und Nutzung ehemaliger nationalsozialistischer Konzentrationslager als Mahn- und Gedenkstätten auf dem Gebiet der Bundesrepublik und der DDR. Während sich in der jungen BRD als Rechtsnachfolger des Dritten Reiches und unter der Belastung des Alleinvertretungsanspruches der Umgang mit der NS-Vergangenheit sehr schwierig gestaltete, wähnte man sich in der DDR geschichtspolitisch in einer sehr viel vorteilhafteren Lage: Die politische Führung des neu gegründeten Staates hatte größtenteils ihre Wurzeln in der kommunistischen Arbeiterbewegung und hatte sich daher während der nationalsozialistischen Herrschaft selbst zu großer Zahl als Widerstandskämpfer oder KZ-Häftlinge in der Opferrolle befunden. Nach der Befreiung durch die Rote Armee hatte man sich in der DDR zudem vom Kapitalismus befreit, der aus der kommunistischen, sozialökonomischen Sicht die Grundlage für das Entstehen einer faschistischen Herrschaftsform bildet. Mit der Zuspitzung des Kalten Krieges versuchte die Führung der DDR unter Berufung auf die Tradition des antifaschistischen Widerstandes, diesen nicht zu unterschätzenden Legitimationskredit im innerdeutschen Systemantagonismus in besonderer Weise hervorzuheben, und ihn sowohl zur Sicherung der SED-Diktatur im Innern als auch zur politischen Agitation gegenüber der BRD zu nutzen.
Auf welche Weise dies in den 50er und 60er Jahren die Erinnerungskultur der DDR beeinflusste, welche sich vornehmlich an den Gedächtnisorten der ehemaligen Konzentrationslager manifestierte, und in welchem Ausmaß die eigentliche Bestimmung dieser Orte als Erinnerungsstätten an die Opfer des nationalsozialistischen Terrors unter der Konfrontationsstellung der beiden Systeme litt, soll in der vorliegenden Arbeit exemplarisch am Beispiel der Nationalen Mahn- und Gedenkstätten Ravensbrück und Sachsenhausen ausgeführt werden. Dabei soll zunächst die Geschichte der beiden Orte als nationalsozialistische Konzentrationslager unter Berücksichtigung ihrer Besonderheiten innerhalb des KZ-Systems umrissen werden, bevor im folgenden Teil die Weiternutzung des Lagers in Sachsenhausen als sowjetisches Internierungslager thematisiert wird. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Ravensbrück und Sachsenhausen in der NS- und frühen Nachkriegszeit
- 2.1 Das Konzentrationslager Ravensbrück
- 2.2 Das Konzentrationslager Sachsenhausen
- 2.3 Das NKVD-Speziallager Nr. 7
- 3. Die Erinnerung an die NS-Vergangenheit in der DDR im Kontext der deutsch-deutschen Auseinandersetzungen der 50er und 60er Jahre
- 3.1 Die Instrumentalisierung des Antifaschismus-Begriffes
- 3.2 Die Entstehung der Nationalen Mahn- und Gedenkstätten und die Nationalisierung des Gedenkens
- 3.3 Die Selektivität des Gedenkens
- 4. Die Nationale Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück
- 4.1 Die Vorbereitungen und die Eröffnungsfeier
- 4.2 Die Gestaltung des Geländes
- 4.3 Die museale Gestaltung
- 5. Die Nationale Mahn- und Gedenkstätte Sachsenhausen
- 5.1 Die Vorbereitungen und die Eröffnungsfeier
- 5.2 Die Gestaltung des Geländes
- 5.3 Die museale Gestaltung
- 5.3.1 Das „Museum des antifaschistischen Freiheitskampfes der europäischen Völker“
- 5.3.2 Das Lagermuseum
- 5.3.3 Das „Museum des Widerstandes und der Leiden jüdischer Bürger“
- 6. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die unterschiedlichen Formen der Erinnerung an die NS-Vergangenheit in der DDR am Beispiel der Nationalen Mahn- und Gedenkstätten Ravensbrück und Sachsenhausen. Im Vordergrund steht dabei die Analyse der Nutzung dieser Orte zur Erinnerungskultur in der DDR im Kontext der deutsch-deutschen Auseinandersetzungen der 50er und 60er Jahre.
- Die Instrumentalisierung des Antifaschismus-Begriffes durch die DDR-Führung
- Die Entstehung der Nationalen Mahn- und Gedenkstätten und die Nationalisierung des Gedenkens in der DDR
- Die Selektivität des Gedenkens und die Herausforderungen der Erinnerungskultur an den NS-Terror
- Die Gestaltung und Nutzung der ehemaligen Konzentrationslager als Erinnerungsstätten in der DDR
- Die spezifischen Herausforderungen der Erinnerung an die NS-Vergangenheit im Kontext des Kalten Krieges
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet den unterschiedlichen Umgang mit der NS-Vergangenheit in der BRD und der DDR und stellt die zentrale These der Arbeit vor: Die Erinnerungskultur der DDR, die sich an den ehemaligen Konzentrationslagern manifestierte, wurde stark von der Konfrontationsstellung der beiden Systeme beeinflusst.
Kapitel 2 gibt einen Überblick über die Geschichte der Konzentrationslager Ravensbrück und Sachsenhausen in der NS-Zeit und beschreibt die spezifischen Besonderheiten dieser Orte. Anschließend wird die Nutzung des Lagers in Sachsenhausen als sowjetisches Internierungslager thematisiert.
Kapitel 3 beleuchtet die Erinnerungskultur der DDR im Kontext der deutsch-deutschen Auseinandersetzungen der 50er und 60er Jahre. Der Antifaschismus-Begriff wurde von der SED instrumentalisiert, um die eigene Legitimität zu stärken und die BRD zu delegitimieren. Die Entstehung der Nationalen Mahn- und Gedenkstätten steht dabei im Mittelpunkt.
Kapitel 4 und 5 widmen sich der Analyse der Gestaltung und Nutzung der Nationalen Mahn- und Gedenkstätten Ravensbrück und Sachsenhausen in der DDR. Die Vorbereitungen und Eröffnungsfeiern, die Gestaltung des Geländes und die museale Präsentation werden detailliert untersucht.
Schlüsselwörter
NS-Vergangenheit, Erinnerungskultur, DDR, Antifaschismus, Nationale Mahn- und Gedenkstätten, Ravensbrück, Sachsenhausen, Kalter Krieg, deutsch-deutsche Auseinandersetzungen, Instrumentalisierung, Selektivität, museale Gestaltung, Gestaltung des Geländes.
- Arbeit zitieren
- Michael von Scheidt (Autor:in), 2001, Der Umgang mit der NS-Vergangenheit in der DDR in den 50er und 60er Jahren am Beispiel der Nationalen Mahn- und Gedenkstätten Ravensbrück und Sachsenhausen, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/12159