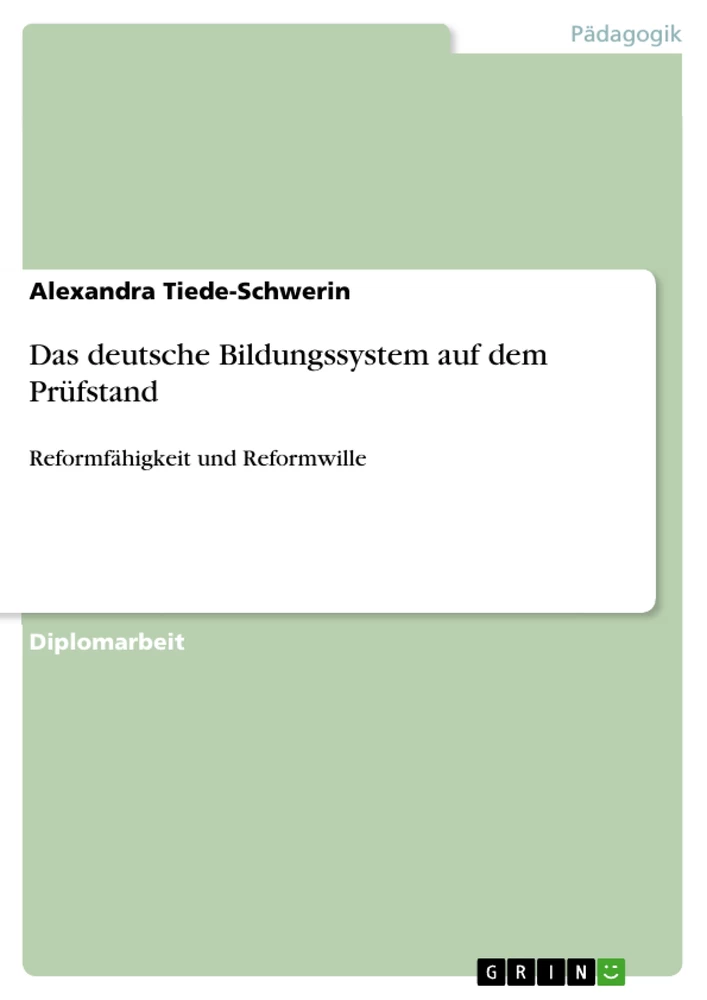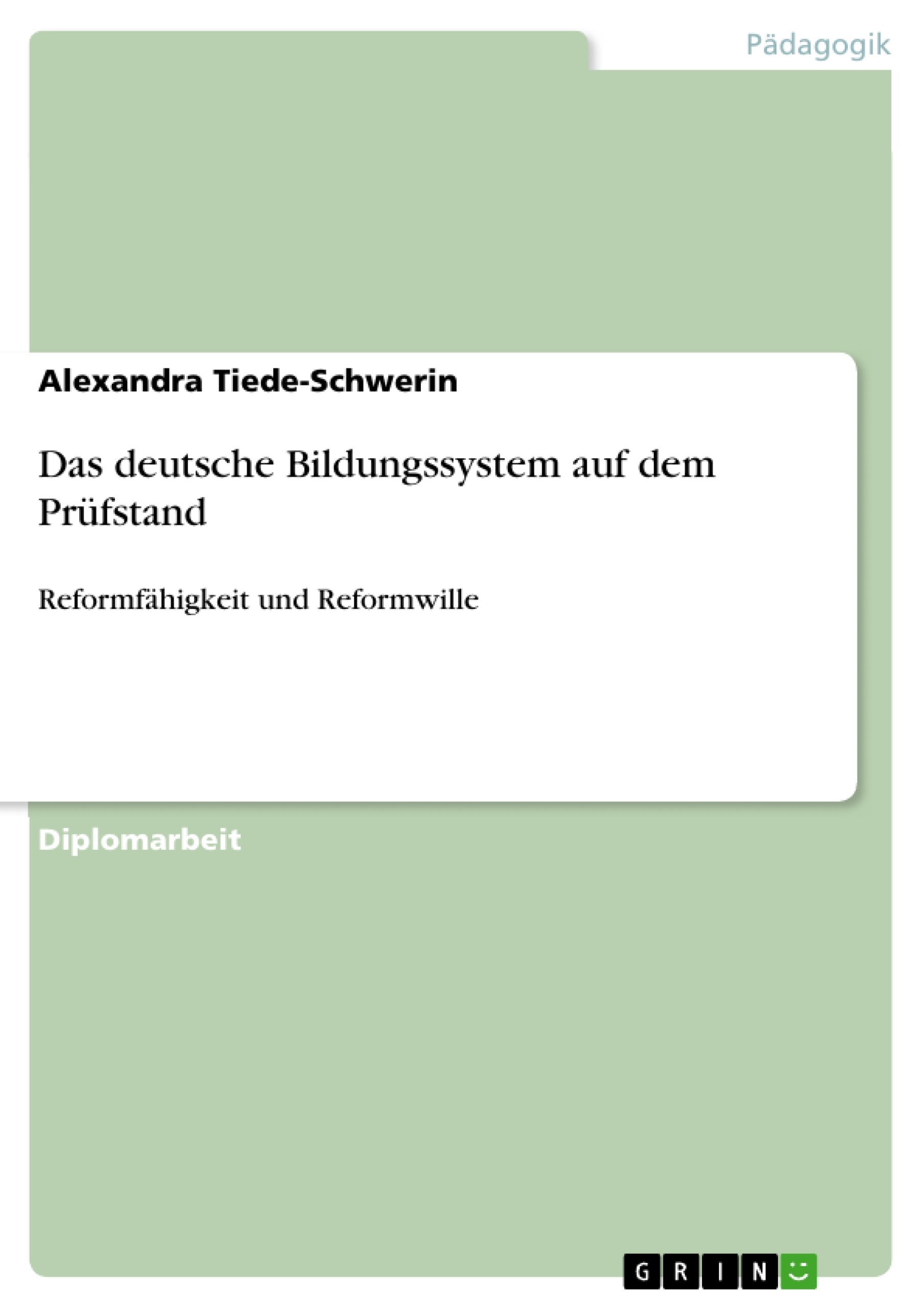In der nachfolgenden Arbeit werden die vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Veränderungen in eine Wissensgesellschaft und den veränderten Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt in Richtung Dienstleistungsgesellschaft und Globalisierung die Schwachstellen des deutschen Schulbildungssystems genannt. Im folgenden soll herausgefunden werden, welche neuen Andorderungen an die Institution Schule gestellt werden und welche möglichen Reformmaßnahmen zur Verfügung stehen, um vielleicht die eine herauszufiltern. Dabei werden nicht nur die Reformfähigkeit, sondern insbesondere die Reformwilligkeit der entscheidenden Organe und der Bevölkerung an sich diskutiert. Es ist vordergründig nicht davon auszugehen, ein Patentrezept für die Reform der deutschen Schule zu finden, sofern dieses überhaupt gesucht wird, sondern vor allem Möglichkeiten vorzustellen, welche schließlich durch Zusammenstellen genutzt oder zumindest getestet werden können.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- 1. Die Wissensgesellschaft
- 1.1 Über das Wissen
- 1.2 Erschließung von Wissen
- 1.3 Strukturwandel in der Wissensgesellschaft
- 1.4 Soziale Ungleichheit in der Wissensgesellschaft
- 1.5 Bildung in der Wissensgesellschaft
- 2. Die Bildungsexpansion- Ein Rückblick auf die 60er und 70er Jahre
- 2.1 Nach dem Zweiten Weltkrieg
- 2.2 Die 60er
- 2.3 Die Bildungsreform
- 2.3.1 Resumé und Auswirkungen
- 3. Die Schule heute im Bildungssystem
- 3.1 Allgemeine Bildung der Gesellschaft
- 3.2 Die Erwartungen der Gesellschaft an die Schule
- 3.3 Die Aufgaben der Schule
- 3.4 Werte in der Schule
- 3.5 Schule bestimmt durch staatlichen Einfluss
- 3.6 Soziale Disparitäten in und durch Schule
- 3.7 Zusammenfassung in vier Punkten
- 3.7.1 Ausgangspunkt Recht
- 3.7.2 Ausgangspunkt Schüler
- 3.7.3 Ausgangspunkt Lehrer
- 3.7.4 Ausgangspunkt Schule
- 4. Die PISA- Studie
- 4.1 Inhalt und Ziele
- 4.2 Ergebnisse der PISA- Studie
- 4.2.1 Die soziale Herkunft
- 4.2.2 Anspruch oder Begabungsglaube?
- 4.3 Kritik an PISA
- 5. Das Problem von Dreigliedrigkeit und Selektivität
- 5.1 Schuld bei der Halbtagsschule?
- 5.2 Die Lehrer im Bildungssystem
- 5.3 Beispiel Ganztagsschule Frankreich
- 5.4 Das finnische Bildungswesen
- 6. Das Problem von Bildungszertifikaten
- 6.1 Das Abitur auf dem Prüfstand
- 6.2 Andere Leistungsanforderungen
- 7. Exkurs Elitenbildung
- 8. Der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg
- 8.1 Die Rolle der Familie
- 8.1.1 Familie im Rechtsrahmen
- 8.1.2 Der Erziehungsauftrag der Eltern
- 8.2 Schichtenzugehörigkeit und veränderter Lebensstil
- 8.2.1 Armut in der Familie
- 8.2.2 Familien mit Migrationshintergrund
- 8.3 Der Zusammenhang
- 8.3.1 Folge: Bildungsarmut
- 8.4 Exkurs Pierre Bordieu
- 8.4.1 Das kulturelle Kapital
- 8.4.2 Der Habitus
- 8.4.2.1 Das Habituskonzept und Bildung
- 8.4.3 Kritik
- 8.5 Die Frage nach Chancengleichheit
- 8.1 Die Rolle der Familie
- 9. Der Einfluss der Ausgaben auf die Bildung
- 9.1 Bildungsausgaben
- 9.2 Die Verwendung der Bildungsfinanzierung
- 9.3 Private und Öffentliche Bildungsfinanzierung
- 9.4 Reformvorschläge
- 10. Qualifikationsbedarf und Marktanspruch
- 10.1 Der deutsche Arbeitsmarkt
- 10.2 Qualifikation und Arbeitsmarkt
- 10.3 Qualifikationsbedarf und Marktanspruch
- 10.3.1 Zeiten des Wandels
- 10.3.2 Bildung und Wissen im Zeichen des Wandels
- 10.3.3 Schlüsselqualifikationen und neue Notwendigkeiten
- 11. Reformvorschläge
- 11.1 Zusammenfassung Kritik
- 11.2 Allgemeine notwendige Veränderungen
- 11.3 Der Ausbau der Ganztagsschule
- 11.4 Einführung Gesamtschule
- 11.5 Offener Unterricht
- 11.6 Autonomie der Schule
- 11.6.1 Schule im Zeichen des Föderalismus
- 11.7 Die Anforderungen der Gesellschaft
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit analysiert die Reformfähigkeit und den Reformwillen des deutschen Bildungssystems. Sie untersucht kritisch die Herausforderungen und Problemfelder des Systems im Kontext der Wissensgesellschaft und im Lichte der PISA-Studie.
- Analyse der sozialen Ungleichheit im deutschen Bildungssystem
- Bewertung der Auswirkungen der Bildungsexpansion der 60er und 70er Jahre
- Diskussion der Ergebnisse und Kritikpunkte der PISA-Studie
- Untersuchung des Zusammenhangs zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg
- Bewertung verschiedener Reformvorschläge für das deutsche Bildungssystem
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einführung thematisiert die kontroversen Reaktionen auf die PISA-Studie. Kapitel 1 beleuchtet den Einfluss der Wissensgesellschaft auf das Bildungssystem. Kapitel 2 bietet einen historischen Rückblick auf die Bildungsexpansion. Kapitel 3 beschreibt den aktuellen Zustand der Schule in Deutschland, Kapitel 4 analysiert die PISA-Studie, einschließlich ihrer Ergebnisse und Kritik. Kapitel 5 diskutiert die Probleme der Dreigliedrigkeit und Selektivität im deutschen Schulsystem. Kapitel 6 befasst sich mit der Bedeutung von Bildungszertifikaten. Kapitel 7 bietet einen Exkurs zur Elitenbildung. Kapitel 8 untersucht den Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg, inklusive der Rolle der Familie und der Theorien von Pierre Bourdieu. Kapitel 9 analysiert den Einfluss der Bildungsausgaben auf den Bildungserfolg. Kapitel 10 beleuchtet den Qualifikationsbedarf und dessen Bezug zum Arbeitsmarkt.
Schlüsselwörter
Deutsches Bildungssystem, Wissensgesellschaft, PISA-Studie, Soziale Ungleichheit, Bildungsexpansion, Schulreform, Dreigliedrigkeit, Selektivität, Soziale Herkunft, Bildungserfolg, Chancengleichheit, Reformfähigkeit, Reformwille, Pierre Bourdieu, Habitus, Kulturelles Kapital, Bildungsausgaben, Qualifikationsbedarf, Arbeitsmarkt.
- Quote paper
- Diplom-Politologin Alexandra Tiede-Schwerin (Author), 2004, Das deutsche Bildungssystem auf dem Prüfstand, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/120918