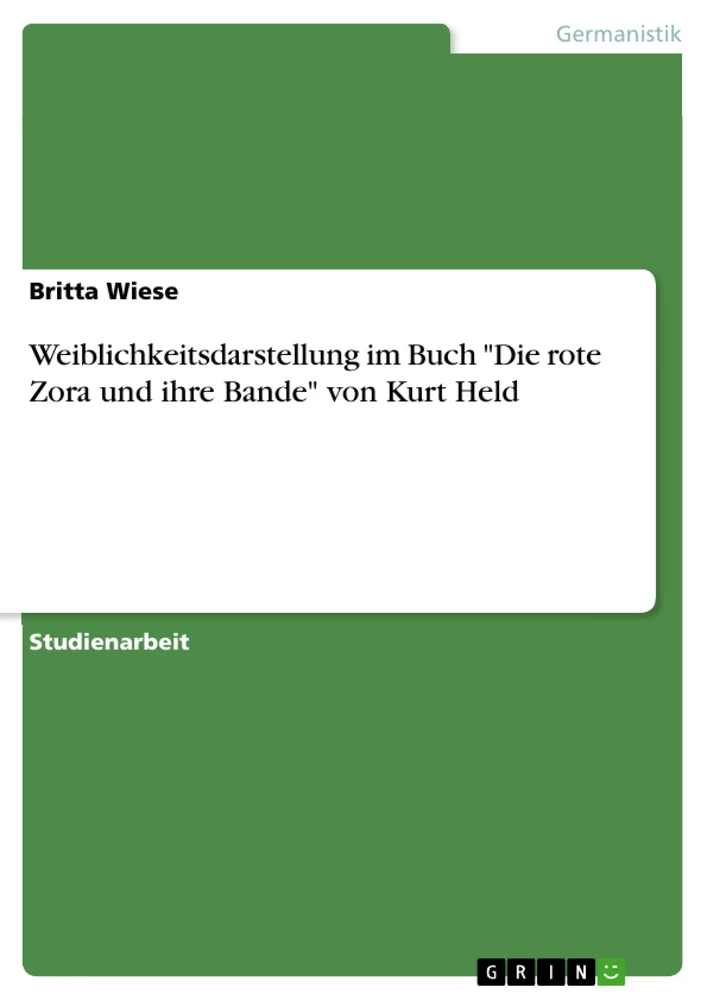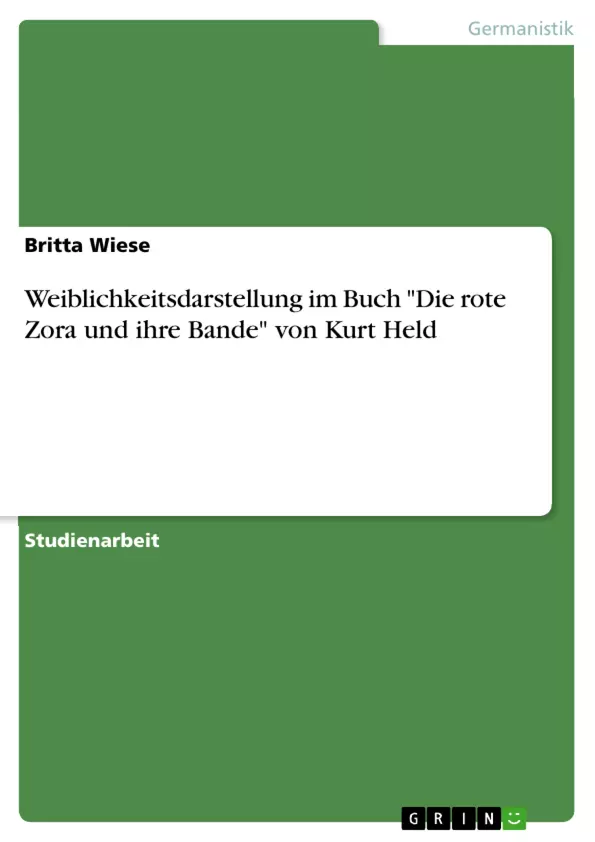Wie wird Weiblichkeit in „Die rote Zora und ihre Bande“ aus dem Jahr 1941 dargestellt? Für diese Analyse wird im Voraus auf das Konstrukt Geschlecht eingegangen und darauf, welche kulturellen Stereotype dem weiblichen Geschlecht zugesprochen werden. Nach einem kurzen Einblick in die Handlung und zentralen Themen des Romans folgt die Analyse der Erzählweise. Generell folgt die Arbeit dem Konzept der Analysekriterien von Genderkonzepten von Hans Krah, sodass erst auf das Gender-Setting und dann in einer ausführlichen Analyse auf die Gender-Träger eingegangen wird. In dieser Analyse werden die Aktionen, Diskurse, Rhetorik und Zeichen von Gender mitberücksichtigt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition: Geschlecht und Weiblichkeit
- Analyse Die rote Zora und ihre Bande
- Inhalt
- Wie wird erzählt?
- Gender-Setting
- Gender-Träger
- Figurengruppen und -konstellationen
- Bande der roten Zora
- Arbeiterschicht
- Soziale Oberschicht
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Darstellung von Weiblichkeit in Kurt Helds Roman „Die rote Zora und ihre Bande“ (1941) im Kontext der Kinder- und Jugendliteratur nach 1945. Dabei wird untersucht, ob und wie Helds Werk von den traditionellen Geschlechterrollen abweicht und welche unkonventionellen Muster der Geschlechterrollenorientierung es aufzeigt.
- Konstruktion von Geschlechterrollen in der Kinder- und Jugendliteratur
- Analyse der Weiblichkeitsdarstellung in "Die rote Zora und ihre Bande"
- Untersuchung des Gender-Settings und der Gender-Träger im Roman
- Bedeutung des Romans für die Entwicklung von Geschlechterrollenbildern
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und den theoretischen Rahmen der Arbeit vor. In Kapitel 2 wird der Begriff „Geschlecht“ definiert und die kulturellen Stereotype, die dem weiblichen Geschlecht zugeschrieben werden, beleuchtet. Anschließend folgt in Kapitel 3 eine Analyse des Romans „Die rote Zora und ihre Bande“. Hierbei werden die Handlung, die Erzählweise, das Gender-Setting und die Gender-Träger des Romans untersucht. Die Analyse bezieht sich auf die Aktionen, Diskurse, Rhetorik und Zeichen von Gender, um die Weiblichkeitsdarstellung in der Figur der roten Zora und ihren weiblichen Bandenmitgliedern zu verstehen.
Schlüsselwörter
Weiblichkeit, Gender, Geschlechterrollen, Kinder- und Jugendliteratur, "Die rote Zora und ihre Bande", Kurt Held, Analyse, Gender-Setting, Gender-Träger, Stereotypen, Geschlechterforschung, Narratologie, Sex, Sexuality.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird Weiblichkeit in „Die rote Zora und ihre Bande“ dargestellt?
Die rote Zora wird als starke, unabhängige und rebellische Anführerin dargestellt, die sich über traditionelle kulturelle Stereotype und Geschlechterrollen ihrer Zeit hinwegsetzt.
Bricht der Roman mit traditionellen Geschlechterrollen?
Ja, Kurt Held zeigt unkonventionelle Muster der Geschlechterrollenorientierung auf, indem er Mädchen Eigenschaften wie Mut, Durchsetzungsvermögen und physische Stärke zuschreibt, die 1941 untypisch für die Kinderliteratur waren.
Was ist das „Gender-Setting“ in diesem Roman?
Das Gender-Setting umfasst den sozialen und kulturellen Rahmen, in dem die Figuren agieren. In der Arbeit wird analysiert, wie die Umgebung der Arbeiterschicht und der Oberschicht die Geschlechterkonstruktionen beeinflusst.
Wer sind die „Gender-Träger“ in der Analyse?
Als Gender-Träger werden die verschiedenen Figurengruppen untersucht, insbesondere die Bande der roten Zora, um zu zeigen, wie Handlungen, Rhetorik und Zeichen Geschlecht konstruieren.
Welche Bedeutung hat das Buch für die Literatur nach 1945?
Obwohl 1941 erschienen, gilt es als Wegbereiter für modernere Rollenbilder in der Kinder- und Jugendliteratur und beeinflusste die Darstellung von Mädchenfiguren nachhaltig.
- Quote paper
- Britta Wiese (Author), 2020, Weiblichkeitsdarstellung im Buch "Die rote Zora und ihre Bande" von Kurt Held, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1196420