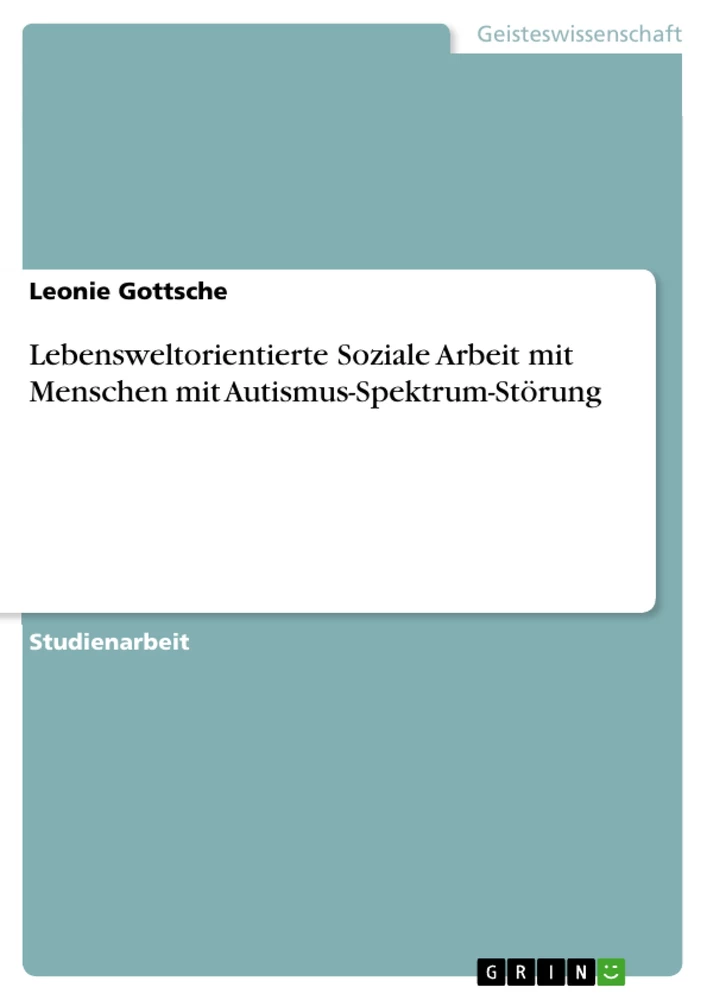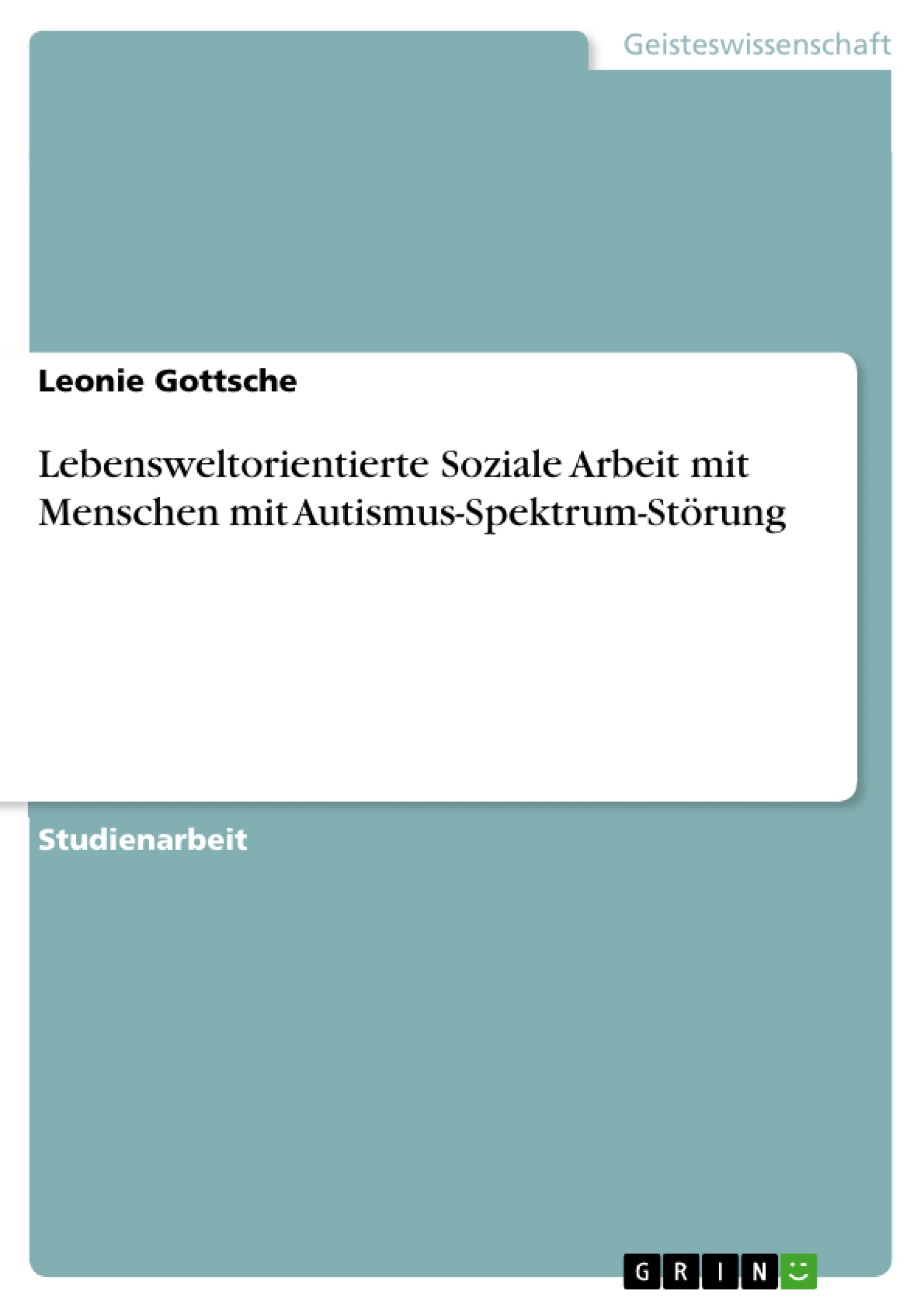Diese Arbeit befasst sich mit dem Störungsbild von Autismus-Spektrum-Störungen und dem Konzept der lebensweltorientierten Sozialen Arbeit. Dem Leser soll ein umfassender Überblick über die Krankheit, die Historie, die Diagnostik und die Symptomatik gegeben werden. Anschließend wird das Konzept der Lebensweltorientierung nach Hans Thiersch erläutert. Neben den Begriffen „Alltag“ und „Lebenswelt“ werden die Dimensionen so wie die Strukturmaxime dieses Ansatzes dargelegt. Schließlich wird das Konzept der lebensweltorientierten Sozialen Arbeit auf das Störungsbild von Autismus-Spektrum-Störungen angewandt. Es werden die Besonderheiten in der Wahrnehmung bezogen auf erlebte Zeit, erlebter Raum und soziale Bezüge der Betroffenen herausgearbeitet und Folgen für Organisationen, welche mit autistischen Menschen arbeiten, beleuchtet. Im Fazit wird die Leitfrage beantwortet und es werden Prämissen für eine vollständige Integration von Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen aufgestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Hinführung
- Autismus - Spektrum - Störungen
- Historie des Störungsbildes Autismus
- Diagnostik von Autismus-Spektrum-Störungen
- Symptomatik von Autismus-Spektrum-Störungen
- Lebensweltorientierte Soziale Arbeit
- Lebenswelt und Alltag
- Dimensionen Lebensweltorientierter Sozialer Arbeit
- Strukturmaxime Lebensweltorientierter Sozialer Arbeit
- Lebensweltorientierte Soziale Arbeit mit Menschen mit Autismus
- Zeit, Raum und soziale Bezüge im Erleben von Menschen mit Autismus
- Folgen für Organisationen für Menschen mit Autismus
- Partizipation von Menschen mit Autismus
- Dezentralisierung, Regionalisierung und Netzwerk für Menschen mit Autismus
- Inklusion und Integration von Menschen mit Autismus
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit dem Störungsbild von Autismus-Spektrum-Störungen und dem Konzept der Lebensweltorientierten Sozialen Arbeit. Sie zielt darauf ab, einen umfassenden Überblick über die Krankheit, ihre Geschichte, Diagnostik und Symptomatik zu liefern. Anschließend wird das Konzept der Lebensweltorientierung nach Hans Thiersch erläutert, einschließlich der zentralen Begriffe „Alltag“ und „Lebenswelt“, sowie der Dimensionen und Strukturmaxime dieses Ansatzes. Abschließend wird das Konzept der Lebensweltorientierten Sozialen Arbeit auf das Störungsbild von Autismus-Spektrum-Störungen angewandt.
- Das Störungsbild von Autismus-Spektrum-Störungen
- Das Konzept der Lebensweltorientierten Sozialen Arbeit
- Die Anwendung des Konzepts auf Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen
- Die Besonderheiten der Wahrnehmung bei Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen
- Die Folgen für Organisationen, die mit autistischen Menschen arbeiten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Hausarbeit beginnt mit einer Einführung in das Thema Autismus-Spektrum-Störungen. Sie beleuchtet die historische Entwicklung des Störungsbildes, beschreibt die Diagnostik und Symptomatik von Autismus-Spektrum-Störungen. Anschließend wird das Konzept der Lebensweltorientierten Sozialen Arbeit nach Hans Thiersch vorgestellt. Die Arbeit erläutert die Dimensionen und Strukturmaxime dieses Ansatzes und zeigt, wie er sich auf die Arbeit mit Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen anwenden lässt. Schließlich werden die Besonderheiten der Wahrnehmung von Zeit, Raum und sozialen Beziehungen bei Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen herausgearbeitet und die daraus resultierenden Folgen für Organisationen, die mit autistischen Menschen arbeiten, beleuchtet.
Schlüsselwörter
Autismus-Spektrum-Störungen, Lebensweltorientierung, Soziale Arbeit, Inklusion, Integration, Partizipation, Wahrnehmung, Zeit, Raum, soziale Beziehungen, Organisationen, Menschen mit Behinderung.
- Quote paper
- Leonie Gottsche (Author), 2021, Lebensweltorientierte Soziale Arbeit mit Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1192754