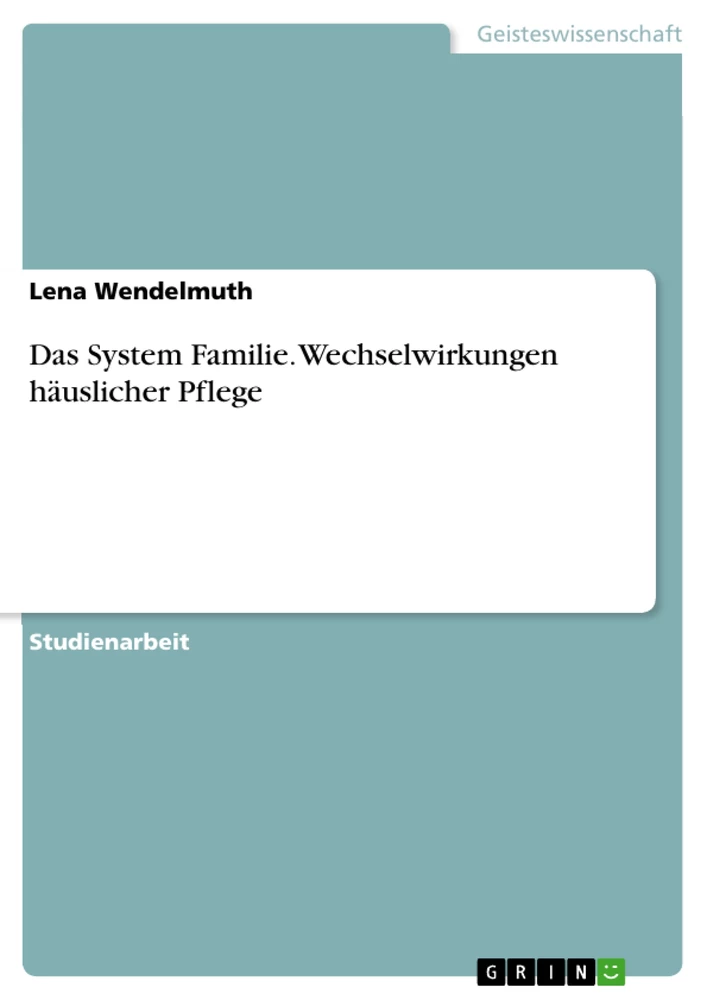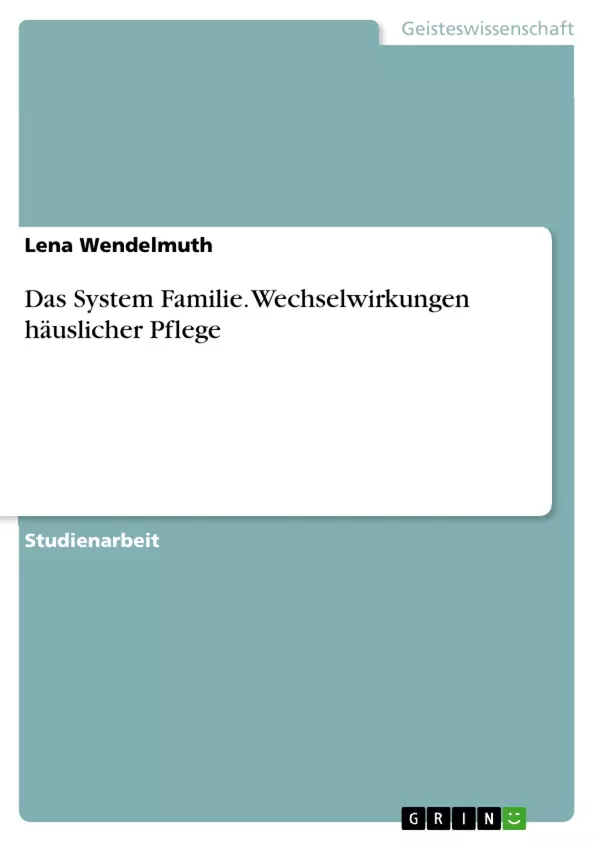Pflege heißt, den Alltag für den Pflegebedürftigen organisieren und zwar unter erschwerten Bedingungen. Dieser Alltag besteh nicht nur aus der Grundpflege, sondern aus allen Daseinstechniken, die man zur Haushaltsführung benötigt. Dies betrifft in den meisten Fällen nicht nur den zu Pflegenden, sondern auch die Personen, welche ihre Angehörigen im häuslichen Umfeld pflegen (im Folgenden Pflegende genannt), sondern häufig das ganze System Familie. Denn mit dem Eintritt von Pflegebedarf gehen oft Veränderungen im sozialen und ökologischen Umfeld einher.
Sowohl Pflegende als auch die Pflegebedürftigen haben sozial-ökologische Übergänge zu bewältigen, etwa einen Umzug oder Veränderung des Lebensrhythmus. Hierbei gilt zu erwähnen, dass viele Pflegeentscheidungen aufgrund von positiven Austauschverfahren getroffen werden mit dem Hinblick auf ein bestehendes vertrauensvolles Verhältnis. Austauschtheoretische Überlegungen, beschreiben dieses Verhältnis als ein gegenseitiges Geben und Nehmen nach bestimmten Regeln. Hierbei ergreifen pflegende Angehörige die Chance ihren nun pflegebedürftigen Angehörigen etwas zurückzugeben, sich dafür zu revanchieren, was in früheren Jahren für sie geleistet wurde, in diesem Fall handelt es sich zum Beispiel um unterstützende Leistungen bei der Beaufsichtigung der Enkel, Hilfe bei der Haushaltsführung oder Hilfe in Form von finanzieller Unterstützung.
Im Folgendem soll sich mit der Frage beschäftigt werden, wie sich die Pflege eines Angehörigen im häuslichen Umfeld auf die Struktur Familie auswirkt. Dabei soll verdeutlicht werden, was pflegende Angehörige leisten und warum sie der Schlüssel zu einer guten professionellen Pflege sind. Schwerpunkt liegt dabei jedoch auf dem systemischen Ansatz zur Struktur Familie, da dieser Ansatz Wechselwirkungen auf verschiedenen Ebenen verdeutlicht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- System-Ebenenmodell
- Mikro-Ebene
- Meso-Ebene
- Exo-Ebene
- Makro-Ebene
- Balanceakt: Grenzregulierung und die Bedeutung für die Gestaltung der häuslichen Pflege
- Sorgearbeit
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen von Pflege eines Angehörigen im häuslichen Umfeld auf die Struktur Familie. Die Arbeit beleuchtet die Leistungen pflegender Angehöriger und deren Schlüsselrolle für eine gute professionelle Pflege. Der Fokus liegt dabei auf dem systemischen Ansatz zur Struktur Familie, der die Wechselwirkungen auf verschiedenen Ebenen verdeutlicht.
- Systemischer Ansatz zur Familienstruktur
- Wechselwirkungen auf verschiedenen Ebenen
- Bedeutung von pflegenden Angehörigen
- Einfluss von Pflege auf das Familiensystem
- Austauschtheoretische Perspektiven auf Pflegebeziehungen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung stellt das Thema der häuslichen Pflege und deren Auswirkungen auf die Familie vor. Es werden die besonderen Herausforderungen für Pflegende und Pflegebedürftige sowie die Bedeutung von Austauschbeziehungen in diesem Kontext beleuchtet.
- System-Ebenenmodell: Dieses Kapitel erläutert das System-Ebenenmodell nach Bertalanffy und beschreibt seine Anwendung auf die Familienstruktur. Es werden die verschiedenen Ebenen (Mikro, Meso, Exo, Makro) vorgestellt und deren Bedeutung für das Verständnis von Pflegeprozessen im familiären Kontext dargestellt.
Schlüsselwörter
Systemische Familientherapie, häusliche Pflege, Angehörigenpflege, Wechselwirkungen, Ebenenmodell, Austauschbeziehungen, Sorgearbeit, Interdependenz, Grenzregulierung.
- Arbeit zitieren
- Lena Wendelmuth (Autor:in), 2018, Das System Familie. Wechselwirkungen häuslicher Pflege, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1192530