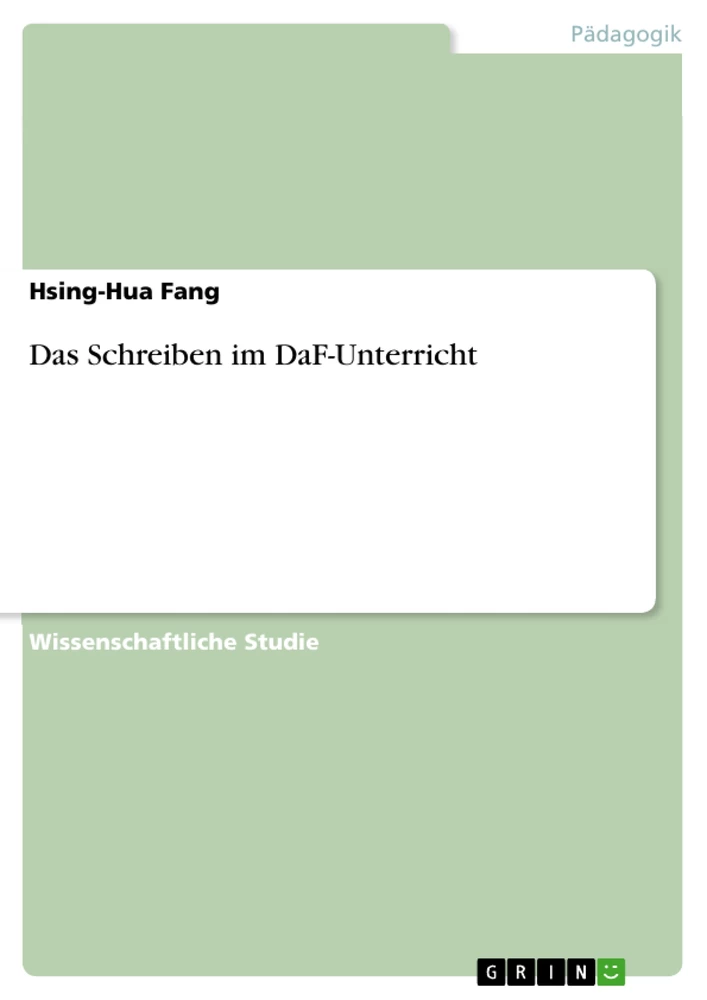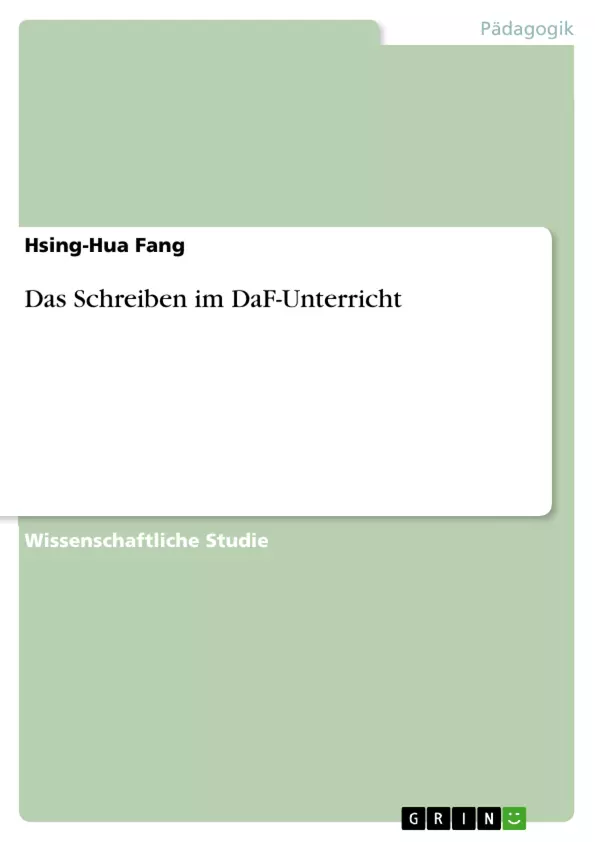Wozu lernt man heute noch das Schreiben im Fremdsprachunterricht? Wie kann man die Schreibkompetenz fördern? Der Autor gibt einen kurzen Überblick über die Theorien und Modelle der Schreibdidaktik.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Schreiben als Sprachtätigkeit
- Schriftsprache vs. Sprechsprache
- Wechselbeziehungen zwischen den sprachlichen Haupttätigkeiten
- Schreibdidaktik
- Die Ansätze
- Phasen des Schreibprozesses
- Interaktives Schreiben
- Fehler und Fehlerkorrektur
- Typen der Schreibübungen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Text befasst sich mit dem Schreiben im Deutsch als Fremdsprache (DaF)-Unterricht. Er untersucht die Bedeutung des Schreibens als Sprachtätigkeit und beleuchtet verschiedene Aspekte der Schreibdidaktik. Der Text analysiert die Beziehung zwischen Schriftsprache und Sprechsprache, untersucht die Phasen des Schreibprozesses und die Rolle des interaktiven Schreibens im Unterricht. Darüber hinaus werden Fehler und Fehlerkorrektur sowie verschiedene Typen von Schreibübungen im DaF-Unterricht betrachtet.
- Schreiben als Sprachtätigkeit
- Schreibdidaktik im DaF-Unterricht
- Phasen des Schreibprozesses
- Interaktives Schreiben
- Fehler und Fehlerkorrektur
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt das Schreiben als eine existenzielle Lebenshaltung dar. Sie betont die Bedeutung des Schreibens als Mittel, um die Welt als Sprache zu erfahren und in Sprache zu transponieren. Es wird hervorgehoben, dass das Schreiben nicht nur ein Mittel der Kommunikation ist, sondern auch eine Möglichkeit zur Selbstfindung und zur Entwicklung von Bewusstsein.
Schreiben als Sprachtätigkeit
Dieser Abschnitt befasst sich mit den Unterschieden zwischen Schriftsprache und Sprechsprache. Es wird erläutert, dass die Schriftsprache eine abstraktere Form der Sprache ist, die weniger situationsabhängig ist und Raum und Zeit überwindet. Die Unterschiede zwischen den beiden Sprachformen werden im Kontext der Entwicklung von Sprachbewusstsein und der spezifischen Anforderungen der schriftlichen Kommunikation untersucht.
Schreibdidaktik
Dieser Abschnitt befasst sich mit den Ansätzen und Phasen des Schreibprozesses im DaF-Unterricht. Die Bedeutung des interaktiven Schreibens, die Rolle von Fehlern und Fehlerkorrektur sowie verschiedene Typen von Schreibübungen werden diskutiert.
Schlüsselwörter
Schreiben, Sprachtätigkeit, Schriftsprache, Sprechsprache, Schreibdidaktik, DaF-Unterricht, Interaktives Schreiben, Fehlerkorrektur, Schreibübungen, Sprachbewusstsein.
- Quote paper
- Hsing-Hua Fang (Author), 2022, Das Schreiben im DaF-Unterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1190274