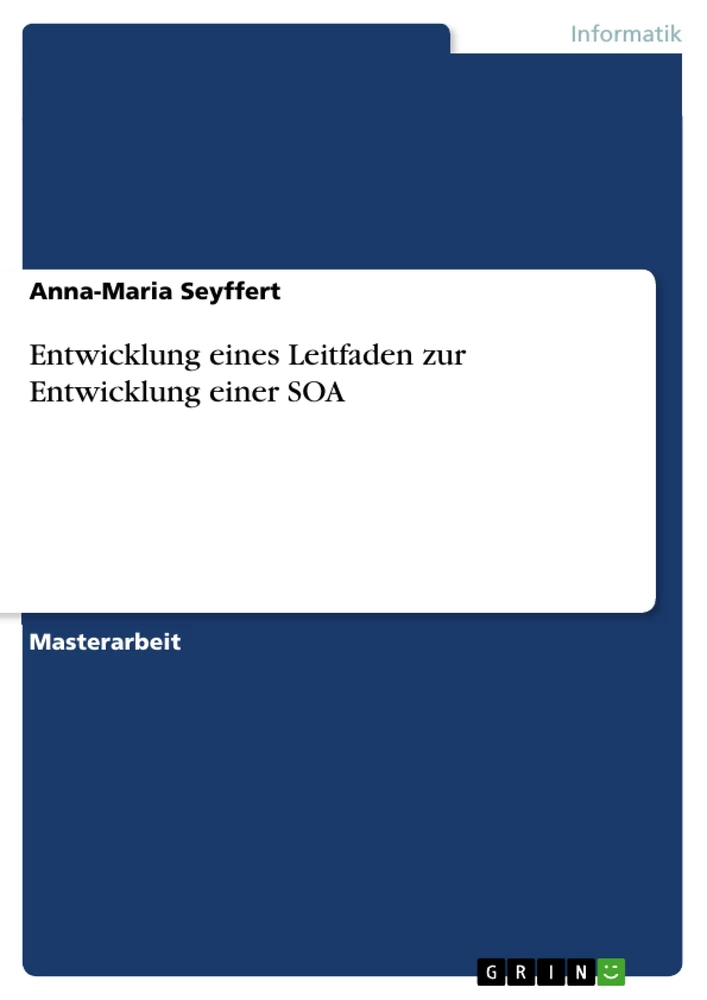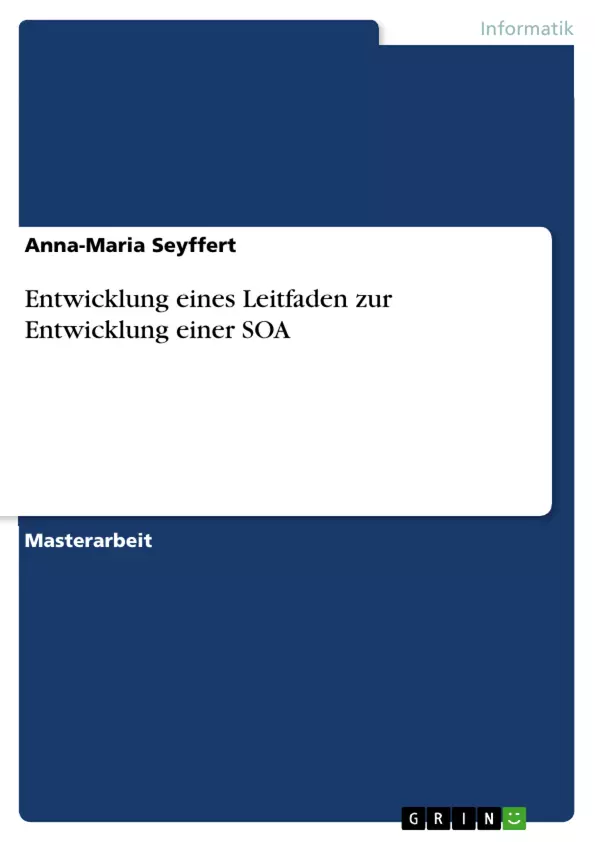Seit Ende der 80er Jahre verfügen Unternehmen zunehmend über ein heterogenes und dezentralisiertes IT-Umfeld, dessen Vorteile wie Schnelligkeit und Ausfallsicherheit bezüglich der Prozessverarbeitung aber auch neuen Problemstellungen wie redundanter Datenhaltung, Datensynchronisation und Prozessintegration gegenüber standen. In der Softwareentwicklung spiegelte sich dies in neuen Abstraktionen wie Sockets, Remote Procedure/Function Calls (RPC/RFC) und CORBA zur Verteilung einer Anwendung auf heterogener
IT-Umgebung wider. Es entstand eine Vielzahl von Schnittstellen, die einen hohen Realisierungs- und Wartungsaufwand erforderten.
Anstatt weiterhin aufwendige Punkt-zu-Punkt-Lösungen zu entwickeln, ging der Trend zu MOM (Message Oriented Middleware), bei der Daten in Pakete gepackt und als Nachrichten an eine Middleware übergeben werden.
Um generische Aufgaben in einer MOM zentral zu realisieren, wurden Message Broker zur Verwaltung und zum Versand von Nachrichten eingesetzt, wodurch die Anbindung eines gegebenen Systems durch die einmalige Anbindung an einen solchen Präsentationshub durch einen Adapter gelöst werden konnte.
Der Datenaustausch zwischen Unternehmen wurde auf Basis von VANs (Value Added Network) implementiert, mit anderen Worten, jedes Unternehmen musste ein Gateway (das der Spezifikation des VAN entsprach) implementieren. Es bildeten sich branchen- und länderspezifische Standards wie EDI (Electronic Data Interface) oder auf UN-Ebene EDIFACT heraus. Mit Einzug der Internettechnologie in die Unternehmenswelt entstanden vielversprechende Möglichkeiten zur Entwicklung generischer Plattformen und Produkte (wie J2EE oder DCOM/.NET), die den Datenaustausch über die TCP/IP Infrastruktur des Internets abzuwickeln vermochten.
Auch heute noch sind serviceorientierte Architekturen im Zusammenhang mit Web-Services sowohl in der Managerwelt als auch in der IT-Welt ein ausgesprochenes Hype-Thema, was unter anderem auch an der Unschärfe des Begriffs „SOA“ liegen dürfte.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 2. ABGRENZUNG ENTERPRISE APPLICATION INTEGRATION
- 2.1 EAI Integrationsarten
- 2.2 EAI Architekturen
- 2.2.1 Point-to-Point
- 2.2.2 Hub & Spoke
- 2.2.3 Bus-oriented
- 2.2.4 Distributed Objects
- 2.3 Technologien einer EAI
- 2.3.1 J2EE mit RMI
- 2.3.2 CORBA
- 2.3.3 Web-Services
- 2.3.4 Microsoft .NET / DCOM
- 2.4 Kommunikation innerhalb verteilter Anwendungen
- 3. VERTIEFUNG SOA MIT WEB-SERVICES
- 3.1 Serviceorientierte Architektur
- 3.1.1 Begriffsklärung und Definitionen SOA
- 3.1.2 Merkmale und Funktionsweise SOA
- 3.2 Web-Services
- 3.2.1 Begriffsklärung und Definition Web-Services
- 3.2.2 Merkmale und Funktionsweise Web-Services
- 3.2.3 Beschreibungssprache und Verzeichnisdienst der Web-Services
- 3.2.4 SOAP-Protokoll
- 3.2.5 XML-RPC Protokoll
- 3.2.6 REST Protokoll
- 4. BEGRIFFSDEFINITIONEN DER FACHLICHEN SICHT
- 4.1 Vorgehensmodelle der Anwendungsentwicklung
- 4.1.1 Wasserfallmodell
- 4.1.2 Inkrementelles und iteratives Modell
- 4.1.3 Agile Programmierung in der Anwendungsentwicklung
- 4.2 Business Process Modeling Notation
- 4.3 Business Process Execution Language
- 4.4 XML Process Definition Language
- 5. LEITFADEN ZUR GESTALTUNG EINER SOA
- 5.1 Schritt 0: Vorbereitung - Perspektive definieren
- 5.2 Schritt 1: Vorhandene IT-Landschaft analysieren
- 5.3 Schritt 2: Geschäftsprozessanalyse
- 5.4 Schritt 3: Architektur-Strategie festlegen
- 5.4.1 Strategie einer vollständigen Umsetzung
- 5.4.2 Strategie einer teilweisen Umsetzung
- 5.5 Schritt 4: Servicemodell aufbauen
- 5.5.1 Services identifizieren
- 5.5.2 Services kategorisieren
- 5.6 Schritt 5: Technologiewahl
- 5.6.1 Entscheidungsparameter einer Technologiewahl
- 5.6.2 Technologie festlegen
- 5.6.3 Umsetzung Web-Service Technologie
- 5.6.4 Messaging-Infrastruktur
- 5.7 Schritt 6: Komponentenmodell aufbauen
- 5.8 Schritt 7: Testen erster Realisierung der Services
- 5.9 Schritt 8: Beschreibung der Services
- 5.10 Schritt 9: Registry einbinden
- 5.10.1 Perspektive des Clients: Serviceabfrage
- 5.10.2 Service publizieren
- 5.11 Schritt 10: Services orchestrieren
- 5.12 Schritt 11: Testen orchestrierter Services
- 5.13 Schritt 12: Governance planen
- 5.13.1 IT-Governance im Allgemeinen
- 5.13.2 IT-Governance in Bezug auf das SOA-Projekt
- 5.14 Schritt 13: Testen unter Einbeziehung des Policy-Modells
- 6. SCHLUSSBEMERKUNG UND AUSBLICK
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Entwicklung eines Leitfadens zur Gestaltung einer Service-orientierten Architektur (SOA). Der Leitfaden soll Unternehmen bei der Umsetzung einer SOA unterstützen und die wesentlichen Schritte und Herausforderungen bei der Einführung einer solchen Architektur beleuchten.
- Definition und Abgrenzung von Enterprise Application Integration (EAI) und SOA
- Analyse der Funktionsweise und der Vorteile von Web-Services im Kontext der SOA
- Entwicklung eines mehrstufigen Leitfadens zur Gestaltung einer SOA
- Behandlung wichtiger Aspekte wie Service-Identifizierung, -Kategorisierung und -Orchestrierung
- Einbindung von Governance-Konzepten in die SOA-Entwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Hintergrund und die Motivation der Arbeit erläutert. Anschließend wird der Begriff der EAI abgegrenzt und verschiedene Integrationsarten und Architekturen vorgestellt. Das dritte Kapitel vertieft das Thema SOA mit Web-Services, wobei die Funktionsweise und die Vorteile dieser Technologie im Detail erläutert werden. Im vierten Kapitel werden wichtige Begrifflichkeiten aus der fachlichen Sicht beleuchtet, wie z.B. Vorgehensmodelle der Anwendungsentwicklung und Business Process Modeling Notation. Das fünfte Kapitel stellt den Kern der Arbeit dar und enthält den Leitfaden zur Gestaltung einer SOA. Dieser Leitfaden umfasst verschiedene Schritte, die von der Vorbereitung bis zur Governance Planung reichen. Die Arbeit schließt mit einer Schlussbemerkung und einem Ausblick auf zukünftige Entwicklungen im Bereich der SOA ab.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Service-orientierte Architektur (SOA), Web-Services, Enterprise Application Integration (EAI), Geschäftsprozessanalyse, Service-Identifizierung, -Kategorisierung und -Orchestrierung, Governance, Technologiewahl, Messaging-Infrastruktur, Komponentenmodell, Registry, Policy-Modell.
- Arbeit zitieren
- M.Sc. Anna-Maria Seyffert (Autor:in), 2007, Entwicklung eines Leitfaden zur Entwicklung einer SOA, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/118295