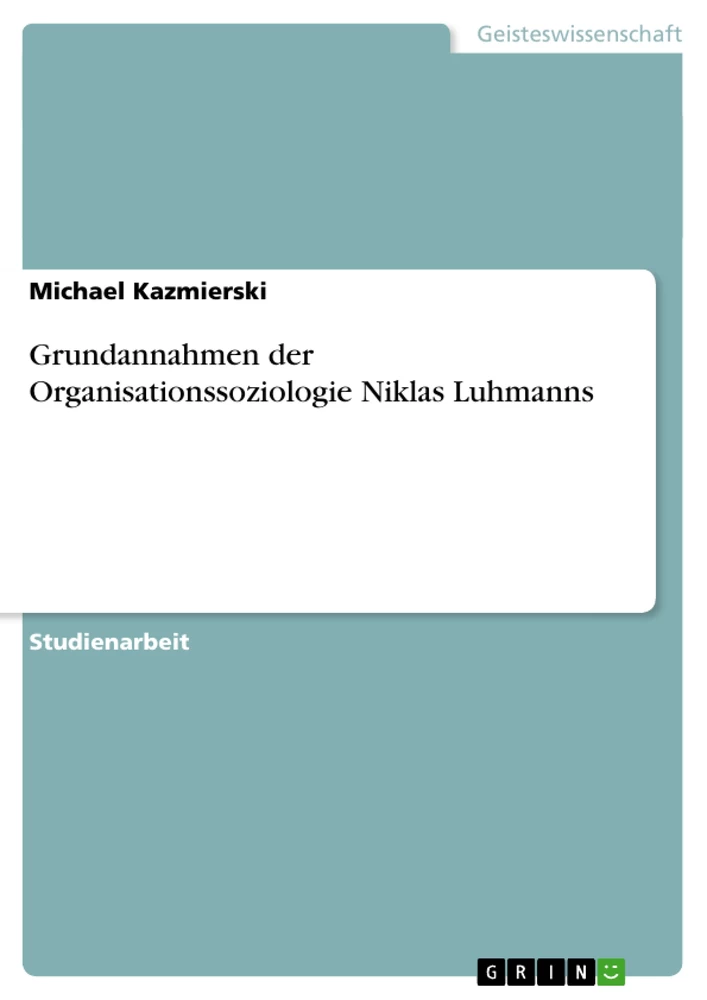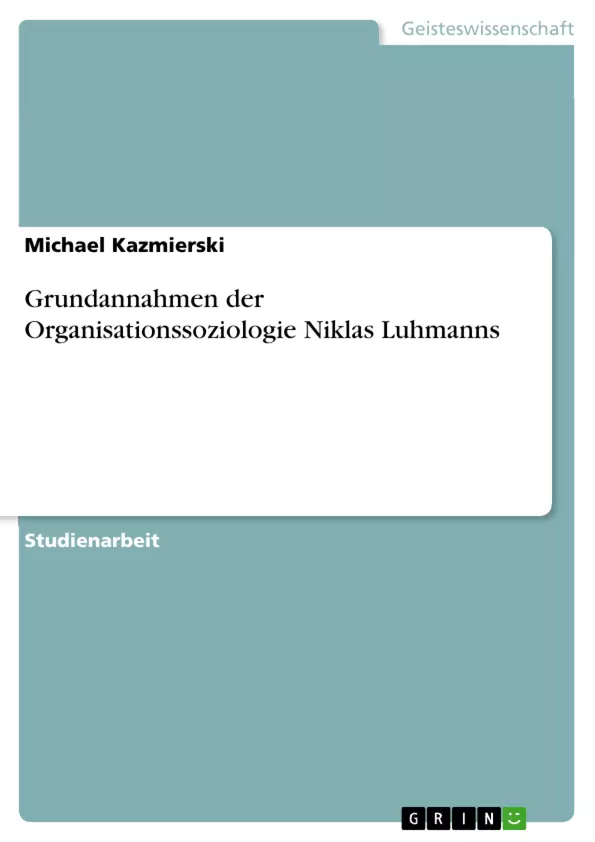Bei Organisationen handelt es sich um komplexe Gebilde. Sie koordinieren Aufgaben und Tätigkeiten unterschiedlichster, weit verstreuter und zumeist nicht gleichzeitig anwesender Charaktere. Dabei vermögen sie es all diese Tätigkeiten, trotz ihrer Simultanität so aufeinander zu beziehen, dass sie nicht Willkür oder Chaos ausgesetzt sind. Sie entwickeln Ordnungsprinzipien, gestalten Hierarchien und requirieren ihre Mitglieder anhand selbst formulierter Ein- und Austrittskriterien. Dabei agieren sie als Repräsentatoren übergeordneter, nicht adressierbarer Funktionssysteme (z.B. Bildung) und sind Mitgestalter individuell zurechenbarer Karrieren, sei es derer ihrer Mitglieder, sei es derer der von ihnen betroffenen Gesellschaftsteilnehmer.
Aufgrund all dieser Anforderungen ist es ihnen nicht möglich, alle Faktoren ihrer Existenz, Strukturierung und Ausprägung in Betracht zu ziehen. Sie sind genötigt Routinen und Programme zu entwickeln, welche Komplexität insoweit reduzieren, dass die Organisation handlungsfähig bleibt. Dabei können sie nicht ausschließlich die an sie formulierten Ansprüche in Betracht ziehen, sondern sind darauf angewiesen eigene Operationsweisen als Ausgangspunkt ihrer evolutionären Entwicklung anzuerkennen. Nichtsdestotrotz bedeutet aber die Rekursivität ihrer eigenen Operationsweise nicht, dass sie sich von der Gesellschaft soweit distanzieren, dass sie nicht mehr zu verorten, adressierbar oder mit Anforderungen zu belasten sind. Bei aller operativen Geschlossenheit sind sie auf Gesamtgesellschaft angewiesen, um diese dauerhaft in Betracht ziehen zu können, was gleichzeitig Grundbedingung ihrer Existenz ist.
Eine Theorie, welche mit der nahezu unendlichen Komplexität sozialer Systeme befasst ist, muss all diese Faktoren in Betracht ziehen. Sie muss Begrifflichkeiten für Kontingenz, Redundanz und Komplexität definieren, um auf deren Grundlage die Operationsweise nicht einsehbarer operativer Strukturen darlegen zu können.
Eine Theorie dieser Art ist die Systemtheorie Niklas Luhmanns. In ihrer Abstellung auf Kommunikation ermöglicht sie es, soziale Systeme jeglicher Art, seien es Interaktions- oder Organisationssysteme, über den gemeinsamen Nenner ihrer autopoietischen Operationsweise zu definieren und diese gleichsam in Beziehung zu setzen. Dementsprechend ist die wissenschaftliche Fragestellung dieser Hausarbeit: Was sind die Grundannahmen der Organisationstheorie Niklas Luhmanns?
Zwecks dieser Zielsetzung sollen in einem ersten Teil Grundbegrifflichkeiten der Systemtheorie vorgestellt werden, um diese dann in einem zweiten Teil auf den Sonderfall der Organisationssysteme anzuwenden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundbegriffe
- Soziale Systeme als operativ geschlossene Systeme / Autopoiesis
- Interaktion, Organisation, Gesellschaft
- Triviale und nichttriviale Maschinen
- Zwischenfazit
- Organisationen
- Die Paradoxie des Entscheidens
- Unsicherheitsabsorption
- Entscheidungsprämissen
- Organisation und Gesellschaft
- Fazit
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit beschäftigt sich mit den Grundannahmen der Organisationstheorie Niklas Luhmanns. Ziel ist es, ein Verständnis der Organisationssoziologie Luhmanns zu entwickeln, indem zunächst die Grundbegriffe der Systemtheorie vorgestellt und anschließend auf den Sonderfall der Organisationssysteme angewendet werden.
- Operativ geschlossene Systeme und Autopoiesis
- Differenzierung von Interaktions-, Organisations- und Gesellschaftssystemen
- Triviale und nichttriviale Maschinen im Sinne des radikalen Konstruktivismus
- Kommunikation als grundlegende Operation sozialer Systeme
- Funktionale Differenzierung und die Binärcodierung von Funktionssystemen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Organisationssoziologie ein und stellt die Komplexität von Organisationen sowie die Notwendigkeit einer systemtheoretischen Betrachtungsweise heraus. Das erste Kapitel, „Grundbegriffe“, legt die systemtheoretischen Grundannahmen dar, die für das Verständnis der Organisationssoziologie Luhmanns unerlässlich sind. Dazu gehören die Theorie operativ geschlossener Systeme, die Autopoiesis, die Unterscheidung verschiedener Systemtypen und die Einführung der Begrifflichkeiten von Heinz von Foerster, insbesondere die Unterscheidung zwischen trivialen und nichttrivialen Maschinen. Das zweite Kapitel, „Organisationen“, wendet die systemtheoretischen Grundbegriffe auf Organisationen an und beleuchtet die Paradoxie des Entscheidens, die Unsicherheitsabsorption, die Entscheidungsprämissen und die Beziehung von Organisation und Gesellschaft. Der Fokus liegt dabei auf der Funktionsweise von Organisationen als autopoietische Systeme, die sich durch ihre eigene Kommunikation und Selbstorganisation auszeichnen.
Schlüsselwörter
Die Hausarbeit behandelt zentrale Konzepte der Systemtheorie Niklas Luhmanns im Kontext der Organisationssoziologie. Die Schlüsselwörter umfassen: operativ geschlossene Systeme, Autopoiesis, Kommunikation, Interaktion, Organisation, Gesellschaft, Funktionale Differenzierung, Binärcodierung, Entscheidungsfindung, Unsicherheitsabsorption, Komplexität, Kontingenz, Redundanz, triviale und nichttriviale Maschinen, radikaler Konstruktivismus.
- Arbeit zitieren
- Michael Kazmierski (Autor:in), 2008, Grundannahmen der Organisationssoziologie Niklas Luhmanns, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/117375