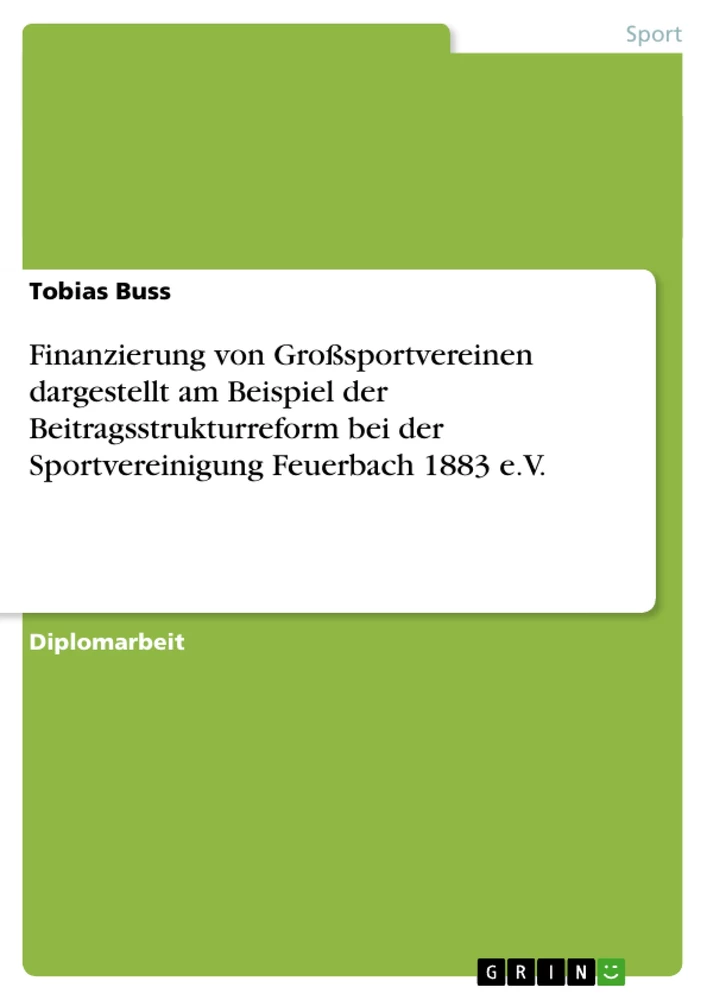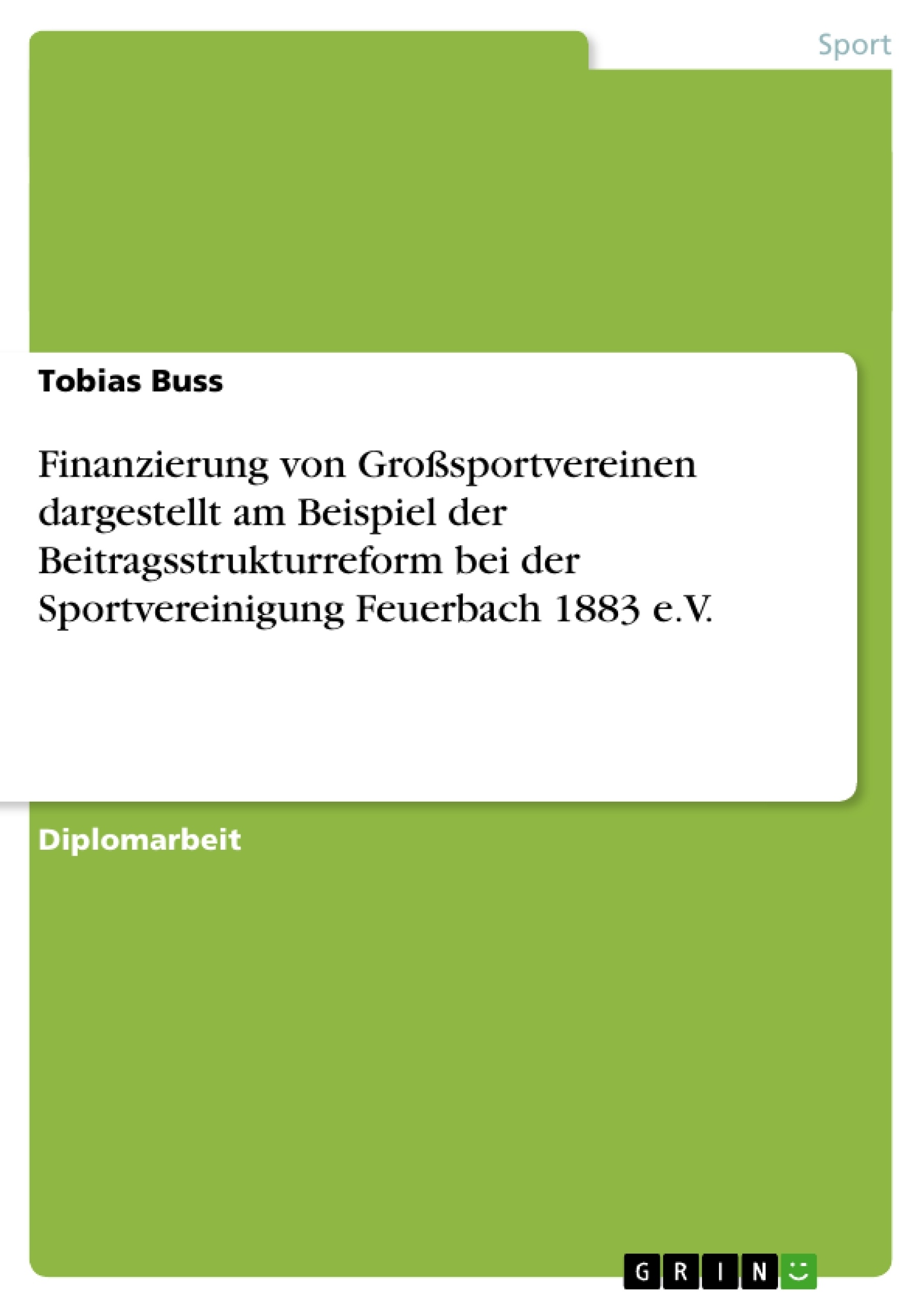[...] Es wird davon ausgegangen, dass die angesprochenen Entwicklungen sich mit zunehmender Größe und Mitgliederzahl eines Vereins stärker auf die Anforderungen an die Beitragsstruktur auswirken. Folglich zielt diese Arbeit auf die Optimierung der Finanzierung von Großsportvereinen durch eine Beitragsstrukturreform ab. Dabei soll herausgearbeitet werden, warum insbesondere für diese Vereine die Neu- bzw. Umkonzipierung der eigenen Beitragsstruktur für die Finanzierung von großer Bedeutung sein kann. Anhand der Vorteilhaftigkeit von Mitgliedsbeiträgen in der Finanzierung von Sportvereinen soll zudem nochmals deren Wichtigkeit unterstrichen werden. Durch die Erarbeitung eines Handlungsvorschlags für die Beitragsstrukturreform der Sportvereinigung (Sportvg) Feuerbach 1883 e.V. soll anderen Vereinsmanagern von Großsportvereinen eine mögliche Vorgehensweise für derartige Konzeptionen nahegelegt, und deren Auswirkungen veranschaulicht werden. Die Sportvg Feuerbach ist mit insgesamt 5.547 gemeldeten Mitgliedern (Stand: Januar 2007) einer der größten Sportvereine Stuttgarts. Jedoch leidet dieser traditionsreiche Großsportverein unter schwerwiegenden finanziellen Problemen. Nachdem externe Hilfe in Form eines Schuldenerlasses sowie zusätzlicher Unterstützung der Stadt Stuttgart dem Verein helfen sollen, ist dieser jedoch auch selbst in der Pflicht, wieder eine gesunde finanzielle Grundlage zu schaffen. Die vollständige Überarbeitung des bestehenden Beitragssystems im Rahmen dieser Diplomarbeit soll nun einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, den Verein wieder in eine sicherere Zukunft zu führen. Einer der Schwerpunkte dieser Reform ist die vollständige Eingliederung des vereinseigenen, aber dennoch Nichtmitgliedern bisher zugänglichen, Fitnessstudios in den Hauptverein. Jedoch sollen im Zuge dessen auch weitere Schwächen der bestehenden Beitragsstruktur herausgearbeitet und behoben werden, um die Einnahmen durch Mitgliedsbeiträge optimieren und die damit verbundenen Arbeitsprozesse effizienter gestalten zu können.
Inhaltsverzeichnis
Anhangsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Vorwort
1 Einleitung und Problemstellung
2 Theoretischer Bezugsrahmen
2.1 Zur Situation von Sportvereinen in Baden-Württemberg
2.1.1 Vereinsziele
2.1.2 Entwicklungen
2.1.3 Probleme
2.1.4 Fazit
2.2 Grundlagen der Finanzierung
2.2.1 Begriffsbestimmungen
2.2.2 Allgemeine Finanzierungsarten
2.3 Finanzierung in Sportvereinen
2.3.1 Der Sportverein als bedarfsorientierter Betrieb
2.3.2 Einnahmestruktur von Sportvereinen
2.3.2.1 Einteilung nach Tätigkeitsbereich
2.3.2.2 Einteilung nach Finanzierungsarten
2.3.2.3 Optimierbarkeit der Einnahmen
2.4 Zwischenfazit
3 Methodischer Zugang einer Beitragsstrukturreform
3.1 Kostenrechnung und Beitragsgestaltung im Sportverein
3.1.1 Grundlagen der Kosten- und Leistungsrechnung
3.1.2 Beitragsgestaltung im Sportverein
3.1.3 Einbindung der Kostenrechnung in die Beitragsgestaltung
3.2 Die Situationsanalyse als Grundlage strategischer Entscheidungen
3.2.1 Grundlagen
3.2.2 Methodische Vorgehensweise im Fallbeispiel
4 Beitragsstrukturreform der Sportvg Feuerbach 1883 e.V.
4.1 Analysephase
4.1.1 Betriebsanalyse
4.1.1.1 Aktuelle Beitragsstruktur
4.1.1.2 Mitgliederentwicklung
4.1.1.3 Aktuelle Mitgliederzahlen und Beitragsaufkommen
4.1.1.4 Finanzielle Situation
4.1.1.5 Sportstätten
4.1.1.6 Abteilungen
4.1.1.7 Mitgliederverwaltung und Beitragszahlung
4.1.2 Konkurrenzanalyse
4.1.2.1 Enge Konkurrenten
4.1.2.2 Weite Konkurrenten
4.1.3 Umfeldanalyse
4.1.3.1 Sportliches Umfeld
4.1.3.2 Soziales Umfeld
4.1.3.3 Ökonomisches Umfeld
4.2 Strategische Diagnose
4.2.1 Interpretation der Ergebnisse
4.2.1.1 Stärken und Schwächen
4.2.1.2 Chancen und Risiken
4.2.2 Zielsetzung für die Zukunft
4.3 Maßnahmen
4.3.1 Optimierung der Beitragsstruktur
4.3.2 Neubemessung der Grundbeiträge
4.3.2.1 Kostenorientierter Ansatz
4.3.2.2 Konkurrentenorientierter Ansatz
4.3.2.3 Festsetzung des Grundbeitrags
5 Fazit und Ausblick
6 Literaturverzeichnis
7 Anhang
Anhangsverzeichnis
Anhang 1: Aktuelle Beitragsstruktur der Sportvg Feuerbach
Anhang 2: Aktuelle Preisliste Vitadrom Fitness
Anhang 3: Stadtbezirke Stuttgart
Anhang 4: Geografische Sicht der Region Stuttgart
Anhang 5: Landkreis Ludwigsburg
Anhang 6: Kostenorientierter Ansatz – Ausgaben
Anhang 7: Kostenorientierter Ansatz – Einnahmen
Anhang 8: Vorschlag für die neue Beitragsstruktur
Anhang 9: Notwendige Änderungen der Beitragsordnung
Anhang 10: Notwendige Änderungen der Satzung.
Digitaler Anhang
1. Betriebsanalyse
a Satzung der Sportvg Feuerbach
b Erfolgsrechnung Sportvg Feuerbach 2004
c Erfolgsrechnung Sportvg Feuerbach 2005
d Erfolgsrechnung Sportvg Feuerbach 2006
e Auswertung der Erfolgsrechnungen
f Mitgliederstand 31.07.07 und Beitragsvolumen
2. Konkurrenzanalyse
a Analyse der engen Konkurrenten
b Analyse der weiten Konkurrenten
3. Neubemessung der Grundbeiträge
a Kostenorientierter Ansatz
b Konkurrentenorientierter Ansatz
c Bemessung der Grundbeiträge und Szenarienbildung
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Tätigkeitsbereiche eines Vereins (Quelle: Madeja, 2006, S. 27).
Abbildung 2: Mitgliederentwicklung im Hauptverein 2001 bis 2007.
Abbildung 3: Altersverteilung Hauptverein Januar 2004.
Abbildung 4: Altersverteilung Hauptverein Januar 2007.
Abbildung 5: Entwicklung Vertragszahlen im Vitadrom 2001 bis 2007.
Abbildung 6: Entwicklung Vertragtypen im Fitnessbereich Vitadrom.
Abbildung 7: Altersverteilung Vitadrom Fitness Juni 2004.
Abbildung 8: Altersverteilung Vitadrom Fitness Dezember 2006.
Abbildung 9: Vertragsbeginn Fitness.
Abbildung 10: Durchschnittliche Deckung der Aufwendungen HV.
Abbildung 11: Durchschnittliche Deckung der Aufwendungen Vitadrom.
Abbildung 12: Entwicklung der Teilnehmerzahlen KiSS seit Januar 2006.
Abbildung 13: Soll-Ist-Vergleich Lastschriftverfahren.
Abbildung 14: Soll-Ist-Vergleich Überweisungen/Barzahlungen.
Abbildung 15: Kündigungstermine pro Jahr (N=20).
Abbildung 16: Kündigungsfristen in Monaten (N=20).
Abbildung 17: Zahlungstermine pro Jahr (N=20).
Abbildung 18: Abteilungsbeitrag für Familien der engen Konkurrenten (N=13).
Abbildung 19: Kündigungstermine pro Jahr (N=26).
Abbildung 20: Kündigungsfristen in Monaten (N=26).
Abbildung 21: Zahlungstermine pro Jahr (N=26).
Abbildung 22: Abteilungsbeitrag für Familien der weiten Konkurrenten (N=20).
Abbildung 23: Familienstand Stuttgarter Bevölkerung (Quelle: Statistisches Amt der Landeshauptstadt Stuttgart, 2006)
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Allgemeine Finanzierungsarten.
Tabelle 2: Finanzierung von Sportvereinen.
Tabelle 3: Beitragsvolumen Hauptverein zum 31.07.2007.
Tabelle 4: Familienbeiträge im Detail.
Tabelle 5: Einnahmen des Hauptvereins bei Einzelverwaltung.
Tabelle 6: Verlust der Abteilungen.
Tabelle 7: Notwendige Erhöhung für Kostendeckung HV.
Tabelle 8: Notwendige Erhöhung für Kostendeckung Vitadrom.
Tabelle 9: Auslastung 2006 Hugo-Kunzi-Halle.
Tabelle 10: Auslastung 2006 Sportplätze.
Tabelle 11: Vereinsangebot enge Konkurrenten.
Tabelle 12: Beitragsstrukturen enge Konkurrenten.
Tabelle 13: Grundbeitragshöhen der engen Konkurrenten.
Tabelle 14: Beitragshöhen für Familien der engen Konkurrenten.
Tabelle 15: Vereinsangebot weite Konkurrenten.
Tabelle 16: Beitragsstrukturen weite Konkurrenten.
Tabelle 17: Grundbeitragshöhen der weiten Konkurrenten.
Tabelle 18: Beitragshöhen für Familien der weiten Konkurrenten.
Tabelle 19: Stärken und Schwächen der Sportvg Feuerbach.
Tabelle 20: Chancen und Risiken der Sportvg Feuerbach.
Tabelle 21: Zu errechendes Beitragsvolumen.
Tabelle 22: Grundbeiträge (GB) der Konkurrenten.
Tabelle 23: Vorschlag für Grundbeiträge.
Tabelle 24: Beitragsvolumen Worst Case.
Tabelle 25: Beitragsvolumen Middle Case.
Tabelle 26: Beitragsvolumen Best Case.
Vorwort
Die Untersuchungen für die folgende Diplomarbeit wurden im Zeitraum zwischen Anfang August 2007 und Ende Oktober 2007 durchgeführt.
Ein besonderer Dank gilt dabei Herrn Matthias Ranke, dem hauptamtlichen Geschäftsführer der Sportvereinigung Feuerbach, der mir bei der Entwicklung dieses Konzepts die Gelegenheit gab mich selbständig und eigenverantwortlich dieser Problemstellung widmen zu können. Durch den regelmäßigen Austausch konnte ich zudem von seiner langjährigen Erfahrung in der praktischen Vereinsarbeit profitieren.
Ein weiterer Dank geht selbstverständlich an die „Mädels“ der Geschäftsstelle und an alle weiteren Helfer bzw. Ansprechpartner, die mich ebenfalls bei meinen Recherchen tatkräftig unterstützten.
Die Konzipierung dieser Strukturreform gab mir nicht nur ein interessantes und umfangreiches Thema für meine Diplomarbeit. Sie ermöglichte mir zudem mein im Studium erarbeitetes Wissen in einem Sportverein in die Praxis umzusetzen, der mir seit meinem dortigen Zivildienst am Herzen liegt.
Ich hoffe, dass die in dieser Untersuchung gewonnenen Erkenntnisse und der daraus resultierenden Handlungsvorschlag einen Beitrag für eine sichere und erfolgreiche Zukunft der Sportvereinigung Feuerbach leisten werden.
Zu guter Letzt würde ich an dieser Stelle gerne meine Dankbarkeit gegenüber meiner Familie zum Ausdruck bringen. Jegliche Worte könnten jedoch dem Ausmaß der Unterstützung meiner Eltern und meines Bruders, die ich während meiner gesamten Studienzeit erfahren durfte, und der hierfür empfundenen Wertschätzung und Dankbarkeit nicht annähernd gerecht werden.
- DANKE -
1 Einleitung und Problemstellung
Gemeinnützige Sportvereine haben in Deutschland eine lange Tradition. Lange Zeit wurde in dieser Tradition die Vereinsarbeit ausschließlich ehrenamtlich verrichtet. Wirtschaftliche Denkweisen und Arbeitsprozesse wurden dabei weitgehend vernachlässigt. Begründet wurde dies mit der Zielsetzung von gemeinnützigen Sportvereinen, in der nicht wirtschaftliche, sondern gemeinnützige Ziele wie z. B. die Geselligkeit im Verein im Vordergrund stehen. Außerdem werden Sportvereine aufgrund ihres gemeinnützigen Auftrags durch öffentliche Gelder finanziell unterstützt, womit die Notwendigkeit des Wirtschaftens zumindest in der Vergangenheit nicht zwingend erforderlich war. Veränderungen in den Anforderungen an die Sportvereine und veränderte Rahmenbedingungen haben jedoch dazu geführt, dass sich auch in diesen gemeinnützigen Organisationen die Arbeits- und Denkweisen geändert haben. Einerseits haben vor allem Großportvereine bei der Suche nach ehrenamtlichen Mitarbeitern mittlerweile erhebliche Probleme (Nagel, Conzelmann, Gabler, 2004, S. 67). Andererseits ist die Vereinsarbeit, z. B. aufgrund von gestiegenen Anforderungen der Mitglieder an die Qualität des Sportprogramms, nicht mehr ausschließlich durch ehrenamtliche Mitglieder zu bewältigen. Die Notwendigkeit der Einbindung von bezahlten Mitarbeitern wurde zwischenzeitlich vor allem in Großsportvereinen erkannt und so beschäftigen mittlerweile ca. 73 % der Großvereine bezahlte Mitarbeiter. Etwa 20 % dieser Vereine haben sogar einen Geschäftsführer (Breuer, 2007a, S. 178). Durch die Einbindung bezahlter Mitarbeiter steigen jedoch auch die Personalkosten der Sportvereine. Um für die Mitglieder ein qualitativ hochwertiges Sportprogramm anbieten zu können bedarf es ebenfalls mehr finanzielle Mittel. Daher ist es nicht verwunderlich, dass in der Vereinsarbeit die Finanzierung von Sportvereinen immer mehr an Bedeutung gewinnt. Aber auch die Sportwissenschaft bietet den Verantwortlichen der Sportvereine eine Fülle von Theorien und Arbeitshilfen zur Finanzierung von Sportvereinen (bspw. Vilain, 2006; Wadsack, 1997). Als wichtigste Einnahmequelle für Sportvereine stehen sowohl in der praktischen Vereinsarbeit als auch in der wissenschaftlichen Literatur die Mitgliedsbeiträge im Vordergrund (Breuer, 2007, S. 152; Nagel 2006, S. 55 u. Nagel, Conzelmann, Gabler, 2004, S.73). Geht es jedoch um die Erarbeitung von Arbeitshilfen und Konzepten zur Finanzierung, so wird offensichtlich die Beitragsstruktur in ihrer Gesamtheit vernachlässigt. Vielmehr geht es in diesen Ausarbeitungen vor allem darum, sich neuer, externer Finanzierungsquellen zu bedienen. Ein zentrales Themengebiet in diesem Zusammenhang ist beispielsweise die Erarbeitung von Sponsoringkonzepten (bspw. Egger, 2002; Vogt, 2002). Hinsichtlich der Mitgliedsbeiträge liefert die wissenschaftliche Literatur jedoch hauptsächlich Handlungsvorschläge für die Bemessung der Beitragshöhen bzw. neue Bemessungsgrundlagen (bspw. Madeja, 2006; VIBSS, 2007). In der folgenden Arbeit wird in diesen beiden Aspekten ein entscheidender Widerspruch gesehen, denn aufgrund der oben genannten Entwicklungen liegt es doch nahe, dass sich auch die Anforderungen an die Beitragsstruktur eines Sportvereins weiterentwickeln werden und deshalb Handlungsbedarf bezüglich der Reformierung dieser Strukturen besteht.
Genau dieser Problematik widmet sich die folgende Arbeit.
Es wird davon ausgegangen, dass die angesprochenen Entwicklungen sich mit zunehmender Größe und Mitgliederzahl eines Vereins stärker auf die Anforderungen an die Beitragsstruktur auswirken. Folglich zielt diese Arbeit auf die Optimierung der Finanzierung von Großsportvereinen durch eine Beitragsstrukturreform ab. Dabei soll herausgearbeitet werden, warum insbesondere für diese Vereine die Neu- bzw. Umkonzipierung der eigenen Beitragsstruktur für die Finanzierung von großer Bedeutung sein kann. Anhand der Vorteilhaftigkeit von Mitgliedsbeiträgen in der Finanzierung von Sportvereinen soll zudem nochmals deren Wichtigkeit unterstrichen werden.
Durch die Erarbeitung eines Handlungsvorschlags für die Beitragsstrukturreform der Sportvereinigung (Sportvg) Feuerbach 1883 e.V. soll anderen Vereinsmanagern von Großsportvereinen eine mögliche Vorgehensweise für derartige Konzeptionen nahegelegt, und deren Auswirkungen veranschaulicht werden.
Die Sportvg Feuerbach ist mit insgesamt 5.547 gemeldeten Mitgliedern (Stand: Januar 2007) einer der größten Sportvereine Stuttgarts. Jedoch leidet dieser traditionsreiche Großsportverein unter schwerwiegenden finanziellen Problemen. Nachdem externe Hilfe in Form eines Schuldenerlasses sowie zusätzlicher Unterstützung der Stadt Stuttgart dem Verein helfen sollen, ist dieser jedoch auch selbst in der Pflicht, wieder eine gesunde finanzielle Grundlage zu schaffen. Die vollständige Überarbeitung des bestehenden Beitragssystems im Rahmen dieser Diplomarbeit soll nun einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, den Verein wieder in eine sicherere Zukunft zu führen. Einer der Schwerpunkte dieser Reform ist die vollständige Eingliederung des vereinseigenen, aber dennoch Nichtmitgliedern bisher zugänglichen, Fitnessstudios in den Hauptverein. Jedoch sollen im Zuge dessen auch weitere Schwächen der bestehenden Beitragsstruktur herausgearbeitet und behoben werden, um die Einnahmen durch Mitgliedsbeiträge optimieren und die damit verbundenen Arbeitsprozesse effizienter gestalten zu können.
2 Theoretischer Bezugsrahmen
Im nun folgenden Theorieteil der Arbeit soll die wissenschaftliche und praktische Relevanz der Optimierung der Beitragsstruktur in Sportvereinen und insbesondere in Großsportvereinen geklärt werden. Damit soll die Frage nach der Notwendigkeit der Reformierung bestehender Beitragssysteme in diesen Organisationen beantwortet werden. Dabei gibt Kapitel 2.1 einen Einblick in die derzeitige Situation von Sportvereinen. Es analysiert aktuelle Entwicklungen und häufige Probleme. Da sich das spätere Fallbeispiel auf einen Stuttgarter Großsportverein bezieht, beschränkt sich dieser Abschnitt auch auf die explizite Situation der Sportvereine in Baden-Württemberg, welche anhand der Ergebnisse zweier aktueller Studien betrachtet wird. Diese Betrachtung zielt darauf ab, die Notwendigkeit der Reformierung von Beitragsstrukturen in Großsportvereinen mit strukturellen Entwicklungen und Veränderungen zu begründen. Ausgehend von den allgemeinen Grundlagen der Finanzierung werden in Kapitel 2.2 und 2.3 die möglichen Einnahmequellen von Sportvereinen den allgemeinen Finanzierungsarten zugeordnet und die jeweiligen Vor- und Nachteile diskutiert. Anhand dieser Ordnung werden die Vorteile der Einnahmen durch Mitgliedsbeiträge gegenüber anderen Finanzierungsquellen dargestellt werden. Des Weiteren wird die These diskutiert, warum die Vereinsmanager nach eventuell bestehenden Problemen der eigenen Beitragsstruktur suchen und sich mit deren Lösung befassen, und sich bei finanziellen Problemen nicht nur auf die Suche nach zusätzlichen Finanzierungsquellen konzentrieren sollten
2.1 Zur Situation von Sportvereinen in Baden-Württemberg
Zunächst wird der Frage nachgegangen werden, warum sich die Anforderungen an die Beitragsstruktur eines Sportvereins mit der Zeit und mit zunehmender Größe des Vereins verändern können. Zur Analyse der aktuellen Situation von Sportvereinen in Baden-Württemberg werden die Ergebnisse der WLSB-Vereinsstudie von Nagel, Conzelmann und Gabler (2004) sowie des Sportentwicklungsberichts 2005/2006 von Breuer (2007a) herangezogen und diskutiert.
Nagel, Conzelmann und Gabler beschäftigen sich explizit mit der Frage, ob Sportvereine in ihrer bestehenden Form auch in Zukunft eine erfolgversprechende Organisationsform für den Sport darstellt. Breuer hingegen möchte anhand der aktuellen Situation der Sportvereine „Handlungsempfehlungen für die Sportpolitik Deutschlands und der 16 Bundesländer“ (Breuer, 2007a, S. 15) erarbeiten. Diese sollen der Weiterentwicklung dieser Organisationsform dienen. Beide Studien bauen methodisch auf eine Vereinsbefragung mittels eines Fragebogens auf, unterscheiden sich jedoch hinsichtlich des Einzugsgebietes der befragten Vereine. Während sich die veröffentlichte WLSB-Vereinsstudie auf Mitgliedsvereine des Württembergischen Landessportbundes (WLSB) und des Badischen Sportbundes Nord beschränkt, bezieht der Baden-Württembergische Teil des Sportentwicklungsberichts[1] auch den zweiten Badischen Landesverband, den Badischen Sportbund Freiburg in die Umfrage mit ein. Ein weiterer Unterschied der beiden Untersuchungen liegt darin, dass sich die WLSB-Vereinsstudie in mehrere Teilstudien unterteilt. In einer Vorstudie wurden Funktionäre der zehn mitgliederstärksten Fachverbände befragt. Die Hauptstudie unterteilt sich wiederum in zwei Teilstudien. In der ersten Teilstudie wurden alle der damals 5.523 gemeldeten Sportvereine des WLSB mit einer Rücklaufquote von 59,8% bzw. einer Auswertungsquote von 59,0 % hinsichtlich der bestehenden Strukturen, Mitglieder, Mitarbeiter, Finanzen, Anlagen, Außenverhältnis und Vereinsziele befragt. Anschließend wurden in der zweiten Teilstudie 20 ausgewählte Sportvereine zusätzlich mit Hilfe einer Mitgliederumfrage sowie einem Interview mit Funktionsträgern der jeweiligen Vereine tiefgehender untersucht (Nagel, Conzelmann, Gabler, 2004, S. 24f). Ein Jahr später wurde in Nordbaden eine Vergleichstudie durchgeführt, in der 2.346 Vereine mit einer Rücklaufquote von 63,3% befragt wurden (Nagel, Conzelmann, Gabler, 2004, S. 50). Eine der entscheidenden Erkenntnisse der gesamten Studie ist dabei, dass es den typischen Sportverein nicht gibt, und daher verschiedene Sportvereine sehr schlecht miteinander vergleichbar sind. Aus diesem Grund wurden mittels der Strukturvariablen Vereinsgröße, Abteilungszahl, Gründungsjahr, Haushaltsvolumen und Jahresbeitrag für Erwachsenen zunächst drei Vereinstypen gebildet, welche anschließend nochmals in neun Strukturtypen untergliedert wurden (Nagel, Conzelmann, Gabler, 2004, S. 31ff).
Die Vereinsuntersuchung des Sportentwicklungsberichts 2005/2006 basiert auf einer Online-Befragung, in der 2.201 der damals 11.426 in Baden-Württemberg gemeldeten Vereine angeschrieben wurden. 484 Fragebögen konnten ausgewertet werden, was einer Antwortrate von 22,0 % entspricht (Breuer, 2007a, S. 349).
Die Stichproben und Rücklaufquoten der beiden Studien lassen zunächst vermuten, dass die WLSB-Vereinsstudie als repräsentativer einzustufen ist als der Sportentwicklungsbericht 2005/2006. Auch die im WLSB-Vereinsbericht vorgenommene Untergliederung in Strukturtypen lässt darauf schließen, dass diese Studie für diese Arbeit, insbesondere hinsichtlich der Situation von Großsportvereinen, genauere Erkenntnisse bietet, als die Studie von Breuer. Wie bereits erwähnt, bezieht sich die Veröffentlichung des WLSB-Vereinsberichts jedoch überwiegend auf die Situation der Vereine in Württemberg und Nordbaden. Allein die Tatsache, dass der Sportentwicklungsbericht von Breuer auch regionale Auswertungen vornimmt, aber auch die Ergebnisse Teilstudien, sowie die in der WLSB-Vereinsstudie dargestellten Vergleiche zwischen den Vereinen aus Württemberg und Nordbaden, deuten jedoch auf regionale Unterschiede bezüglich der Situation der Sportvereine hin. Da im späteren Fallbeispiel auch Vereine aus dem südbadischen Teil des Bundeslandes untersucht werden, wird es daher als wichtig erachtet, auch hier die Situation der Vereine des gesamten Bundeslandes Baden-Württemberg darzustellen.
Aus diesem Grund werden im Folgenden die Ergebnisse beider Studien hinsichtlich der Ziele und Entwicklungen der Sportvereine in Baden-Württemberg, sowie deren größten Probleme analysiert.
2.1.1 Vereinsziele
Da in Sportvereinen (siehe auch Kapitel 2.3) nicht wirtschaftliche Ziele im Vordergrund stehen, wurden in beiden Studien die jeweiligen Vereinsziele erfragt, um anhand dieser Ziele den Erfolg der Sportvereine bewerten zu können.
In der WLSB-Vereinsstudie wurden den Vertretern der Vereine insgesamt 28 Ziele vorgegeben, welche in die Zieldimensionen Qualität, Mitglieder, breites Angebot/Offenheit, Leistungssport und Geselligkeit untergliedert wurden (Nagel, Conzelmann, Gabler, 2004, S. 41). Als wichtigste Ziele wurden dabei die Förderung der Jugendarbeit, die Mitgliederzufriedenheit und gutes Ansehen (ebd., S. 54). Anhand dieser fünf Zieldimensionen wurden die analysierten Vereine je nach Gewichtung der Ziele in sechs Typen eingestuft. Viele der Großvereine wurden demnach in die Kategorie der leistungs-, aber auch breitensportorientierten Vereine eingestuft. Große Mehrspartenvereine wurden hauptsächlich der Kategorie der Kursorientierte Vereine zugeordnet (ebd., S. 41ff und S. 55).
In einem weiteren Schritt wurde versucht, die Sportvereine anhand der Frage „Solidargemeinschaft oder Dienstleistungseinrichtung?“ zu ordnen. Abgrenzungskriterium für die Typisierung beider Organisationsformen war dabei die so genannte „Rollenidentität“ von Anbieter und Nachfrager eines Produktes oder einer Leistung (vgl. Kapitel 2.3), welche für Dienstleistungseinrichtungen nicht typisch ist. Die Kategorisierung wurde dafür vor allem am Professionalisierungsgrad, der Anzahl der bezahlten Mitarbeiter, in den Bereichen Training und Organisation/Verwaltung festgemacht. Anhand dieser Kriterien wurden dann fünf verschiedene Dienstleistungstypen gebildet. Ergebnis war, dass etwa 5/6 der Sportvereine in Württemberg und etwa 4/5 der Vereine in Nordbaden eher als Solidargemeinschaften eingestuft werden können. Auffällig war, dass dies überwiegend kleine Vereine sind, während die großen Vereine mit mehreren Abteilungen eher in Richtung Dienstleistungseinrichtung tendieren (Nagel, Conzelmann, Gabler, 2004, S.45ff). Diesen Ergebnissen ist zu entnehmen, dass die meisten Sportvereine noch am Idealbild der gemeinnützigen Solidargemeinschaft festhalten, dies jedoch bei steigender Mitgliederzahl und Ausdifferenzierung des Sportangebots immer schwieriger wird.
Auch Breuer kam zu dem Ergebnis, dass die Vereine in Baden-Württemberg in besonderem Maße darauf bedacht sind, ein „gemeinwohlorientiertes Sportangebot“ (Breuer, 2007a, S. 332) bereitzustellen und somit vor allem den Auftrag als gemeinnützigen Sportanbieter zu erfüllen versuchen.
Abschließend ist bei den Zielen von Baden-Württembergischen Sportvereinen festzuhalten, sie sich insgesamt noch sehr stark am Idealbild des gemeinnützigen Sportvereins orientieren und bestrebt sind, ein entsprechendes Sportprogramm anzubieten. Jedoch variiert die Gewichtung und Ausprägung der Ziele in den jeweiligen Vereinen sehr stark, wodurch ein Urteil über ein „besseres“ oder „schlechteres“ Vereinsmodell erschwert wird. Dieses Urteil wird in dieser Arbeit jedoch nicht angestrebt. Es ist jedoch davon auszugehen, dass unterschiedliche Zieldimensionen auch unterschiedliche Anforderungen an die Beitragsstruktur eines Sportvereins stellen. So ist beispielsweise anzunehmen, des eine eher kursorientierter Zieldimensionen andere Strukturen erfordert als eine leistungs- oder breitensportorientierte. Aufgrund der Variationen in den Zielen ist ebenso anzunehmen, dass sich mit zunehmender Größe eines Sportvereins auch Zielverschiebungen ergeben können. Folglich bedarf es bei derartigen Zielverschiebungen auch Umstrukturierungen in der Beitragsstruktur.
2.1.2 Entwicklungen
Da die Zieldimension „Mitglieder“ gemäß der WLSB-Vereinsstudie fast bei allen befragten Vereinen eine übergeordnete Bedeutung innehält, machen die Autoren der Studie auch eine erfolgreiche oder nicht erfolgreiche Vereinsentwicklung hauptsächlich am Verlauf der Mitgliederzahlen fest (Nagel, Conzelmann, Gabler, 2004, S. 59). Daher wurde die prozentuale Veränderung der einzelnen Vereine im Zeitraum von 1997 bis 2002 erhoben und innerhalb der unterschiedlichen Struktur- und Dienstleistungstypen analysiert. Deutliche Erkenntnis war, dass insbesondere Großvereine durchgehende Mitgliederzuwachse verzeichnen könnten. Teilweise sogar sehr deutliche Mitgliederzuwächse konnten besonders Mehrspartenvereine verzeichnen (ebd., S. 59ff).
Insgesamt bewerten die Autoren die Mitgliederentwicklung als eher positiv. Die subjektive Einschätzung der Vereinsvertreter sieht dagegen etwas anders aus. Auf die Frage nach der Zufriedenheit der Mitgliederentwicklung, welche auf einer Skala von 1 = „sehr zufrieden“ bis 5 = „sehr unzufrieden“ bewertet werden sollte, ergab sich in allen Strukturtypen ein Mittelwert zwischen zwei und drei, wobei die Vertreter der Mehrspartenvereine noch eine höhere Zufriedenheit angaben als die der Einspartenvereine (Nagel, Conzelmann, Gabler, 2004, S. 60).
Ein weiteres Kriterium für die Entwicklung eines Sportvereins ist die Entwicklung des Sportangebots. Gemäß den Studienergebnissen haben mehr als ein Drittel der untersuchten Vereine neue Sportarten ins Programm genommen (vor allem Fitness- und Gesundheitssport sowie Freizeit- und Breitensport) und 11% der Vereine haben traditionelle Sportarten aufgegeben. Insbesondere Mehrspartenvereine sind offener auf neue Entwicklungen als Einspartenvereine. Auch sind diese Vereine, vor allem Großvereine und große Mehrspartenvereine sind häufiger offen für Nicht-Mitglieder als Einspartenvereine (ebd., S. 68f). Diese Erkenntnis deutet darauf hin, dass die Strukturen in Großportvereinen schnelleren und größeren Veränderungen ausgesetzt sind, als in kleineren Vereinen.
Bezüglich der Vereinsentwicklungen bietet der Sportentwicklungsbericht 2005/2006 keine relevanten Erkenntnisse für diese Arbeit. Anhand der dargestellten Ergebnisse ist jedoch deutlich zu erkennen, dass sich die Vereine in Württemberg und in Nordbaden mit zunehmendem Alter und mit zunehmender Größe sehr stark verändern. Es kann davon ausgegangen werden, dass sich bei einer entsprechenden Befragung der südbadischen Vereine sehr ähnliche Tendenzen ergeben würden.
Somit ergibt sich auch in den Entwicklungen von Sportvereinen hinsichtlich deren Angebote eine bedeutende Tendenz für die Beitragsstrukturen in Großsportvereinen. Da sich diese Vereinstypen in ihrer Angebotsstruktur offensichtlich etwas dynamischer entwickeln als kleinere Sportvereine liegt es nahe, dass sich in ähnlicher Weise auch deren Anforderungen an die Beitragsstruktur verändern.
2.1.3 Probleme
Um die Situation der Sportvereine in Baden-Württemberg vollständig beschreiben und analysieren zu können, steht abschließend noch die Analyse der größten Probleme, denen sich die Sportvereine ausgesetzt sehen, aus. Da die Mitgliederentwicklung von den Autoren als ein sehr wichtiges Kriterium des Vereinserfolgs eingestuft wird, wurden in der WLSB-Vereinstudie die Vereinsverantwortlichen auch dazu befragt, ob die Mitgliederbindung in ihrem Verein als Problem aufgefasst wird. Insgesamt stellte sich heraus, dass es sich um ein eher unwichtiges Problem handelt, was bei der insgesamt positiven Mitgliederentwicklung auch nicht überrascht. Jedoch ergeben sich bei der Differenzierung nach Strukturtypen interessante und unterschiedliche Resultate. Die Vorsitzenden der großen Mehrspartenvereine und der teuren Einspartenvereine sehen in der Mitgliederbindung eher größere Probleme. Der dritthöchste Mittelwert auf der Skala (1 = „kein Problem“ bis 5 = „großes Problem“) ergab sich bei den Großvereinen (Nagel, Conzelmann, Gabler, 2004, S. 61). Dies ist deshalb sehr überraschend, da vor allem die großen Mehrspartenvereine und die Großvereine, wie bereits erwähnt, eine positive Mitgliederentwicklung aufweisen. Unabhängig der Vereinstruktur gaben 91% der Vereinsverantwortlichen zudem an, dass sie versuchen Maßnahmen umzusetzen, die der Mitgliedergewinnung dienen sollen. Die auffälligste Beobachtung der Autoren war dabei, dass die am häufigsten ergriffenen Maßnahmen relativ erfolglos sind und die erfolgreichen Maßnahmen selten durchgeführt werden (Nagel, Conzelmann, Gabler, 2004, S. 137).
Ein weiteres von den Vereinsvertretern angegebenes Problem ist die Gewinnung ehrenamtlicher Helfer. Insgesamt 71% der befragten Vereine leiden unter schwindenden ehrenamtlichen Helfern. Insbesondere Mehrspartenvereine und Großvereine weisen hier einen hohen Wert auf. Differenziert nach Dienstleistungstypen betrifft dieses Problem vorwiegend die eher dienstleistungsorientierten Vereine (ebd., S. 63f). Das Problem der Gewinnung ehrenamtlicher Helfer, sowie die ebenfalls angegebene schlechte Sportstättensituation (ebd., S. 72) können jedoch nicht direkt mit einer Umstrukturierung der Mitgliedsbeiträge behoben werden. Daher ist es ausreichend für diese Arbeit, diese Probleme lediglich anzusprechen und nicht weiter auszuführen. Ein großes und auch in dieser Arbeit als sehr entscheidend erachtetes Problem der Sportvereine liegt jedoch in ihrer finanziellen Situation. Insgesamt 16% der befragten Vereine gaben an, ziemlich große (11%) oder große (5%) Probleme zu haben. Differenziert nach Strukturtypen sind hierbei vor allem auch große Mehrspartenvereine und Großvereine am stärksten betroffen, wobei die Abstände zu den übrigen Strukturtypen sehr gering sind (ebd., 2004, S. 74f).
Insgesamt kommt Breuer zu dem Ergebnis, dass hochgerechnet 1.300 von 11.425 baden-württembergischen Sportvereinen (11%) existentielle Probleme haben (Breuer, 2007a, S. 340). Aus diesem Grund wurden neben den Problemen auch die Problemursachen erfragt. Im Vergleich zu den in vorherigen Ergebnissen gewannen bei dieser Frage die finanzielle Situation des Vereins und der Zustand der genutzten Sportanlagen an Bedeutung, weswegen sie von den Autoren als weitere zentrale Probleme der Sportvereine in Baden-Württemberg betrachtet wurden.
2.1.4 Fazit
Nach der Betrachtung der beiden Studien können folgende, für den weiteren Verlauf dieser Arbeit wichtigen, Erkenntnisse festgehalten werden:
1) Die Mitglieder spielen bei den Zielen, den Entwicklungen und auch bei den Problemen der Sportvereine eine entscheidende Rolle.
2) Tendenziell verfolgen die Sportvereine vor allem mitgliederorientierte und gemeinnützige Ziele, was dem Idealbild eines gemeinnützigen Sportvereins entspricht (siehe auch Kapitel 2.3).
3) Dennoch variieren die Zieldimensionen der unterschiedlichen Vereinstypen und es kann davon ausgegangen werden, dass sich mit zunehmender Größe eines Vereins Zielverschiebungen ergeben.
4) Die Vereine in Baden-Württemberg entwickeln sich kontinuierlich weiter und grenzen sich durch die jeweilige Einzelentwicklung mehr und mehr voneinander ab. Dabei kann davon ausgegangen werden, dass diese Abgrenzung mit zunehmendem Alter und zunehmender Größe eines Vereins extremer wird.
5) Die Entwicklung der Mitgliederzahlen verläuft bei den meisten Sportvereinen eher positiv, vor allem bei den Mehrsparten- und den Großvereinen.
6) Mit zunehmender Größe und Abteilungszahl sind die Vereine flexibler hinsichtlich ihres Sportangebots und reagieren schneller auf aufkommende Trends. Somit ändert sich in Großsportvereinen das Sportprogramm tendenziell häufiger als in kleinen Sportvereinen.
7) Die Mitgliedergewinnung wird nahezu von allen Befragten als wichtiges Ziel in der Vereinsarbeit angesehen. Als Gründe, insbesondere bei Großvereinen und teuren Einspartenvereinen, werden dafür bessere personelle Voraussetzungen und finanzielle Notwendigkeiten angenommen (Nagel, Conzelmann, Gabler, 2004, S. 62f). Die häufig durchgeführten Maßnahmen, wie beispielsweise Öffentlichkeitsarbeit oder Mund-zu-Mund-Propaganda führen lediglich zu geringem Erfolg.
8) Hinsichtlich der Probleme der Vereine, insbesondere der wirklich
existentiellen Probleme, rücken wirtschaftliche Aspekte, wie die finanzielle Situation des Vereins, mehr in den Vordergrund.
9) Großsportvereine leiden tendenziell eher unter finanziellen Problemen als kleine Sportvereine. Wobei hier zusätzlich zu erwähnen ist, das bei Großsportvereinen die Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen tendenziell einen geringeren Anteil der Gesamteinnahmen ausmachen als bei kleinen Vereinen (Nagel, Conzelmann, Gabler, 2004, S. 73f).
Auch wenn ein Zusammenhang zwischen den dargestellten Ergebnissen weder von den Autoren der beiden Studien wissenschaftlich belegt wurde, noch hier belegt werden kann, so sind trotzdem interessante Auffälligkeiten zu erkennen, die für den weiteren Verlauf dieser Arbeit von großer Bedeutung sind. Zunächst kann aufgrund der Weiterentwicklung der Zieldimensionen und des Sportangebots eines Vereins davon ausgegangen werden, dass sich damit verbunden auch die Mitgliederstruktur des betreffenden Sportvereins verändert. Beispielsweise spricht eine neu angebotene Trendsportart auch automatisch eine neue Zielgruppe von Sportlern an. Ein weiteres gutes Beispiel hierfür stellen die eher leistungsorientierten Sportvereine dar. Ab einem bestimmten Leistungsniveau beispielsweise einer Fußballmannschaft, hängt die Mitgliedergewinnung bzw. die Mitgliederbindung sehr stark von der sportlichen Situation des Vereins ab, welche durch Auf- oder Abstiege gravierend verändert wird. Aufgrund der Situation erfolgt ein Mitgliederzuwachs bzw. Mitgliederrückgang vorwiegend gemäß den Geschäftsjahren der sportartspezifischen Fachverbände. Ausschlaggebend sind dann die entsprechenden Wechselfristen, welche von den Fachverbänden festgelegt werden und von Sportart zu Sportart variieren können (vgl. zu den Unterschieden bspw. WLV, 2007 und DFB, 2002, S. 18). Andererseits tritt die Mitgliedschaft und die dazugehörige Zahlung der Mitgliedsbeiträge in noch höheren Leistungsebenen wieder in den Hintergrund, da dann die aktiven Sportler für ihre Leistung bezahlt werden und nicht mehr umgekehrt. Die Beispiele zeigen, dass mit zunehmender Weiterentwicklung eines Sportvereins, insbesondere hinsichtlich Mitglieder- und Abteilungszahl, davon auszugehen ist, dass eine bestehende Beitragsstruktur den Anforderungen des Sportvereins nicht mehr entsprechen kann. Folglich kann die Mitgliedergewinnung für den Verein erschwert, bzw. können die Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen nicht mehr optimal ausgeschöpft werden.
Zudem gaben bei den in der zweiten Teilstudie des WLSB-Vereinsberichts durchgeführten Interviews 9 der 20 befragten Vereinsfunktionäre „Strukturelle Bedingungen/Veränderungen im Verein“ als Grund für einen Mitgliederzuwachs, und 2 von 20 als Grund für einen Mitgliederrückgang an (Nagel, Conzelmann, Gabler, 2004, S. 138). Aus diesem Grund ist es überraschend, dass die Vereine gemäß den Angaben zwar Beitragsermäßigungen anbieten, aber offensichtlich keine Anpassungen der Beitragsstrukturen vornehmen, obwohl ca. 20% der Vereine ihr Angebot erweitern, gerade um neue Mitglieder zu gewinnen bzw. Mitglieder im Verein zu halten (ebd., S. 136). Selbstverständlich soll hier nicht behauptet werden, dass die finanziellen Probleme insbesondere der Großsportvereine unbedingt nur mit einer veralteten Beitragsstruktur zusammenhängen müssen. Abschließend kann festgehalten werden, dass insbesondere Großsportvereinen zu raten ist in regelmäßigen Abständen zu überprüfen, ob ihre Beitragsstruktur mit eventuellen strukturellen Veränderungen Schritt gehalten hat und den aktuellen Anforderungen des Vereins entspricht. Somit kann bereits hier sowohl von einer hohen wissenschaftlichen, als auch von einer für die Vereinsarbeit praktischen Relevanz der Optimierung der Beitragsstrukturen in Sportvereinen, insbesondere in Großsportvereinen, ausgegangen werden. Diese Annahme soll nun anhand der Rolle der Mitgliedsbeiträge in der Finanzierung von Sportvereinen weiter erhärtet werden.
2.2 Grundlagen der Finanzierung
Im folgenden Abschnitt steht die Fragestellung im Vordergrund, warum die Einnahmen durch Mitgliedsbeiträge in der Finanzierung von Sportvereinen eine so bedeutende Rolle spielen. Ausgehend von den allgemeinen Grundlagen der Finanzierung sollen daher die Besonderheiten der Finanzierung von Sportvereinen beschrieben werden. Im Hinblick auf diese Besonderheiten soll dann analysiert werden, welche Vorteile Mitgliedsbeiträge gegenüber anderen Einnahmequellen aufweisen.
2.2.1 Begriffsbestimmungen
Bevor eine Darstellung der grundlegenden Faktoren der Finanzierung überhaupt erfolgen kann, sind zunächst einige Begriffsbestimmungen notwendig. Einerseits muss geklärt werden, in welchen Organisationen finanziert wird. Andererseits ist es notwendig zu definieren, was Finanzierung ist. Um die erste Frage zu beantworten, soll zunächst die Bedeutung der Begriffe „Betrieb“ und „Unternehmen“ definiert werden. Ersterer wird in der Literatur beschrieben, als „planvoll organisierte Wirtschaftseinheit …, in der Sachgüter und Dienstleistungen erstellt und abgesetzt werden“ (Wöhe, 2005, S. 2). Dieser Vorgang erfolgt dabei grundsätzlich nach dem sogenannten Wirtschaftlichkeitsprinzip, auch ökonomisches Prinzip genannt. Dies bedeutet, dass entweder mit gegebenen Mitteln ein größtmöglicher Ertrag zu erzielen ist (Maximalprinzip), oder dass ein gegebenes Ziel mit einem minimalen Mitteleinsatz zu erreichen ist (Minimalprinzip). Daraus ist zu entnehmen, dass Betriebe grundsätzlich bestimmte Ziele bei der Produktion der jeweiligen Güter oder Dienstleistungen verfolgen. Dabei wird jedoch nicht genauer festgelegt, welcher Art diese Ziele zuzuordnen sind (Wöhe, 2005, S. 2f). Die Organisationsform des Betriebes umfasst mehrere Ausprägungen, wobei in der betriebswirtschaftlichen Literatur widersprüchliche Meinungen darüber existieren, ob die sogenannten „privaten Haushalte“ eine Form von Betrieben sind oder nicht, da sie im Regelfall vor allem konsumieren und weniger produzieren. Zudem produzieren Haushalte, wenn sie es denn tun, üblicherweise nur für den eigenen Bedarf (Schierenbeck, 1999, S. 22f). Die oben genannte Definition von Wöhe grenzt dieses Merkmal jedoch nicht ein, und demnach werden private Haushalte hier in den Betriebsbegriff mit einbezogen. Zudem stellt sich die Frage in dieser Arbeit nicht, da die Organisationsform, welche hier im Mittelpunkt der Betrachtung steht, definitiv produzierend tätig ist (es wird beispielsweise ein Sportangebot „produziert“). Zudem produzieren Sportvereine je nach Vereinsstruktur auch für den Bedarf Dritter, nämlich dann, wenn sie ihr Sportprogramm auch für Nicht-Mitglieder geöffnet haben (vgl. Kapitel 2.1). Einigkeit besteht in der Literatur darüber, dass die Organisationsform der „Unternehmen“ eine spezielle Form von Betrieben ist.
Diese Form kennzeichnet sich dabei gemäß Wöhe (2005) durch folgende Merkmale (vgl. auch Benner, 1992, S. 66):
- Unternehmen verfolgen im Wesentlichen erwerbswirtschaftliche Ziele, das heißt sie verfolgen das Ziel der Gewinnmaximierung.
- Unternehmen übernehmen dabei ein Marktrisiko, das bedeutet, dass sie oder ihre Eigentümer (je nach Rechtsform) bei Misserfolg die Konsequenzen zu tragen haben.
- Unternehmen produzieren ihre Güter und Dienstleistungen durch den Einsatz von Produktionsfaktoren.
- Unternehmen produzieren für einen fremden Bedarf.
Der Begriff „Finanzierung“ beschreibt nunmehr einen Teilprozess in den betrieblichen Arbeitsprozessen, welcher zur Zielerreichung von erheblicher Bedeutung ist. Gemäß Schierenbeck (1999, S. 307) umfasst Finanzierung „alle Maßnahmen, die der Bereitstellung von Kapital (Geld und geldwerten Gütern) dienen.“ Dieser Begriff kann je nach Bedarf in unterschiedlicher Weise verwendet bzw. eingegrenzt werden. Wöhe (1990) beschreibt beispielsweise eine enge und eine weite Definition des Begriffs Finanzierung. Wird hier von Finanzierung im engen Sinne gesprochen, so beschreibt dies lediglich die verschiedenen Prozesse der Beschaffung der finanziellen Mittel, während der weit gefasste Begriff auch so genannte „Kapitaldispositionen“ mit einschließt, womit die mengenmäßige Einteilung des eingehenden Kapitals gemeint ist. Letztere soll hier zunächst keine Rolle spielen, da es lediglich darum geht, die Einnahmequellen von Sportvereinen herauszuarbeiten und gemäß den allgemeinen Grundlagen zu systematisieren. Folgerichtig wird im weiteren Verlauf der Finanzierungsbegriff von Schierenbeck übernommen und unter Finanzierung zunächst die reine Beschaffung von Kapital verstanden. In beiden dargestellten Definitionen umfasst der Begriff des Kapitals verschiedene Formen. Kapital kann entweder direkt durch Geldmittel bereitgestellt werden oder in Form von Sacheinlagen, wie beispielsweise Produktionsgüter, erfolgen. Diese sind in der weiteren Betrachtung jedoch zu vernachlässigen, da sich diese Arbeit mit der Finanzierung durch Mitgliedsbeiträge und somit durch Geldmittel beschränkt. Der enge Finanzierungsbegriff der Kapitalbeschaffung nach Wöhe kann wiederum nach zeitlichen Aspekten der Beschaffung, sowie bezüglich der Verwendung und der Art der zu beschaffenden Mittel weiter eingegrenzt werden (Wöhe, 1990. S. 748). Somit kann ein sehr eng definierter Finanzierungsbegriff bei Sportvereinen beispielsweise eine langfristige Kapitalbeschaffung durch Mitgliedsbeiträge zur Finanzierung des Sportbetriebs darstellen. Bei der Systematisierung der Einnahmequellen von Sportvereinen werden jedoch alle Arten von Einnahmen in die Betrachtung mit einbezogen. Die Verwendung wird hier zunächst außer Acht gelassen. Daher ist der Finanzierungsbegriff in Abschnitt 2.3 noch relativ weit gefasst und mit Maßnahmen zur Beschaffung von Geldmitteln definiert. Erst bei der späteren expliziten Betrachtung der Mitgliedsbeiträge als Einnahmequelle von Sportvereinen kann der Finanzierungsbegriff auf die genannte enge Definition eingegrenzt werden.
In der Literatur werden die Maßnahmen der Beschaffung generell sehr eng mit der Verwendung der finanziellen Mittel verbunden. Daher wird der Finanzierungsbegriff in direktem Zusammenhang mit dem Begriff der Investition, welcher die Verwendung der beschafften Mittel beschreibt, definiert und erläutert (Wöhe, 1990, S.748). Darauf kann hier jedoch verzichtet werden, da sich diese Arbeit auf die Beschaffung der Geldmittel und somit auf die Finanzierung beschränkt.
2.2.2 Allgemeine Finanzierungsarten
Gemäß Wöhe (1990) lassen sich die unterschiedlichen Finanzierungsarten nach fünf verschiedenen Kriterien unterteilen: Kapitalherkunft, Rechtsstellung des Kapitalgebers, Einfluss auf den Vermögens- und Kapitalbereich, Dauer der Kapitalbereitstellung und Anlass der Finanzierung. Bei der vorangegangenen Begriffsbestimmung wurde bereits festgelegt, dass sowohl der zeitliche Aspekt, als auch die Verwendung der bereitgestellten Geldmittel keine entscheidende Rolle spielen sollen. Für die weitere Betrachtung sind daher vornehmlich die ersten beiden Unterscheidungsmöglichkeiten von Bedeutung und werden anschließend erläutert. Die detaillierte Beschreibung des Einflusses auf den Vermögens- und Kapitalbereich kann hier vernachlässigt werden.
a) Unterscheidung nach Herkunft des Kapitals
Bei dieser Form der Differenzierung werden die Finanzierungsarten danach getrennt, ob die finanziellen Mittel aus dem betrieblichen Umsatzprozesses des Unternehmens entstehen (Innenfinanzierung) oder nicht (Außenfinanzierung) (Wöhe, 1990. S. 760). Demnach ist die Außenfinanzierung stets mit einem Vermögenszuwachs, also einer Erhöhung des Kapitalbestands im Unternehmen verbunden. Außenfinanzierung kann einerseits als Fremdkapital in Form von Krediten von externen Geldgebern, wie zum Beispiel Banken, erfolgen. Andererseits kann hierbei Eigenkapital in Form von Einlagen oder Beteiligungen durch Kapitalgeber zugeführt werden, welche sich an dem Unternehmen beteiligen bzw. eine bereits bestehende Beteiligung erweitern wollen. Im Gegensatz dazu steht die Innenfinanzierung. Wie es der Name sagt, kommt sie sich direkt aus dem jeweiligen Unternehmen selbst, genauer aus den Erlösen des betrieblichen Umsatzprozesses des Unternehmens, welcher sich aus der Erstellung und dem Verkauf der Produkte eines Unternehmens, sowie allen weiteren betrieblichen Prozesse ergibt (Wöhe, 1990. S. 750ff.). Somit stammt auch dieses Kapital von externen Kapitalgebern, vornehmlich den Kunden. Es kann jedoch im Unterschied zur Außenfinanzierung als das Ergebnis interner Betriebsprozesse betrachtet werden. Zunächst können Umsatzerlöse offensichtlich als Eigenkapital betrachtet werden, da sie dem Unternehmen selbst zustehen. Erzielt beispielsweise ein Unternehmen Gewinne und zahlt diese nicht an die Eigentümer bzw. Anteilseigner des Unternehmens aus, so kommt es zu einem Vermögenszuwachs des Eigenkapitals. Diese Form der Finanzierung wird als Selbstfinanzierung bezeichnet. Es gibt jedoch innerhalb der Innenfinanzierung auch Finanzierungsquellen, welche nicht der Selbstfinanzierung zugeordnet werden können. Beispielsweise sind Pensionsrückstellungen finanzielle Mittel, welche zur späteren Auszahlung an pensionierte Arbeitnehmer des Unternehmens zurückgelegt werden, und diesen somit zusteht. Da Arbeitnehmer in der Regel keine Eigentümer des Unternehmens sind, fällt diese Finanzierungsart in den Bereich der Fremdfinanzierung.
Kommt es bei der Innenfinanzierung zu keinem Vermögenszuwachs im Unternehmen, wird von einer Vermögensumschichtung gesprochen. Auch hier ergibt sich das beschaffte Kapital aus Umsatzerlösen, wird jedoch direkt wieder verwendet.
Die wichtigsten Erkenntnisse für die weitere Betrachtung sind, dass die Systematisierung nach Kapitalherkunft in Innen- und Außenfinanzierung aufgegliedert werden kann, und dass es sich bei beiden Formen um Eigen- und um Fremdkapital handeln kann.
b) Unterscheidung nach der Rechtsstellung des Kapitalgebers
Die Begriffe Eigenkapital und Fremdkapital wurden bereits bei der Unterscheidung nach Kapitalherkunft genannt. Diese beiden Formen der Kapitalzuführung sind die entscheidenden Merkmale dafür, ob es sich bei einer Finanzierungsform um Eigen- oder Fremdfinanzierung handelt, womit immer unterschiedliche Rechtsstellungen des Kapitalgebers verbunden sind. Dieser erhält für die Bereitstellung von finanziellen Mitteln grundsätzlich Rechte und Pflichten am jeweiligen Unternehmen. Stellt er Eigenkapital zur Verfügung, so erhält er als Anteilseigner einen sogenannten Beteiligungstitel, wie z.B. den Titel eines Teilhabers. Damit verbunden sind dann beispielsweise Rechte auf Erfolgsbeteiligungen, sowie eventuell weitere Zahlungsverpflichtungen für den Teilhaber. Bei der Bereitstellung von Fremdkapital hingegen erwirbt der Kapitalgeber einen Gläubigertitel, der vor allem mit den Rechten auf Rückzahlung des zur Verfügung gestellten Kapitals inklusive Zinsen verbunden ist. Gemäß Wöhe (1990. S. 763) lässt sich die von ihm beschriebene Vermögensumschichtung nicht eindeutig der Eigen- oder Fremdfinanzierung zuordnen. Die genaue Beschreibung der dargestellten Fälle der Vermögensumschichtung kann hier vernachlässigt werden, da es vielmehr darum geht, woher das Kapital kommt und welche Eigenschaften sich dadurch ergeben, weniger darum wie es verwendet wird. Entscheidend ist demnach, dass sich alle Formen der Innenfinanzierung aus Umsatzerlösen ergeben. Da sie wie erwähnt nicht eindeutig nach der Rechtstellung der Kapitalgeber eingeordnet werden können, werden die Umsatzerlöse in Tabelle 1 als „Mischform“ bewertet.
Zusammenfassend können die beiden beschriebenen Unterscheidungsmöglichkeiten der Finanzierungsarten nun auch in einer zweidimensionalen Matrix dargestellt werden. Diese Darstellung soll als Vorlage für die spätere Systematisierung der Finanzierungsquellen von Sportvereinen dienen. Dabei wurden oben beschriebenen Einnahmequellen entsprechend deren Kategorien zugeordnet.
Tabelle 1: Allgemeine Finanzierungsarten.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Auf eine detaillierte Erläuterung der allgemeinen Vor- bzw. Nachteile der verschiedenen Finanzierungsarten wird in dieser Arbeit zunächst bewusst verzichtet. Dies ist nicht von Nöten, da Sportvereine, um deren Finanzierung es im Folgenden gehen soll, einer sehr spezielle Organisationsform zuzuordnen sind, und sich daher für Sportvereine ohnehin andere Vorzüge und Grenzen für die einzelnen Finanzierungsarten ergeben. Es ist daher ausreichend, im späteren Verlauf auf die spezifischen Vor- und Nachteile der Finanzierungsarten für Sportvereine einzugehen.
2.3 Finanzierung in Sportvereinen
Auch wenn es sich bei der vorherigen Betrachtung der Finanzierungsgrundlagen um eine allgemeine Einführung handelt, so beziehen sich die Darstellungen von Neus, Schierenbeck und Wöhe vornehmlich auf wirtschaftliche Unternehmensformen. Dieser Organisationsform können Sportvereine jedoch aufgrund bestimmter konstitutiver und ökonomischer Merkmale nicht zugeordnet werden. Um Sportvereine ökonomisch sinnvoll definieren und einordnen zu können, werden in einem nächsten Schritt diejenigen Merkmale herausgearbeitet und beschrieben werden, welche sie von wirtschaftlichen Unternehmen abgrenzen. Aufgrund dieser Einordnung ergeben sich anschließend diverse Faktoren, welche die Finanzierung der Organisationsform Sportverein beeinflusst, und die daher von den jeweiligen Verantwortlichen bei der Finanzplanung beachtet werden sollten.
2.3.1 Der Sportverein als bedarfsorientierter Betrieb
Sportvereine werden in ihrer Eigenart als freiwillige Vereinigung den sogenannten Non-Profit-Organisationen zugeordnet. Charakterisiert werden können freiwillige Vereinigungen durch die von Heinemann und Horch erarbeiteten fünf konstitutiven Merkmale, welche sie von typischen wirtschaftlichen Unternehmensformen abgrenzen (Heinemann & Horch, 1988, S. 109ff):
- Freiwillige Mitgliedschaft
- Orientierung an den Interessen der Mitglieder
- Autonomie
- ehrenamtliche Mitarbeit
- Demokratie
Aus diesen konstitutiven Merkmalen ergeben sich die ökonomischen Merkmale freiwilliger Vereinigungen (Horch, 1992, S.49ff), welche auch bei der Finanzierung von Sportvereinen eine bedeutende Rolle spielen:
- Keine Gewinnorientierung
- Rollenidentität
- Solidarprinzip
- Autonomen Einnahmestruktur
Um die verwendete Negativdefinition der fehlenden Gewinnorientierung zu vermeiden, können freiwillige Vereinigungen und somit auch Sportvereine demnach als bedarfsorientierte Organisationen bezeichnet werden, da die Bedarfsorientierung den Gegenpol zur Gewinnorientierung darstellt. Die beschriebene Rollenidentität von Anbieter und Nachfrager in Sportvereinen führt konsequenter Weise dazu, dass Sportvereine, unabhängig der oben beschriebenen Diskussion um die Einordnung privater Haushalte, eindeutig als Betriebe zu klassifizieren sind.
Somit können Sportvereine, unter Einbeziehung der dargestellten konstitutiven und ökonomischen Besonderheiten, sowie der vorangegangenen Begriffsdefinitionen schließlich als bedarfsorientierte Betriebe definiert werden.
Die dargestellten konstitutiven und ökonomischen Merkmale dieser Art von bedarfsorientierten Betrieben wirken sich nunmehr zwangsläufig auch auf die Finanzierung des einzelnen Vereins aus. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Finanzierung eines Sportvereins
- sich an den Interessen seiner Mitglieder orientieren,
- die finanzielle Unabhängigkeit des Vereins von externen Einflüssen sichern, sowie
- das Solidarprinzip unterstützen soll.
Entsprechend den in Abschnitt 2.2.1 beschriebenen Eigenschaften der Finanzierungsarten ergeben sich die ersten Erkenntnisse für die Finanzierung von Sportvereinen. Demnach kann eine weitestgehend unabhängige Finanzierung durch Erlöse aus den internen Umsatzprozessen und somit in Form der Innenfinanzierung erreicht werden. Ferner sollten Sportvereine danach bestrebt sein einen möglichst hohen Anteil an Eigenkapital innerhalb des Finanzierungsplans zu erzielen, um eine autonome Einnahmestruktur zu erreichen. Eine interne Eigenfinanzierung stellt die optimale Finanzierungsform für Sportvereine dar. Aus dieser Perspektive können nun die typischen Einnahmequellen von Sportvereinen gesammelt, eingeordnet und hinsichtlich deren Vor- und Nachteile für die Finanzierung analysiert werden. Schlussendlich soll damit die Vorteilhaftigkeit von Mitgliedsbeiträgen gegenüber anderen Einnahmequellen von Sportvereinen herausgearbeitet werden.
2.3.2 Einnahmestruktur von Sportvereinen
Um die typischen Einnahmequellen von Sportvereinen zusammenstellen zu können, lohnt sich ebenfalls ein Blick in die in Kapitel 2.1 vorgestellten Studien. Zusammengefasst werden in diesen beiden Studien folgende Einnahmequellen bewertet (Breuer, 2007a, S. 154; Nagel, Conzelmann, Gabler, 2004, S. 74):
- Mitgliedsbeiträge
- Aufnahmegebühren
- Spenden und Sponsoring
- Veranstaltungen
- Miet-/Pachteinnahmen
- Kursgebühren
- Kreditaufnahmen
- Vermögensverwaltung
- Selbstbetriebene Gaststätte
- Werbeverträge
Die angegebenen Einnahmequellen finden sich in vergleichbarer Weise in anderen wissenschaftlichen und praktischen Werken wieder (Madeja, 2006; Wadsack, 1997), wobei die einzelnen Einnahmequellen in den jeweiligen Werken in unterschiedlicher Weise strukturiert bzw. zusammengefasst werden. Da sich die einzelnen Vereine zum Teil sehr unterschiedlicher Finanzierungsquellen bedienen bzw. bedienen können (Breuer, 2007a, S. 156) und sich somit die Einnahmen von Verein zu Verein unterschiedlich gestalten, kann hier keine Garantie bezüglich der Vollständigkeit aller möglichen Einnahmequellen von Sportvereinen gegeben werden. Ähnlich wie in der WLSB-Vereinsstudie werden in den bundesweiten Ergebnissen der Studie von Breuer die relativen Höhen der Einnahmequellen in unterschiedlichen Vereinstypen angegeben und in beiden vorgestellten Studien ist zu erkennen, dass die Einnahmestruktur je nach Vereinstyp große Unterschiede aufweist. Auffällig ist vor allem, dass der relative Anteil der Mitgliedsbeiträge bei den großen Sportvereinen durchschnittlich geringer ist als bei den kleineren, die Einnahmestruktur hier jedoch insgesamt ausgeglichener ist. Die großen Sportvereine setzen somit auf einen sehr breit aufgebauten Finanzierungspool. Dies hat den Vorteil, dass sie nicht nur von wenigen Einnahmequellen abhängig sind.
Der Vorteil einer breit angelegten Finanzierung in Großsportvereinen soll durch diese Arbeit keineswegs bestritten werden. Dennoch ergibt sich bei der genaueren Betrachtung der unterschiedlichen Einnahmequellen eine Vorteilhaftigkeit der Einnahmen durch Mitgliedschaftsbeiträge gegenüber anderen Finanzierungsquellen. Diese Vorteilhaftigkeit soll nun anhand von drei Kriterien überprüft und deutlich gemacht werden. Zunächst werden dabei die Einnahmen gemäß der Tätigkeitsbereiche eingeteilt, was für die Einnahmen Unterschiede bezüglich der Besteuerung nach sich zieht. Anschließend werden die Einnahmen in die in Kapitel 2.2 erarbeiteten Finanzierungsarten eingeteilt und verglichen. Abschließend folgt die Überprüfung der Optimierbarkeit der Einnahmen von Sportvereinen.
2.3.2.1 Einteilung nach Tätigkeitsbereich
Eine in der Literatur sehr verbreitete Einteilung der Einnahmen von Sportvereinen ist die nach unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen (Madeja, 2006; Finanzministerium des Landes NRW, 2006). Der Grund dafür ist, dass die Einnahmen in die jeweiligen Kategorien mit unterschiedlichen Steuersätzen bemessen werden. Der gesamte Tätigkeitsbereich eines Sportvereins teilt sich demnach in vier Kategorien auf (vgl. Abbildung 1).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Tätigkeitsbereiche eines Vereins (Quelle: Madeja, 2006, S. 27).
Diese Einteilung richtet sich nach „dem Grad der Beteiligung am Wirtschaftsverkehr“ (Finanzministerium des Landes NRW, 2006, S. 33). Die in Abbildung 1 rot eingerahmten Felder werden als unternehmerischer Bereich bezeichnet, während der grün eingerahmte ideelle Bereich eines Sportvereins dem nicht unternehmerischen Bereich zugeordnet wird. Im Folgenden werden die steuerlichen Merkmale der einzelnen Tätigkeitsfelder kurz skizziert, sowie beispielhaft dazugehörige Einnahmequellen angegeben.
a) Ideeller Bereich
Der ideelle Bereich von Sportvereinen stellt den wirklich gemeinnützigen Tätigkeitsbereich dar. Die Vorraussetzungen für die Gemeinnützigkeit sind in der Abgabenordnung festgeschrieben, wobei die Paragraphen zur Förderung des Sports (§ 52 Abs. 2 Nr. 2, AO), Förderung der Allgemeinheit (§ 52 Abs. 1, AO), Selbstlosigkeit (§ 55, AO), Ausschließlichkeit (§ 56, AO), Unmittelbarkeit (§ 57) und Vermögensbindung (§ 61, AO) für Sportvereine von entscheidender Bedeutung sind und in deren Satzung verankert sein müssen (Finanzministerium des Landes NRW, 2006, S. 87ff), um als gemeinnütziger Verein anerkannt zu werden. Erfüllt ein Sportverein die genannten Kriterien, so sind die Einnahmen in diesem Bereich unabhängig ihrer Höhe von allen Steuern befreit. Dem ideellen Bereich können folgende Einnahmequellen zugeordnet werden (Madeja, 2006, S. 27f):
- Aufnahmegebühren
- Mitgliedsbeiträge
- Spenden
- Schenkungen
- Erbschaften und Vermächtnisse
- Zuschüsse
b) Vermögensverwaltung
Dieser Bereich der Einnahmen „umfasst Einkünfte aus Kapitalvermögen (Zinsen aus Bank- und Sparguthaben, Wertpapiere etc.) und Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung“ (Finanzministerium des Landes NRW, 2006, S. 34). Dabei ist zu bedenken, dass diese Einnahmen nicht grundsätzlich steuerfrei sind, sondern je nach Einzelfall mit 7% Umsatzsteuer belegt werden. Des Weiteren ist die Abgrenzung zum später beschriebenen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb nicht eindeutig abgesteckt, sondern verläuft fließend und muss im Einzelfall geklärt werden. Ein beliebtes Beispiel zur Erklärung des Unterschieds in der Literatur sind die Vereinsgaststätten (Madeja, 2006; Finanzministerium des Landes NRW, 2006). Betreibt ein Verein eine eigene Vereinsgaststätte, so sind diese Einnahmen dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb einzuordnen, selbst wenn die Gaststätte nur für Mitglieder des Vereins zugänglich ist. Dagegen fallen die Einnahmen der Vereinsgaststätte in den Vermögensbereich, wenn diese gegen einen pauschalen Pachtzins an einen Pächter vermietet hat. Als grundsätzliches Kriterium der Unterscheidung gibt Madeja (2006) die „aktive Betätigung eines Vereins“ an. Folgende Einnahmen sind demnach der Vermögensverwaltung zuzuordnen:
- Mieteinnahmen
- Pachteinnahmen
- Zinseinnahmen (Sportvereine dürfen dann Rücklagen bilden, wenn sie große Investitionen, wie z. B. den Bau einer neuen, eigenen Sporthalle planen und um für eventuelle Instandhaltungs- oder Sanierungsarbeiten der bestehenden Sportstätten aufkommen zu können.)
- Vergabe von Rechten, beispielsweise von Werberechten (Finanzministerium des Landes NRW, 2006, S. 35)
c) Zweckbetrieb
Zwar erfolgen die Einnahmen im Bereich des Zweckbetriebs aus unternehmerischen und damit wirtschaftlichen Aktivitäten heraus, jedoch werden sie aufgrund ihrer unmittelbaren Verbindung zum gemeinnützigen Zweck des jeweiligen Vereins teilweise steuerbegünstigt behandelt. Gemäß § 65 AO tritt dieser Fall ein, wenn der Geschäftsbetrieb ausschließlich den in der Satzung verankerten gemeinnützigen Zwecken des Vereins dient (§ 65 Nr. 1), wenn sich diese Zwecke nur durch einen derartigen Geschäftsbetrieb verwirklichen lassen (§ 65 Nr. 2) und wenn dieser Geschäftsbetrieb nicht in größerem Umfang als unbedingt nötig betrieben wird (§ 65 Nr. 3). Beispielsweise können folgende Einnahmen dem Zweckbetrieb zugeordnet werden:
- Eintrittsgelder und weitere Einnahmen durch Sportveranstaltungen
- Teilnahmegebühren
- Kursgebühren
- Einnahmen durch kurzfristige Vermietung an Mitglieder
- Ablösesummen
d) Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb
Dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb sind folglich die Einnahmen eines Sportvereins zuzuordnen, welche in keinen der bisher beschriebenen drei Tätigkeitsbereiche fallen. Alle diese Einnahmen unterliegen der Umsatz-Steuerpflicht und werden zudem körperschafts- und gewerbesteuerpflichtig, sofern sie die Grenze von 35.000 € pro Jahr übersteigen. Somit sind folgende Einnahmen dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb zuzuordnen (Finanzministerium des Landes NRW, 2006, S. 38):
- Einnahmen aus Sportveranstaltungen, sofern sie nicht dem Zweckbetrieb zuzuordnen sind
- Verkauf von Speisen und Getränken, sowie vom Verein selbst betriebene Vereinsgaststätten
- Eintrittspflichtige gesellige Veranstaltungen
- Kurzfristige Vermietung an Nichtmitglieder
- Verkauf von Sportartikeln
- Werbung (Anzeigen in Vereinszeitschriften, Trikot- und Bandenwerbung etc.)
Aus dieser Einteilung ergibt sich ein erster Vorteil des Mitgliedsbeitrags (neben den weiteren Einnahmen des ideellen Bereichs) gegenüber vielen anderen Einnahmequellen. Die Einnahmen sind unabhängig ihrer Höhe nicht steuerpflichtig und können somit in vollem Umfang zur Finanzierung des Vereinsbetriebs verwendet werden.
2.3.2.2 Einteilung nach Finanzierungsarten
Nun sollen die Einnahmen von Sportvereinen gemäß der Erläuterung in Kapitel 2.2 nach Finanzierungsarten eingeteilt werden. Hierbei werden jedoch nicht die Merkmale aller Einnahmen im Detail beschrieben. Gemäß den Kriterien für die Gemeinnützigkeit dürfen Sportvereine keine (erheblichen) Gewinne erwirtschaften bzw. müssen diese direkt wieder für Vereinszwecke verwenden. Somit gibt es bei dieser Organisationsform auch keinerlei Gewinnausschüttungen an etwaige Eigentümer der Organisation. Die Erlöse stehen nach Abzug von Steuerzahlungen dem Verein und seinen Mitgliedern zur Verfügung. Folglich können diese Einnahmen alle der internen Eigenfinanzierung zugeordnet werden. Wie in Kapitel 2.2 definiert, umfasst die Innenfinanzierung jene Einnahmen, welche direkt aus dem betrieblichen Umsatzprozess resultieren. Im Falle eines Sportvereins bedeutet dies, dass alle Einnahmen, welche aus dem Sportbetrieb resultieren, der Innenfinanzierung zuzuordnen sind. Dazu gehören alle Formen von Gebühren für die Teilnahme am Sportprogramm, Einnahmen aus Veranstaltungen (Eintrittsgelder und Verkaufserlöse), Einnahmen aus Sportartikelverkäufen sowie Miet- und Pachteinnahmen. Aufgrund der besonderen Rolle der Mitglieder in Sportvereinen wird die Einordnung der Mitgliedsbeiträge im Detail erläutert. Des Weiteren werden die Einnahmen aus Zuschüssen und Spenden sowie Werbung und Sponsoring detailliert besprochen und eingeordnet.
Mitgliedsbeiträge
Wie bereits mehrfach erwähnt, sind Mitgliedsbeiträge die unbestritten wichtigste Einnahmequelle von Sportvereinen. Jedoch stellt sich nun die Frage, wie sie in die in Kapitel 2.2 erarbeitete Matrix einzuordnen sind. Sind sie eher in den Bereich der Innenfinanzierung einzuordnen, da die Einnahmen aus den internen Betriebprozessen resultieren und die Beiträge somit einem Preis für die genutzten Leistungen entsprechen? Oder sind sie in den Bereich der Außenfinanzierung einzuordnen, weil die Mitglieder als Miteigentümer des Vereins betrachtet werden können, und die Beiträge Einlagen bzw. Beteiligungen gleichkommen? Um diese Frage zu klären ist es notwendig, ein weiteres Mal auf die Rolle der Mitglieder in Sportvereinen zu schauen. Gemäß der Rollenidentität sind die Mitglieder idealtypischer Weise sowohl Produzent als auch Konsument der im Verein erstellten Leistungen. Zudem verfolgt der Verein die Interessen seiner Mitglieder und diese können mittels demokratischer Entscheidungen auch die Entwicklung des Vereins beeinflussen. Die Mitglieder können einerseits zwar als Miteigentümer der Vereinigung betrachtet werden, andererseits unterscheiden sich jedoch die Rechte und Pflichten von Mitgliedern von den in Kapitel 2.2 beschriebenen Beteiligungsrechten. Beteiligungsrechte beinhalten in der Regel kein Mitspracherecht, während Mitgliedschaftsrechte insbesondere bei gemeinnützigen Vereinigungen keine Gewinnbeteiligung vorsehen. Zudem besteht noch ein weiterer entscheidender Unterschied zwischen Beteiligungszahlungen und Mitgliedsbeiträgen. Erstere sind üblicherweise einmalige Einlagen, welche einem Betrieb zur Verfügung gestellt werden. Mitglieder hingegen entrichten ihre Beiträge für die Dauer ihrer Mitgliedschaft in regelmäßigen Abständen und leisten somit einen Beitrag zur Deckung der entstehenden Kosten so lange sie die erstellten Leistungen nutzen. Somit kann bei Mitgliedsbeiträgen ohne Weiteres von einer Zwischenstellung zwischen einem Preis und einer Einlage gesprochen werden. Der hier entscheidende Faktor für eine eindeutige Zuordnung der Mitgliedsbeiträge ist schlussendlich die Rollenidentität in Sportvereinen. Die Tatsache, dass die Mitglieder das Sportangebot selbst herstellen, nutzen und im Idealfall auch finanzieren, begründet die Zuordnung eigentlich von selbst. Ein derartiger Kreislauf kann kaum in den Bereich der Außenfinanzierung eingeordnet werden, selbst wenn Mitgliedschaftsrechte gewisse Ähnlichkeiten mit Beteiligungsrechten aufweisen. Der beschriebene Kreislauf entspricht vielmehr im wahrsten Sinne des Wortes einer „Selbstfinanzierung“ und wird entsprechend in den Bereich der Innenfinanzierung eingeordnet.
Zuschüsse und Spenden
Die Einnahmen durch Zuschüsse von Sportorganisationen wie zum Beispiel den Landessportverbänden, der Sportförderung der Länder bzw. Städte und Gemeinden resultieren nicht direkt aus den internen Betriebsprozessen eines Sportvereins. Gemäß Schierenbeck (1999) werden sie als so genannte „Subventionsfinanzierung“ definiert und fallen in den Bereich der Außenfinanzierung. Da Subventionen „mit keinen mittelbaren oder unmittelbaren Gegenleistungen“ verbunden sind (Schierenbeck 1999, S. 431), erhalten die Subventionsgeber im Gegenzug keinerlei Finanzierungstitel. Sie sind Außenstehende und die Einnahmen werden demnach der Fremdfinanzierung zugeordnet. In gleicher Weise können Einnahmen durch Spenden, Schenkungen und Erbschaften charakterisiert und eingeordnet werden, da auch diese ohne direkte Gegenleistung erfolgen.
Werbung/Sponsoring
Auf den ersten Blick scheint die Einordnung von Einnahmen Werbung und Sponsoring schwierig. Grund hierfür ist, dass sich diese Finanzquellen nicht aus dem Produktionsprozess des eigentlichen Hauptproduktes eines Sportvereins, also dem Sportprogramm ergeben. Auch handelt es sich beispielsweise bei Sponsoring lediglich um die Vergabe von Rechten von Namen oder Logos für die der Sponsor eine Gegenleistung in Form von Geld- oder Sachmitteln entrichtet. Dennoch bietet der Verein eine Leistung an, indem er beispielsweise auf Trikots für einen Sponsor wirbt, oder Werbeanzeigen in der Vereinszeitschrift veröffentlicht (Preuß, 2005, S. 276). Ähnlich dem Sponsoring verhält es sich auch mit Werbung. Somit resultieren auch derartige Einnahmen aus Umsatzerlösen der betrieblichen Prozesse eines Vereins und sind demnach der Innenfinanzierung zuzuordnen.
Zusammenfassend können die typischen Einnahmen von Sportvereinen folgendermaßen in die in Kapitel 2.2.2 erarbeitete Matrix eingeordnet werden (vgl. Tabelle 2):
Tabelle 2: Finanzierung von Sportvereinen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
In Tabelle 2 sind die einzelnen Einnahmequellen gemäß der vorher beschriebenen Besteuerung farblich markiert. Somit ist der zweite Vorteil der Einnahmequellen von Mitgliedsbeiträgen deutlich erkennbar. Gegenüber den Finanzierungsquellen der Außenfinanzierung liegt dieser darin, dass sie aus dem eigenen betrieblichen Umsatzprozess resultieren und somit weitestgehend unabhängig von Dritten erwirtschaftet werden können. Gegenüber den restlichen Quellen der Innenfinanzierung wird der bereits beschriebene steuerliche Vorteil deutlich.
2.3.2.3 Optimierbarkeit der Einnahmen
Grundsätzlich können, ähnlich wie in einem erwerbswirtschaftlichen Unternehmen, alle Einnahmen der Innenfinanzierung durch eine effiziente, sprich ökonomisch sinnvolle, Vereinsarbeit sowie die Entwicklung entsprechender Konzepte und Preisstrukturen optimiert werden. Grenzen der Optimierung diese Einnahmen ergeben sich jedoch bereits aus der Mitgliederorientierung eines Sportvereins. Ein Beispiel hierfür stellen unter anderem Mieteinnahmen oder Kursgebühren dar. Wird beispielsweise eine vereinseigene Sportanlage dauerhaft an Nichtmitglieder vermietet bzw. in dieser Kurse für Nichtmitglieder angeboten, so verzeichnet ein Sportverein unter Umständen höhere Einnahmen als durch die Nutzung der Sportstätte ausschließlich durch Mitglieder. Jedoch kann eine derartige Einnahmequelle nicht unbegrenzt gesteigert werden, da durch Nutzung von Nichtmitgliedern die Kapazitäten für Mitglieder des Sportvereins eingeschränkt werden und dadurch deren Interessen nicht gewahrt werden. Auch die Einnahmen durch Werbung und Sponsoring können mittels gezielter Werbe- und Sponsoringkonzepte erhöht werden. Hierfür bietet die sportwissenschaftliche Literatur den Vereinsverantwortlichen eine Vielzahl an Arbeitshilfen und Konzepten (Egger, 2002; Vogt, 2002). Auch für die Optimierung der Einnahmen durch Spenden werden mittlerweile derartige Konzepte empfohlen (Madeja 2006, S. 77f).
Anders als bei der Innenfinanzierung sieht die Optimierbarkeit der Einnahmen im Bereich der Außenfinanzierung aus. Beispielsweise können Zinseinnahmen zwar durch die Anhäufung von Vermögen erhöht werden. Dies ist Sportvereinen wie bereits erwähnt jedoch nicht unbegrenzt erlaubt, wenn sie ihre Gemeinnützigkeit erhalten wollen. Im Falle der Schenkungen, Erbschaften und Vermächtnisse sind Sportvereine schlicht und ergreifend von wohlwollenden Gönnern abhängig. Die Höhe dieser Einnahmen ist somit nicht durch den Verein selbst beeinflussbar. Ebenfalls nicht optimierbar sind die Einnahmen aus Zuschüsse von Sportorganisationen und der Sportförderung der Länder und Kommunen. Zum Einen sind Zuschüsse, wie es der Begriff selbst bereits aussagt, Zuschüsse zu Ausgaben, die der Verein ohnehin tätigt. Somit mindern Zuschüsse lediglich die Ausgaben des Sportvereins, erhöhen jedoch nicht seine Einnahmen. Zum Anderen sind sie in den entsprechenden Sportförderrichtlinien der jeweiligen Länder bzw. Städte festgeschrieben und der Sportverein selbst hat folgerichtig keinerlei Einfluss auf deren Höhe (Sportamt Stuttgart, 2004). Er ist somit von der finanziellen Situation des jeweiligen Bundeslandes bzw. der Stadt oder Gemeinde abhängig. Da die Kassen vieler Länder und Kommunen immer weniger gefüllt sind, müssen Sportvereine damit rechnen, dass die öffentliche Sportförderung zukünftig zurückgehen könnte und die Vereine damit noch mehr auf andere Einnahmequellen angewiesen sind.
Abschließend bleibt festzuhalten, dass Mitgliedsbeiträge in allen hier beschriebenen Kriterien eine Vorteilhaftigkeit gegenüber anderen Finanzierungsquellen aufweisen. Zwar besteht diese Vorteilhaftigkeit in den Einzelpunkten nicht gegenüber allen anderen Quellen, die Mitgliedsbeiträge eines Sportvereins sind jedoch die einzige Finanzierungsquelle, die in allen drei Kriterien vorteilhaft ist und sich somit insgesamt gegenüber allen anderen Quellen heraushebt.
2.4 Zwischenfazit
Die Einnahmen durch Mitgliedsbeiträge in Sportvereinen wurden nunmehr aus zwei unterschiedlichen Perspektiven betrachtet und analysiert. In Kapitel 2.1 wurden vornehmlich strukturelle Begebenheiten in Sportvereinen betrachtet und die Notwendigkeit der Reformierung von Beitragsstrukturen in Großsportvereinen wegen sich verändernden Anforderungen untersucht. Dabei stellte sich heraus, dass sich die wissenschaftliche und praktische Relevanz der Optimierung von Beitragsstrukturen offensichtliche aus der zunehmenden strukturellen Ausdifferenzierung ergibt. Demnach ist die Bedeutung dieser Optimierung insbesondere in den Vereinen, welche sich strukturell stark verändern, gemäß den Studienergebnissen also in Großsportvereinen, sehr hoch. In den Kapiteln 2.2 und 2.3 wurden die Mitgliedsbeiträge aus finanztechnischer Sicht bewertet. In dieser Analyse wurde die in der Literatur häufig erwähnte besondere Stellung der Mitgliedsbeiträge bei der Finanzierung nicht nur bestätigt, sondern es wurde vielmehr die explizite Vorteilhaftigkeit der Einnahmen durch Mitgliedsbeiträge hinsichtlich der Kriterien Besteuerung, Finanzierungsart und Optimierbarkeit sehr deutlich herausgearbeitet. Wie bereits erwähnt, soll die Bedeutung einer breit angelegten Finanzierung eines Großsportvereins hier keinesfalls gemindert werden. Ebenfalls wird nicht behauptet, dass eine optimale Beitragsstruktur die Erschließung weiterer finanzieller Ressourcen vermeiden kann. Die hier gewonnenen Erkenntnisse legen jedoch die These nahe, dass ein Versäumnis einer notwendigen Reform der bestehenden Beitragsstruktur erhebliche Auswirkungen auf die Finanzierung des Vereins haben kann. Werden Defizite, welche sich mit der Zeit eventuell ergeben haben nicht rechtzeitig erkannt, so könnte sich der prozentuale Anteil der Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen in einem unnötigen Ausmaß rückläufig entwickeln. Folglich würde die Finanzierung des jeweiligen Großsportvereins dann immer weniger den Kriterien Mitgliederorientierung, Autonomie und Solidarprinzip entsprechen.
Zudem kann festgehalten werden, dass, je größer die Defizite einer bestehenden Beitragsstruktur sind, eine derartige Reform einen entscheidenden Beitrag zur Lösung eventuell bestehender finanzieller Probleme eines Sportvereins darstellen kann. Sowohl die wissenschaftliche als auch die praktische Relevanz einer Beitragsstrukturreform kann abschließend als bestätigt betrachtet werden. Die Frage nach dem „warum“ ist nun geklärt und es kann im folgenden Kapitel der Frage nach dem „wie“ und somit nach den möglichen Methoden einer Beitragsstrukturreform nachgegangen werden.
3 Methodischer Zugang einer Beitragsstrukturreform
Im folgenden Kapitel geht es um den Untersuchungsaufbau, also um die methodische Vorgehensweise der durchgeführten Untersuchung. Aufgrund der herausgearbeiteten Besonderheiten der Finanzierung in Sportvereinen soll der methodische Aufbau hier nicht nur beschrieben, sondern etwas ausführlicher hergeleitet werden. Schwerpunkt dieser Betrachtung stehen die Kostenrechnung (Kapitel 3.1) und die Situationsanalyse (Kapitel 3.2). Zunächst werden jeweils die allgemeinen Grundlagen beider Methoden diskutiert und anschließend der explizite Untersuchungsaufbau dieser Arbeit erläutert.
3.1 Kostenrechnung und Beitragsgestaltung im Sportverein
Die finanzielle Situation ist ein grundlegendes Problem der Sportvereinigung Feuerbach ist. Deshalb ist es von großer Bedeutung die Beitragsgestaltung aus einer kostenorientierten Sichtweise zu betrachten. Hierfür bietet eine Kostenrechnung, deren allgemeine Grundlagen im Folgenden kurz dargestellt werden, eine geeignete Methode. Jedoch stellt sich die Frage in wieweit diese kostenorientierte Sichtweise auf gemeinnützige Sportvereine bei der Beitragsgestaltung und -bemessung übertragbar ist, ohne die Charakteristik des Vereins als Solidargemeinschaft zu gefährden. Daher soll die Übertragung der allgemeinen Grundlagen auf die Sportvereine kritisch betrachtet werden.
3.1.1 Grundlagen der Kosten- und Leistungsrechnung
Mit Hilfe einer Kosten- und Leistungsrechnung kann ein Betrieb den kalkulatorischen Erfolg der internen Betriebsprozesse berechnen und bewerten. Die Kosten- und Leistungsrechnung dient der internen Erfolgskontrolle der Organisation (Schierenbeck, 1999, S. 627). Gemäß dem Namen dieser Methode sind Kosten und Leistungen die relevanten Bestandsgrößen. Der Begriff „Kosten“ wird dabei definiert als „bewertete sachzielorientierte Güterverbräuche je Produktart, ausgewählter oder aller Produktarten eines Unternehmens einer Periode“ (Kloock, Groenevald, Maltry, 2005, S.117), während der Begriff „Leistungen“ die „bewertete sachzielorientierte Gütererstellungen je Produktart, ausgewählter oder aller Produktarten eines Unternehmens einer Periode“ (ebd.) beinhaltet. Anders ausgedrückt stellt sich bei der Berechnung der Kosten die Frage „Was kostet die Erstellung unserer Produkte oder Leistungen?“. Diese Kosten beinhalten beispielsweise Kosten der Produktionsmittelbeschaffung, Kosten für den Betrieb von Maschinen, oder Kosten für den Einsatz von Personal. Bei der Bewertung der Leistungen stellt sich die Frage „Was ist das erstellte Produkt bzw. die erstellte Leistung wert?“ Beide Bestandsgrößen werden mittels der Formel Wertkomponente x Mengenkomponente bewertet. Die drei Hauptaufgaben der Kosten- und Leistungsrechnung beschreibt Schierenbeck (1999) als:
- Ermittlung des kurzfristigen Betriebserfolgs
- Kontrolle der Wirtschaftlichkeit und Budgetierung
- Rechnerische Fundierung unternehmenspolitischer Entscheidungen
Während die ersten beiden Hauptaufgaben in dieser Arbeit eine untergeordnete Rolle spielen und daher nicht näher erläutert werden, beinhaltet die rechnerische Fundierung unternehmenspolitischer Entscheidung unter anderem „die Kalkulation von Preisen und Preisuntergrenzen“ (Schierenbeck, 1999, S.628) und ist daher auch von entscheidender Bedeutung für die Neubemessung von Mitgliedsbeiträgen in Großsportvereinen. Je nach Funktion der durchgeführten Kostenrechnung gibt es unterschiedliche Kostenrechnungssysteme, welche auf die jeweilige Aufgabe ausgerichtet sind.
Gemäß können Kostenrechnungen Schierenbeck (1999) als Ist-Kosten- (Kosten, welche in der Vergangenheit tatsächlich angefallen sind), Normal-Kosten- (durchschnittliche Werte der Ist-Kosten aus vergangenen Produktionsperioden) oder Plan-Kostenrechnung (Kosten, deren eintreten bzw. deren Höhe bereits vor Beginn einer Periode planbar sind) berechnet werden.
[...]
[1] Der Sportentwicklungsbericht 2005/2006 bezieht sich auf eine deutschlandweite Vereinsumfrage, deren Ergebnisse entsprechend den einzelnen Bundesländern ausgewertet wurden. Die hier dargestellten Ergebnisse beziehen sich vor allem auf die Untersuchungsergebnisse der Baden-Württembergischen Vereine.
- Quote paper
- Diplom Sportwissenschaftler Tobias Buss (Author), 2008, Finanzierung von Großsportvereinen dargestellt am Beispiel der Beitragsstrukturreform bei der Sportvereinigung Feuerbach 1883 e.V., Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/117145