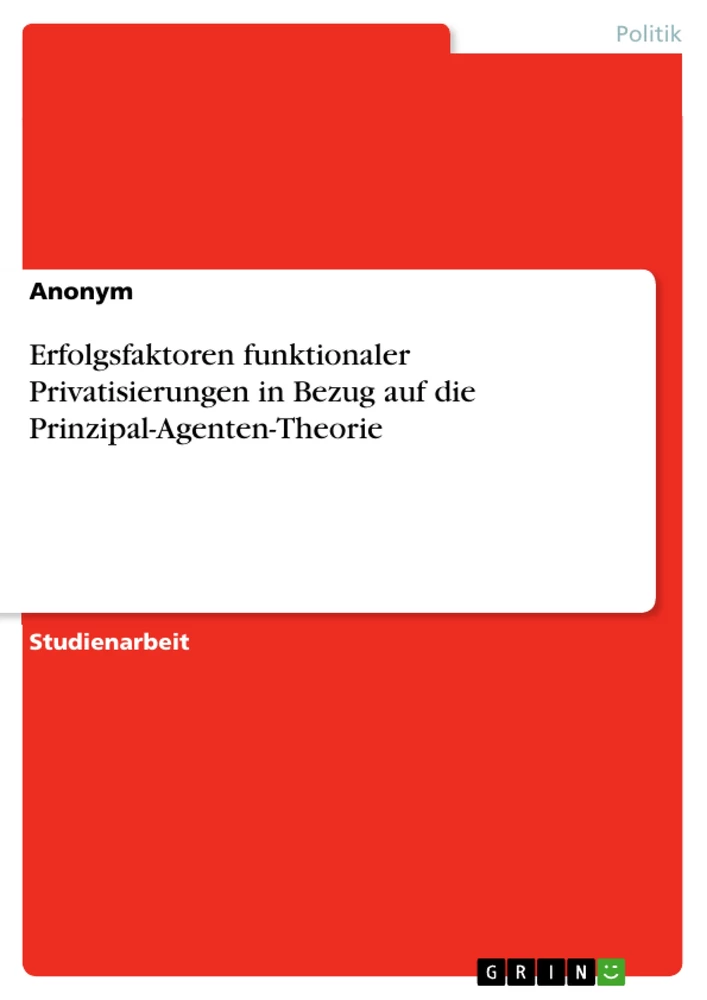Die Prinzipal-Agenten-Beziehung bei funktionalen Privatisierungen ist geprägt von Risiken, die überwiegend auf staatlicher Seite liegen. Mit der Aufgabenübertragung gehen Hoffnungen eines Effizienzgewinnes einher, die jedoch nicht automatisch erfüllt werden können. Daher stellt sich die Frage, wie die Übertragung zielführend und erfolgreich umgesetzt werden kann.
Ziel der Hausarbeit ist es, im Rahmen einer Literaturrecherche vor dem Hintergrund der Prinzipal-Agenten-Theorie Erfolgsfaktoren für eine erfolgreiche Durchführung herauszuarbeiten. Dazu erfolgt eine Abgrenzung zu anderen Privatisierungsformen und es werden Ziele der funktionalen Privatisierung dargestellt. Im Anschluss werden die Prinzipal-Agenten-Theorie erläutert und Schwierigkeiten in der Beziehung zwischen Auftraggebern und Auftragsnehmern dargestellt. Dies bildet die Grundlage für das Herausarbeiten von Erfolgsfaktoren der funktionalen Privatisierung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Privatisierungen
- Vermögensprivatisierung, formale Privatisierung und materielle Privatisierung
- Funktionale Privatisierung
- Ziele funktionaler Privatisierungen
- Prinzipal-Agenten-Theorie
- Merkmale einer Prinzipal-Agenten-Beziehung
- Probleme und Risiken in der Prinzipal-Agenten-Beziehung
- Interessenkonflikte
- Informationsasymmetrie
- Prinzipal-Agenten-Beziehung im öffentlichen Sektor
- Erfolgsfaktoren funktionaler Privatisierungen
- Erfolgsfaktoren zur Reduzierung von adverse selection
- Erfolgsfaktoren zur Reduzierung von moral hazard
- Anreizsysteme
- Kontrollsysteme
- Informationssysteme
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht die Erfolgsfaktoren funktionaler Privatisierungen im öffentlichen Sektor vor dem Hintergrund der Prinzipal-Agenten-Theorie. Ziel ist es, die Herausforderungen und Chancen dieser Privatisierungsform zu beleuchten und konkrete Handlungsempfehlungen für eine erfolgreiche Umsetzung zu entwickeln.
- Abgrenzung und Definition verschiedener Privatisierungsformen
- Analyse der Prinzipal-Agenten-Theorie im Kontext öffentlicher Aufgaben
- Identifizierung von Erfolgsfaktoren zur Reduzierung von Informationsasymmetrien und Interessenkonflikten
- Bewertung der Bedeutung von Anreiz-, Kontroll- und Informationssystemen für die Effizienz funktionaler Privatisierungen
- Zusammenhang zwischen funktionalen Privatisierungen und dem Gemeinwohl
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Hausarbeit vor und erläutert die Bedeutung funktionaler Privatisierungen im öffentlichen Sektor. Sie beleuchtet die Herausforderungen und Chancen, die mit der Delegation öffentlicher Aufgaben an private Akteure verbunden sind. Im zweiten Kapitel werden verschiedene Privatisierungsformen, wie Vermögensprivatisierung, formale Privatisierung und materielle Privatisierung, abgegrenzt und erklärt. Die funktionale Privatisierung wird dabei als eigenständige Form der Privatisierung hervorgehoben und von den anderen Formen abgegrenzt. Kapitel drei widmet sich der Prinzipal-Agenten-Theorie. Es werden die zentralen Merkmale der Prinzipal-Agenten-Beziehung dargestellt und die besonderen Herausforderungen im öffentlichen Sektor aufgezeigt. Kapitel vier beschäftigt sich mit den Erfolgsfaktoren funktionaler Privatisierungen. Anhand der Prinzipal-Agenten-Theorie werden Maßnahmen zur Reduzierung von adverse selection und moral hazard diskutiert. Es wird insbesondere auf die Bedeutung von Anreiz-, Kontroll- und Informationssystemen eingegangen.
Schlüsselwörter
Funktionale Privatisierung, Prinzipal-Agenten-Theorie, adverse selection, moral hazard, Anreizsysteme, Kontrollsysteme, Informationssysteme, öffentlicher Sektor, Effizienz, Gemeinwohl
- Quote paper
- Anonym (Author), 2020, Erfolgsfaktoren funktionaler Privatisierungen in Bezug auf die Prinzipal-Agenten-Theorie, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1169278