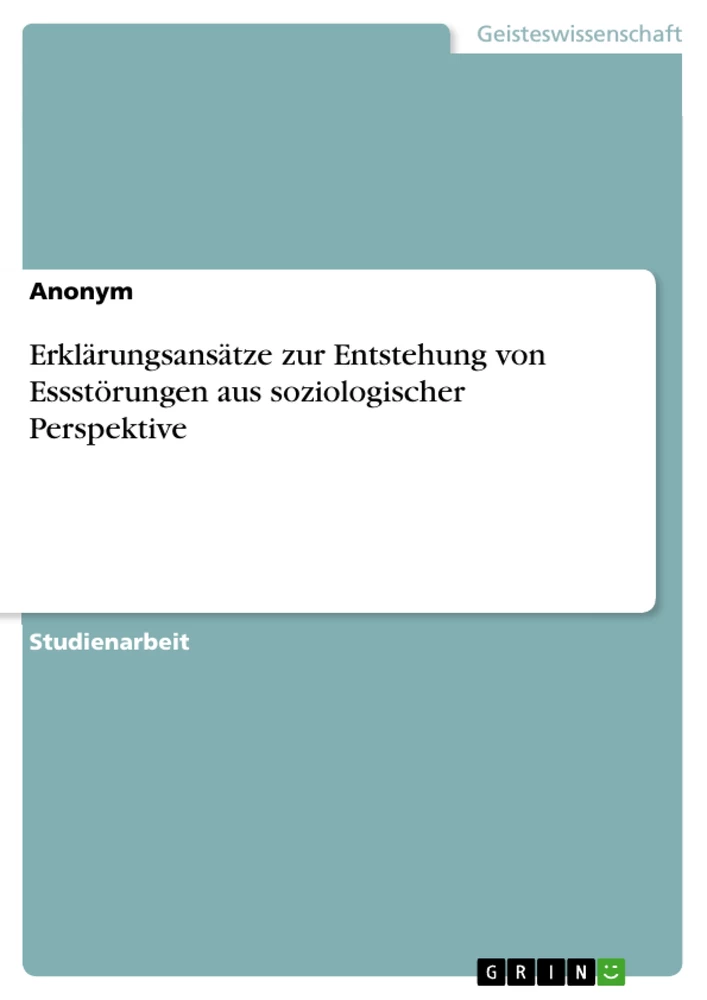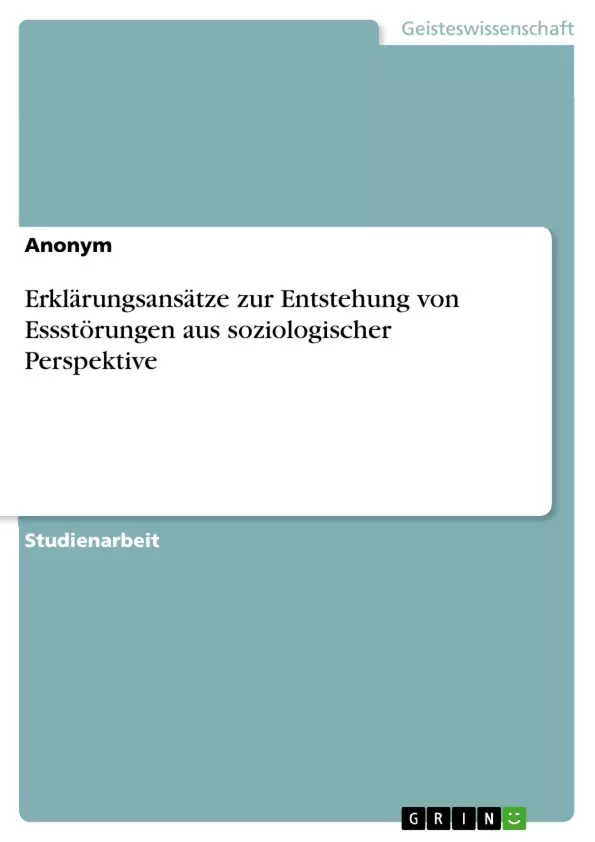Ziel dieser Arbeit ist, einen Überblick zur Thematik der Essstörungen Magersucht und Bulimie darzustellen. Außerdem soll die Sozialisationstheorie nach Hurrelmann begründet und Einflussfaktoren für Essstörungen anhand von den Sozialisationsinstanzen Peer Group, Medien und Körpersozialisation in Familien erklärt werden. Zu beachten ist, dass die Einflussfaktoren im Rahmen dieser Arbeit nur begrenzt und nicht vollständig dargestellt werden können. Es wird sich auf die soziologische Perspektive beschränkt. Zwar sind auch zunehmend Männer von der Erkrankung betroffen, dennoch sind die Hauptbetroffenen Mädchen und junge Frauen. Aufgrund dessen wird im Folgenden vorwiegend die weibliche Formulierung verwendet.
Inhaltsverzeichnis
1. Hintergrund
2. Methode
3. Definitionen
3.1. Essstörungen
3.2. Anorexia nervosa
3.3. Bulimia nervosa
4. Einflussfaktoren
4.1.Sozialisationstheorie nach Hurrelmann
4.2.Peer Group
4.3. Mediale Vermittlung von Schönheitsidealen
4.4. Körpersozialisation in Familienhaushalten
5. Fazit
6. Literaturverzeichnis
6.1. Internetquellen
1. Hintergrund
Mahlzeiten einnehmen ist für eine Vielzahl von Menschen etwas alltägliches und wird meist mit Genuss und Geselligkeit verbunden. Dennoch stellt es für mehr als 20% der Heranwachsenden von 11 bis 17 Jahren ein primäres Problem dar (vgl. Rieck et al., 2008, S.54).
In den westlichen Industrienationen herrscht seit einigen Jahrzehnten eine Überfluss-, Konsum- und Erlebnisgesellschaft. Seit diesem Zeitraum ist ebenso die Anzahl ernährungsbedingter Krankheiten gestiegen (vgl. Herter, 2019, S.7).
Essstörungen werden zunehmend von den Medien thematisiert und wissenschaftlich untersucht.
Als die bekanntesten Essstörungen gelten die Magersucht und die Bulimie. Es bestehen jedoch noch einige weitere, differenziertere Essstörungen, wie die Binge-Eating Disorder (BED) und die Eating Disorders Not Otherwise Specified (EDNOS - nicht näher klassifizierte Essstörungen) (vgl. Schuck, Schneider, 2019, S.9).
„Essstörungen sind ernstzunehmende psychosomatische Erkrankungen, die durch schwere Störungen des Essverhaltens und damit einhergehende körperliche Begleit- und Folgeerkrankungen gekennzeichnet sind.“(Schuck, Schneider, 2019, S.9).
Es stellt sich die Frage, inwiefern die Gesellschaft ihren Teil zu einem Fehlverhalten der Ernährung beiträgt und ob soziologische Auslösefaktoren zu einer Essstörung führen können.
Ziel dieser Arbeit ist, einen Überblick zur Thematik der Essstörungen Magersucht und Bulimie darzustellen. Außerdem soll die Sozialisationstheorie nach Hurrelmann begründet und Einflussfaktoren für Essstörungen anhand von den Sozialisationsinstanzen Peer Group, Medien und Körpersozialisation in Familien erklärt werden. Zu beachten ist, dass die Einflussfaktoren im Rahmen dieser Arbeit nur begrenzt und nicht vollständig dargestellt werden können. Es wird sich auf die soziologische Perspektive beschränkt.
Zwar sind auch zunehmend Männer von der Erkrankung betroffen, dennoch sind die Hauptbetroffenen Mädchen und junge Frauen.
Aufgrund dessen wird im Folgenden vorwiegend die weibliche Formulierung verwendet.
2. Methode
Für die vorliegende Seminararbeit mit dem Thema „ Erklärungssätze zur Entstehung von Essstörungen aus soziologischer Perspektive“ wurde sich primär auf Literatur aus der Privatbibliothek, der Universitätsbibliothek und der Stadtbibliothek bezogen.
Die digitale Literaturrecherche erfolgte über Google Scholar durch Nutzung der folgenden Schlüsselwörter: Essstörungen, Sozialisation Essverhalten, Auslöser und Ursachen Essstörungen, Arten der Essstörungen, Anorexia nervosa, und Bulimia nervosa.
Durch Literaturverweise in den bereits berücksichtigten Quellen konnten weitere Internet- und Literaturquellen gefunden werden.
Auf Basis der vorausgegangenen Datenlage werden daraufhin mögliche Ursachen aufgezeigt, welche für die Entwicklung von Essstörungen verantwortlich sein können.
3. Definitionen
Im folgenden Kapitel wird an erster Stelle der Begriff Essstörungen im Allgemeinen definiert. Anschließend werden die beiden Erkrankungen Anorexia nervosa (Magersucht) und Blumie nervosa (Ess-Brecht-Sucht) definiert und erklärt.
3.1. Essstörungen
Essstörungen äußern sich durch ein gestörtes Verhältnis zum Essen und zum eigenen Körper.
Sie sind multifaktoriell bedingte Erkrankungen, die durch verschiedene Risikofaktoren ausgelöst werden. Die Entwicklung von Essstörungen wird durch genetische, neurobiologische, familiäre, individuelle und soziokulturelle Einflüsse erklärt (vgl. Schuck, Schneider, 2019, S.12).
Ein Artikel vom Bundes Fachverband Essstörungen zeigt: Es gibt verschiedene Formen von Essstörungen, wobei Mischformen auftreten können und die Übergänge fließend sind. Essstörungen führen zu schwerwiegenden gesundheitlichen, seelischen und sozialen Folgen (vgl. o.V.,o.J.).
Zu den häufigsten Essstörungen zählen Anorexia nervosa (Magersucht), Bulimia nervosa (Ess-Brech-Sucht) und die Binge-Eating Störung (Essattacken). Unsere Gesellschaft erwartet ein gezügeltes Essverhalten, was zur Folge hat, dass Essverhalten kontrolliert werden will. Diese Kontrolle kann zum Beispiel durch Diäten erfolgen und ebnet oftmals den Weg zur Essstörung. Nicht jede Diät führt zwangsläufig zu einer Essstörung, hierfür müssen viele verschiedene Faktoren ineinandergreifen, damit solch eine Erkrankung entsteht (vgl. Klotter, 2017, S.149).
3.2. Anorexia nervosa
Anorexia nervosa oder auch Magersucht genannt, ist die am weitesten verbreitete Essstörung in Deutschland und umfasste im Jahr 2017 eine Anzahl diagnostizierter Fälle von rund 7.800 Menschen. Bei einer vorliegenden Erkrankung empfinden sich Betroffene selbst als zu dick, obwohl ein deutliches Untergewicht vorliegt. Dementsprechend versuchen sie immer weiter abzunehmen (vgl. Radtke, 2019).
Es handelt sich um eine Störung der eigenen Körperwahrnehmung, bei der panische Angst vor Übergewicht entwickelt wird. Die Nahrungsaufnahme stellt förmlich eine Gefahr für Betroffene dar. Jedoch führt der Verzicht nicht selten dazu, dass Magersüchtige sich bis zum Tode hungern. Bis zu 10% aller AnorektikerInnen sterben an den Folgen ihrer Erkrankung. Die Anorexia nervosa ist eine typische Erkrankung die in den Industrieländern und häufiger in den oberen sozialen Schichten auftritt, und unter der größtenteils junge Frauen leiden (vgl. Klotter, 2017, S.142).
Die Magersucht kennzeichnet sich durch ein abnorm niedriges Körpergewicht das entweder um 15 Prozent unter dem erwartenden Gewicht liegt oder einem BMI (Body Mass Index; Kilogramm geteilt durch Körpergröße in Metern im Quadrat) von 17,5 oder weniger entspricht (vgl. Backmund, Gerlinghoff, 2004, S.23).
3.3. Bulimia nervosa
Die Bulimia nervosa (Ess-Brech-Sucht) ist die am zweithäufigsten verbreitete Essstörung und wurde im Jahr 2017 an über 1.800 Fällen diagnostiziert.
Im Gegensatz zu den AnorektikerInnen, sind Bulimie-Erkrankte meist normalgewichtig und nicht eindeutig am äußeren Erscheinungsbild erkennbar. Eine typische BulimieErkrankung äußert sich durch einen, in kurzer Zeit übermäßigen Konsum an sehr viel Nahrung. Der Körper wird anschließend durch gegenregulatorische Maßnahmen, wie zum Beispiel Erbrechen, daran gehindert, die Kalorien aufnehmen zu können (vgl. Radtke, 2019).
Man kann sagen, die Bulimia nervosa ist eine „Modeerkrankung“, eine typische Erkrankung der heutigen Zeit , da die Erkrankung einen Nahrungsüberfluss voraussetzt. Verbunden ist sie mit dem Schlankheitsideal, mit der Angst vor der Gewichtszunahme, mit Versuchen der Kontrolle des Essverhaltens, mit Heißhungerattacken und mit dem Kampf nicht übergewichtig und dementsprechend unattraktiv zu sein.
Nicht auf alle Bulimie-Erkrankten treffen die genannten Merkmale zu. Es können auch unterschiedliche Konstellationen sein. Heißhungerattacken müssen nicht zwangsläufig mit dem Versuch der Kontrolle des Essverhaltens verknüpft sein. Einige Betroffene erbrechen nicht primär zur Gewichtsregulation, sondern empfinden dies vor allem als Reinigung für den eigenen Körper (vgl. Klotter, 2017, S.126-129).
Auch bei dieser Krankheit liegt das weibliche Geschlecht mit 90% vor dem männlichen Geschlecht. Allgemein wird davon ausgegangen, dass ca. 1 bis 3% junger Frauen, die zwischen 17-35 Jahre alt sind, davon betroffen sind (vgl. Klotter, 2017, S.126-129).
4. Einflussfaktoren
Im nächsten Kapitel wird vorab die Sozialisationstheorie nach Hurrelmann dargelegt, um danach einen Zusammenhang zu den Sozialisationsinstanzen Peer Group, Medien und Familienhaushalte zu erlangen.
4.1. Sozialisationstheorie nach Hurrelmann
Die Sozialisationstheorie ist eine teils soziologisch, teils psychologische Denkrichtung, die sich mit der genetischen Ausstattung des Menschen, mit dessen Trieben, Bedürfnissen und Persönlichkeitsmerkmalen befasst. Hierbei geht es auch darum, wie der Mensch sich zu einem selbstständigen Subjekt mithilfe von Selbstreflexion entwickelt und dabei Anforderungen von Kultur, Ökonomie und ökologische Umwelt bewältigt (vgl. Hurrelmann, Richter, 2013, S.129).
„Sozialisation bezeichnet den Prozess, in dessen Verlauf sich der mit einer biologischen Ausstattung versehene menschliche Organismus zu einer sozial handlungsfähigen Persönlichkeit bildet, die sich über den Lebenslauf hinweg in Auseinandersetzung mit den Lebensbedingungen weiterentwickelt. Sozialisation ist eine lebenslange Aneignung von und Auseinandersetzung mit den natürlichen Anlagen, insbesondere den körperlichen und psychischen Grundmerkmalen, die für den Menschen die ,innere Realität' bilden, und der sozialen und physikalischen Umwelt, die für den Menschen die ,äußere Realität' bilden.“ (Hurrelmann, 2006, S.15, zitiert nach Hurrelmann, 2013, S. 129).
Hurrelmann (2012) und Dippelhofer-Stiem (2013) beschreiben, dass ein Gelingen dieser Auseinandersetzung, zu einer guten Voraussetzung für die weitere Entwicklung der Persönlichkeit auf allen Ebenen und damit auch positive Impulse für die Gesundheitsdynamik gegeben ist. Misslingt die Auseinandersetzung, entsteht eine negative Dynamik mit Krankheitsrisiken.
Die Entwicklungsaufgaben im körperlichen, psychischen, sozialen und ökologischen Bereich müssen jeweils mit Unterstützung der sozialen Umwelt, welche unter anderem gezielte Bildungsimpulse bedeuten, angemessen bewältigt werden, damit positive Impulse für die Persönlichkeitsentwicklung und somit eine Gesundheitsdynamik entstehen kann.
Gegenteilig lässt sich sagen, dass es zu einer Krankheitsdynamik kommen kann, wenn unangemessene Formen der Bewältigung mit negativen Impulsen für die weitere Persönlichkeitsentwicklung stattfinden. (vgl. Hurrelmann, 2012, S.131 zitiert nach Hurrelmann, 2013, S.129)
Dies kann ein Erklärungsansatz dafür sein, dass das Risiko für eine Essstörung höher ist, wenn eine gescheiterte Bewältigung mit negativen Impulsen für die Persönlichkeitsentwicklung eines Kindes oder Jugendlichen stattgefunden hat.
4.2. Peer Group
Als Peer Group bezeichnet man eine soziale Gruppe von Gleichaltrigen, in der sich das Individuum gemeinsame Werte, Einstellungen und Verhaltensweisen aneignet (vgl. Kirchgeorg, 2018).
In diesem System findet eine soziale Positionierung statt, das heißt, auch eine gesellschaftliche Platzierung über Inszenierung der eigenen Person und Entfaltung von Kompetenzen, die wiederum eng mit dem Selbstbild verknüpft sind (vgl. Bartsch, 2008, S.73).
Jugendliche bemerken die Veränderungen des eigenen Körpers während der Pubertät. Der „neue“ Körper kann für einige Jugendliche fremd erscheinen, sodass sie zuerst lernen müssen, ihn anzunehmen und zu akzeptieren. Die Orientierung an ein Idealbild des Körpers beginnt bei Kindern bereits ab dem 8. Lebensjahr (vgl. Fend 2000, S.22, zitiert nach Bartsch, 2008, S.86).
[...]
- Quote paper
- Anonym (Author), 2019, Erklärungsansätze zur Entstehung von Essstörungen aus soziologischer Perspektive, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1147668