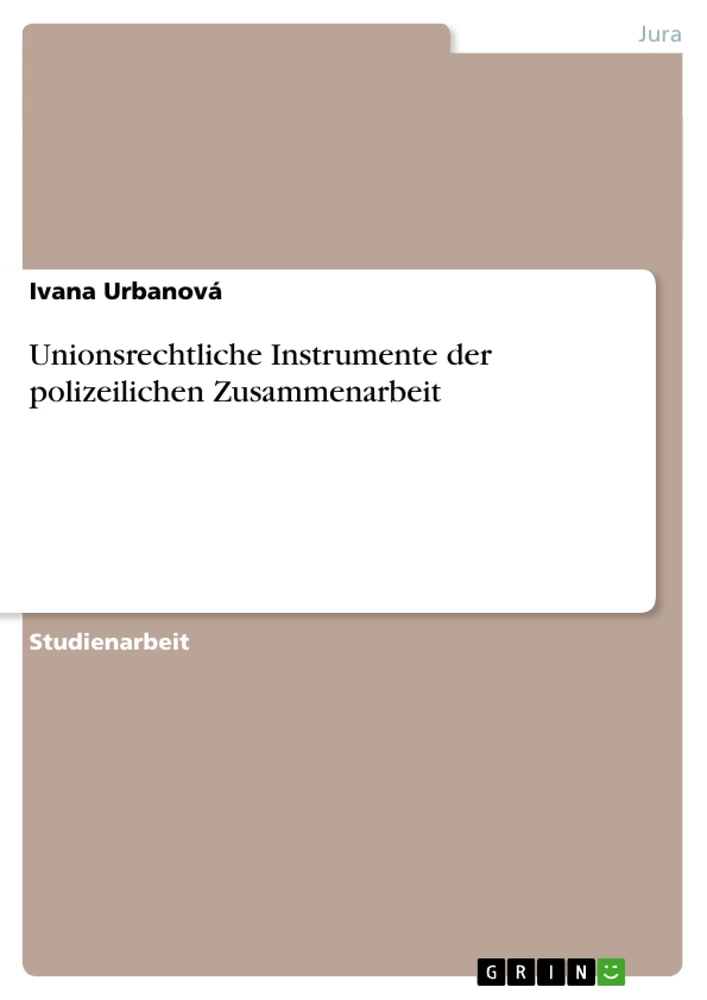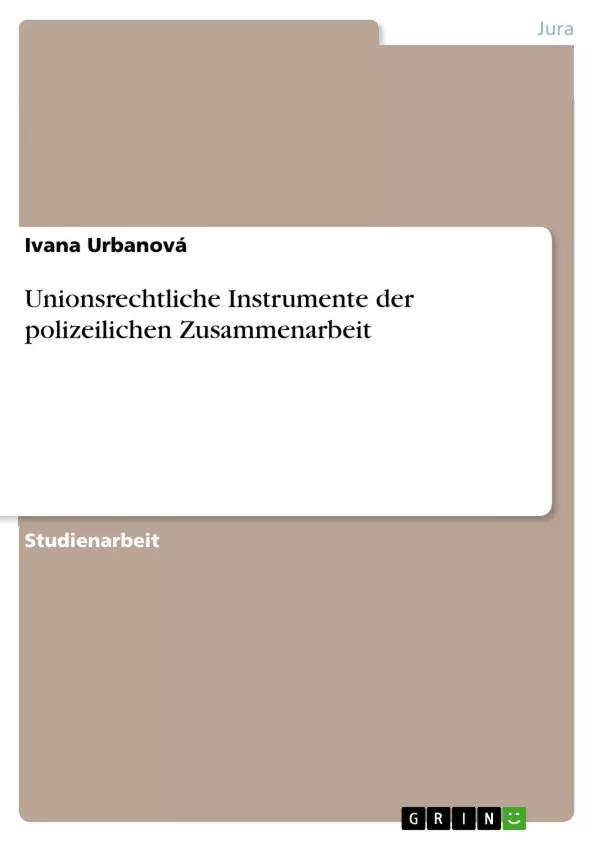Die Zusammenarbeit der EU-Länder in den Bereichen Inneres und Justiz erfolgt außerhalb der EU im Rahmen der zwischen-staatlichen Zusammenarbeit.Dabei geht es z.B. um:ein gemeinsames Vorgehen bei der Verhütung und Bekämpfung von Schwerstkriminalität und Rassismus, die Erleichterung und Beschleunigung von Gerichtsverfahren und Auslieferungen zwischen den Mitgliedstaaten, die Festlegung von Mindestvorschriften über die Tatbestandsmerkmale strafbarer Handlungen und so fort.Darüber hinaus sollte die europäische Zusammenarbeit auch die Polizeien in Europa umfassen, um die Sicherheit aller Bürger zu verbessern. Im Fokus der folgenden Arbeit stehen die unionsrechtlichen Instrumente der polizeilichen Zusammenarbeit. Die Europäische Union will dadurch ein Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts und nicht ein Raum für illegalen Handel jeglicher Art sein. Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union können bestimmte Kriminalitätsformen nicht mehr allein bekämpfen, sondern müssen zusammenarbeiten. Für diese Zusammenarbeit wenden sie die unionsrechtliche Instrumente der polizeilichen Zusammenarbeit an.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. EU als Raum der Freiheit, Sicherheit und Rechts
- I.1. Die Entwicklung der polizeilichen Zusammenarbeit in Europa
- I.1.1. TREVI
- I.1.2. GAM`92, CELAD, Koordinationsgruppe Freizügigkeit, Ad-hoc-Gruppe „Einwanderung“
- I.1.3. Die Entwicklung der polizeilichen Kooperation im Rahmen von Schengen
- I.2. Polizeiliche Zusammenarbeit in den Verträgen
- I.2.1. Vertrag von Maastricht
- I.2.2. Vertrag von Amsterdam
- Exkurs Europol
- I.2.3. Der europäische Rat von Tampere
- I.2.4. Vertrag vom Nizza
- I.1. Die Entwicklung der polizeilichen Zusammenarbeit in Europa
- II. Die polizeiliche Zusammenarbeit
- II.1. Die Instrumente der polizeilichen Zusammenarbeit
- II.1.2. Die Gemeinsamen Standpunkte
- II.1.3. Rahmenbeschlüsse und Beschlüsse
- II.1.4. Übereinkommen
- II.1.5. Entschließungen, Empfehlungen, Erklärungen, Schlussfolgerungen
- II.2. Die polizeiliche Zusammenarbeit am Beispiel der Schengen-Abkommen
- II.2.1. Instrumente im Schengen
- II.2.1.1. Länderübergreifende Observation
- II.2.1.2. Die Nacheile
- II.2.1.3. Andere Kooperationsformen
- II.2.2. Regelungsgegenstände des Schengener Durchführungsübereinkommens
- II.2.3. Instrumente im Schengener Informationssystem (SIS)
- II.2.4. Zusammenarbeit der Zollbehörden
- II.2.5. EFNOPOL
- II.2.1. Instrumente im Schengen
- II. 3.1. Gegenwärtige Aktivitäten auf dem Gebiet
- II.3.2. Gegenwärtige Programme
- II.1. Die Instrumente der polizeilichen Zusammenarbeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den unionsrechtlichen Instrumenten der polizeilichen Zusammenarbeit in der Europäischen Union. Sie analysiert die Entwicklung der polizeilichen Zusammenarbeit in Europa und die Rolle der Polizei im Rahmen des Bereiches Justiz und Inneres. Die Arbeit untersucht die verschiedenen Instrumente der polizeilichen Zusammenarbeit, einschließlich der Gemeinsamen Standpunkte, Rahmenbeschlüsse, Übereinkommen und Entschließungen, sowie deren Anwendung im Kontext des Schengener Abkommens. Darüber hinaus werden aktuelle Programme und Aktivitäten im Bereich der polizeilichen Zusammenarbeit beleuchtet.
- Entwicklung der polizeilichen Zusammenarbeit in der EU
- Regulierung der polizeilichen Zusammenarbeit durch EU-Recht
- Instrumente der polizeilichen Zusammenarbeit
- Zusammenarbeit im Rahmen von Schengen
- Aktuelle Programme und Aktivitäten in der polizeilichen Zusammenarbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung bietet einen Überblick über die Thematik der Arbeit und erläutert die Struktur und den Aufbau des Textes. Kapitel I analysiert die Europäische Union als Raum der Freiheit, Sicherheit und Rechts und beleuchtet die Entwicklung der polizeilichen Zusammenarbeit in Europa. Die Kapitel I.1.1 bis I.1.3 befassen sich mit verschiedenen Phasen der Entwicklung der polizeilichen Zusammenarbeit in Europa, von TREVI bis hin zu den Anfängen des Schengener Abkommens. Kapitel I.2 untersucht die Regulierung der polizeilichen Zusammenarbeit durch verschiedene EU-Verträge, darunter der Vertrag von Maastricht, der Vertrag von Amsterdam, der Vertrag von Nizza und der europäische Rat von Tampere. Kapitel II widmet sich den Instrumenten der polizeilichen Zusammenarbeit und deren Anwendung. Die Kapitel II.1.2 bis II.1.5 stellen die verschiedenen Instrumente der polizeilichen Zusammenarbeit, wie Gemeinsamen Standpunkte, Rahmenbeschlüsse und Übereinkommen, vor. Kapitel II.2 konzentriert sich auf die polizeiliche Zusammenarbeit im Rahmen von Schengen und analysiert verschiedene Instrumente, darunter die länderübergreifende Observation, die Nacheile, andere Kooperationsformen, sowie die Regelungsgegenstände des Schengener Durchführungsübereinkommens. Kapitel II.2.3 und II.2.4 befassen sich mit dem Schengener Informationssystem und der Zusammenarbeit der Zollbehörden. Kapitel II.2.5 behandelt EFNOPOL. Kapitel II.3.1 und II.3.2 beleuchten aktuelle Aktivitäten und Programme im Bereich der polizeilichen Zusammenarbeit.
Schlüsselwörter
Unionsrecht, polizeiliche Zusammenarbeit, Europäische Union, Schengen, Freizügigkeit, Sicherheit, Rechtsstaatlichkeit, Instrumente, Gemeinsame Standpunkte, Rahmenbeschlüsse, Übereinkommen, Entschließungen, EFNOPOL, SIS, Zollbehörden, gegenwärtige Aktivitäten, Programme.
- Arbeit zitieren
- Ivana Urbanová (Autor:in), 2003, Unionsrechtliche Instrumente der polizeilichen Zusammenarbeit, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/11399