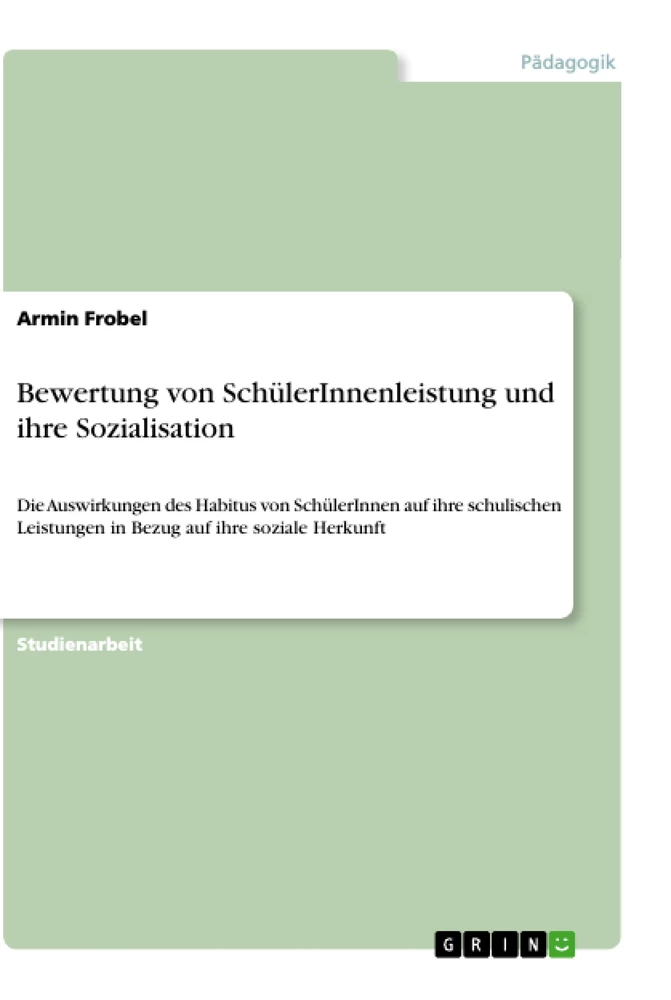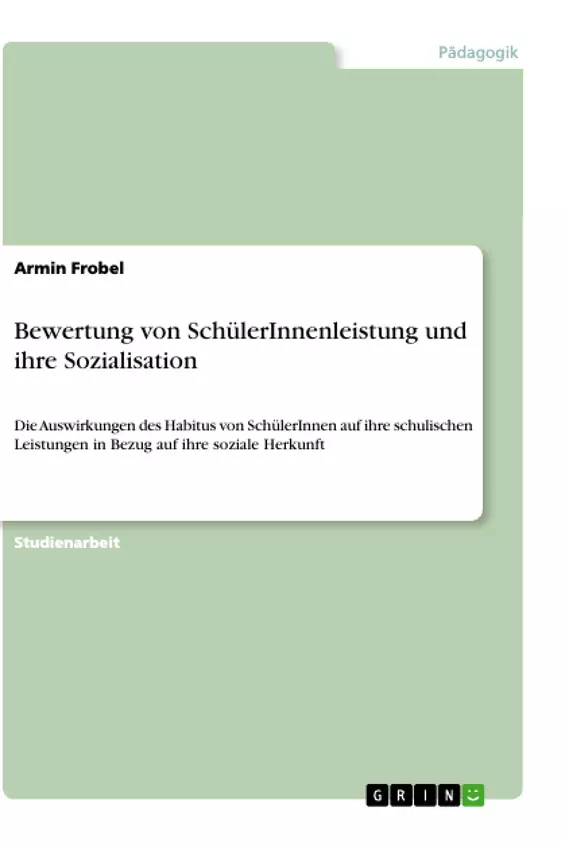In der Arbeit soll mit Blick auf die Institution Schule und ihre Funktionsweise wie auch auf Strategien von LehrerInnen, Eltern und SchülerInnen dargestellt werden, wieso Habitus, Schichtzugehörigkeit und andere äußerliche Effekte für die Leistungsbewertung, wie wir sie kennen, von größerer Bedeutung sind als die vollbrachten Leistungen der SchülerInnen an sich.
Dafür ist es notwendig, zuallererst die Begriffe Leistung, Habitus und Sozialisation mit allen für diese Arbeit erforderlichen Merkmalen zu klären. Im weiteren Verlauf geht es dann darum, die Schule als strukturgebenden Handlungsraum und vor allem die selektiven Momente darzustellen. Darauffolgend richtet sich der Fokus der Arbeit auf die Akteure, das heißt die LehrerInnen, Eltern und SchülerInnen und deren Strategien und die daraus folgenden Effekte in Bezug auf die Leistung der SchülerInnen im schulischen Alltag. Am Ende der Arbeit wird der Zusammenhang zwischen dem theoretischen Teil und den erläuterten Praktiken zusammengefasst und Rückbezug auf den Bildungsbericht genommen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Leistung im schulischen Kontext
- Soziales Milieu, Habitus und Sozialisationstheorie nach Bourdieu
- Institution Schule als Handlungsraum
- Leistungsbewertung von Lehrerinnen und Bezug zum Habituskonzept
- Sprache von privilegierten und nicht privilegierten SchülerInnen
- Strategien und Praktiken von privilegierten und nicht privilegierten SchülerInnen
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den Einfluss des Habitus von Schülerinnen auf ihre schulischen Leistungen in Bezug auf ihre soziale Herkunft. Die Analyse basiert auf Pierre Bourdieus Theorie des Habitus und zeigt, wie die Institution Schule, die Leistungsbewertung von Lehrerinnen und die Strategien von Schülerinnen durch den Habitus beeinflusst werden. Ziel ist es, die Rolle des Habitus für die Reproduktion von Ungleichheit im Bildungssystem aufzuzeigen.
- Die Bedeutung des Habitus für die schulische Leistungsentwicklung
- Die Auswirkungen der sozialen Herkunft auf den Habitus von Schülerinnen
- Die Rolle der Institution Schule als Reproduktionsort sozialer Ungleichheit
- Die Selektivität der Leistungsbewertung im schulischen Kontext
- Strategien von Schülerinnen im Umgang mit schulischen Anforderungen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung führt in die Thematik ein und beleuchtet die aktuelle Situation des deutschen Bildungssystems. Der Bildungsbericht 2018 wird als Grundlage für die Analyse herangezogen, um die Bedeutung von Chancengleichheit im Bildungsbereich zu beleuchten. Die Arbeit setzt sich zum Ziel, die Bedeutung des Habitus, der sozialen Herkunft und weiterer äußerer Effekte für die schulische Leistungsbewertung zu untersuchen.
- Leistung im schulischen Kontext: Dieses Kapitel definiert den Begriff "Leistung" im schulischen Kontext und untersucht die pädagogischen und psychologischen Dimensionen. Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung von Normen, Selbsteinschätzung und der individuellen Lernentwicklung für die Beurteilung von Leistung. Darüber hinaus werden die Funktionen der Notengebung im schulischen Kontext und die Herausforderungen, die mit der Objektivität von Leistungsmessungen verbunden sind, diskutiert.
- Soziales Milieu, Habitus und Sozialisationstheorie nach Bourdieu: Dieses Kapitel stellt Pierre Bourdieus Theorie des Habitus vor und erklärt, wie dieser durch die soziale Herkunft geprägt wird. Die Arbeit untersucht, wie der Habitus das Verhalten von Schülerinnen und ihre Interaktion mit dem Bildungssystem beeinflusst.
- Institution Schule als Handlungsraum: Dieser Abschnitt betrachtet die Institution Schule als einen Handlungsraum, der durch spezifische Strukturen und Normen geprägt ist. Die Arbeit analysiert, wie diese Strukturen und Normen den Habitus von Schülerinnen beeinflussen und die Reproduktion sozialer Ungleichheit fördern können.
- Leistungsbewertung von Lehrerinnen und Bezug zum Habituskonzept: Dieses Kapitel untersucht die Rolle der Lehrerinnen bei der Bewertung von Schülerleistungen und analysiert, wie der Habitus von Lehrerinnen die Bewertungsprozesse beeinflussen kann. Die Arbeit zeigt auf, wie subjektive Bewertungen und Vorurteile den objektiven Leistungsstand von Schülerinnen verschleiern können.
- Sprache von privilegierten und nicht privilegierten SchülerInnen: Dieser Abschnitt befasst sich mit den sprachlichen Fähigkeiten von Schülerinnen aus unterschiedlichen sozialen Milieus. Die Arbeit untersucht, wie sprachliche Unterschiede die Leistungsbewertung beeinflussen können und wie der Habitus die Sprachentwicklung von Schülerinnen prägt.
- Strategien und Praktiken von privilegierten und nicht privilegierten SchülerInnen: Dieses Kapitel analysiert die Strategien und Praktiken, die Schülerinnen aus unterschiedlichen sozialen Milieus im schulischen Alltag entwickeln. Die Arbeit zeigt auf, wie der Habitus das Verhalten von Schülerinnen im Klassenzimmer prägt und wie diese Strategien die Reproduktion sozialer Ungleichheit beeinflussen können.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Habitus, soziale Herkunft, schulische Leistungen, Leistungsbewertung, Institution Schule, Reproduktion von Ungleichheit, Bildungssystem, Bildungsbericht, Chancengleichheit und die Theorie von Pierre Bourdieu.
- Quote paper
- Armin Frobel (Author), 2020, Bewertung von SchülerInnenleistung und ihre Sozialisation, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1132616