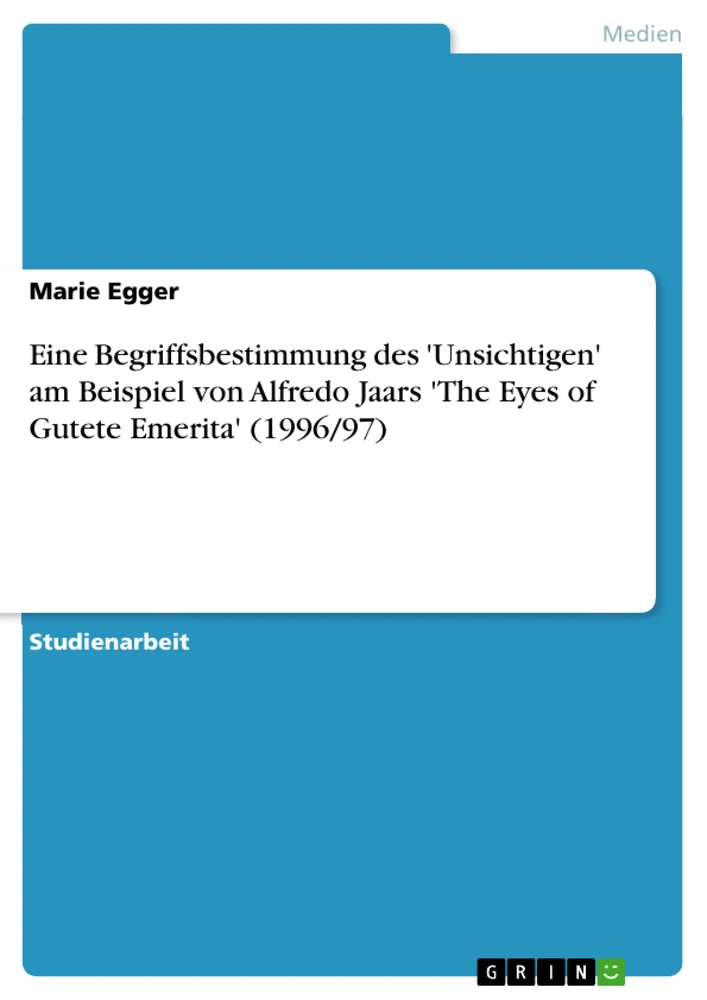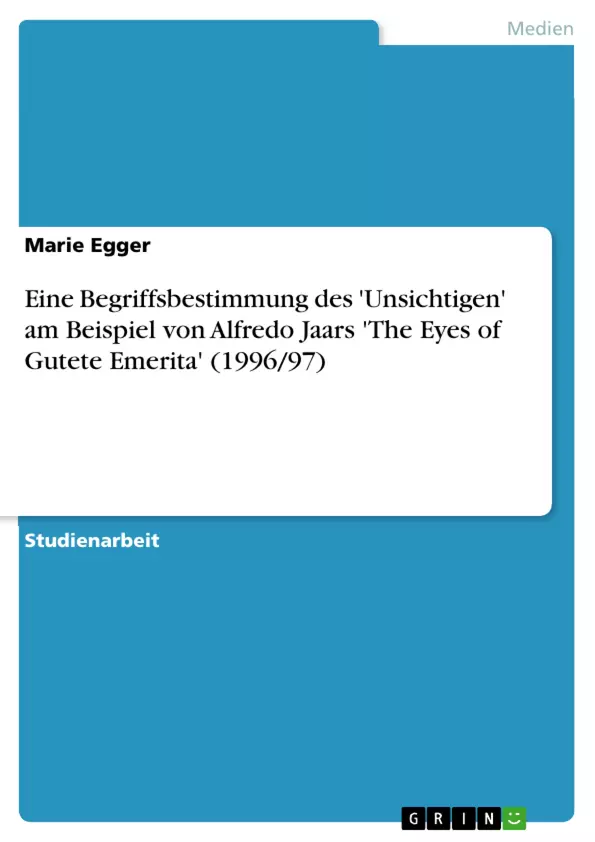Am 13. Dezember 2020 referierte ich im Blockseminar "Auge und Avantgarde" am Kunsthistorischen Institut der Freien Universität Berlin über "The Eyes of Gutete Emerita". Ich konzentrierte mich auf das Verhältnis von Text und Bild, das aus der Lektüren als wesentliches Kennzeichen des Werks hervorgegangen war und stieß zudem auf den Begriff des "Unsichtigen" des Kunsthistorikers Peter Geimer. Diese Arbeit nimmt ihn genauer unter die Lupe, um die Ästhetisierung von Gewalt durch die Verknüpfung von Text und Bild in "The Eyes of Gutete Emerita" besser zu verstehen.
Den ersten Teil meiner Hausarbeit leitet die Frage danach, wie dieses Unsichtige definiert werden kann. Dazu lese ich Geimers Artikel eng nach: Er bezieht sich auf Edmund Husserls "Logische Untersuchungen", auf den Aufsatz "Sehen. Hermeneutische Reflexionen" von Gottfried Boehm und auf Georges Didi-Hubermans Publikation "Bilder trotz allem". Diese drei Theorien des Sehens werden konsultiert, um Geimers Wortwahl nachzuvollziehen und das Unsichtige definitorisch zu konturieren. Letzteres schließt ein Zwischenfazit ab.
Der zweite Teil wendet den Begriff auf Jaars Installation "The Eyes of Gutete Emerita" an. Er fragt danach, was Blick und Ansicht, sowie Bild und Text mit dem Unsichtigen zu tun haben und was der Begriff zu ethischen Debatten des Zeigens bzw. Nicht-Zeigens von Gewaltbildern beitragen kann. Dabei folgt die Argumentation Geimers Schwerpunktsetzungen auf phänomenologische und ethische Implikationen der Sichtbarmachung.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Hauptteil
- 2.1. Das „Unsichtige“
- 2.1.1. Peter Geimer: Gegensichtbarkeiten, 2006
- 2.1.2. Begriffsbestimmung anhand verschiedener Theorien des Sehens
- 2.1.2.1. Edmund Husserl: Logische Untersuchungen, Bd. 2/1, 1901
- 2.1.2.2. Gottfried Boehm: Sehen, 1997
- 2.1.2.3. Georges Didi-Huberman: Images malgré tout, 2003
- 2.1.3. Zwischenfazit
- 2.2. Das „Unsichtige“ in The Eyes of Gutete Emerita, 1996/1997
- 2.2.1. Von Blickwinkel und Ansicht zum „Unsichtigen“
- 2.2.2. Textlich vermittelte Versionen des „Unsichtigen“
- 2.2.3. Das „Unsichtige“ im „Antlitz“ Emeritas
- 2.1. Das „Unsichtige“
- 3. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Alfredo Jaars Installation „The Eyes of Gutete Emerita“ im Kontext des Begriffs „Unsichtiges“, wie er von Peter Geimer definiert wird. Ziel ist es, die Darstellung von Gewalt durch die Verknüpfung von Text und Bild zu analysieren und den Beitrag des „Unsichtigen“ zu dieser Darstellung zu erörtern. Die Arbeit stützt sich auf phänomenologische Theorien des Sehens und ethische Implikationen der Sichtbarmachung von Gewalt.
- Definition des „Unsichtigen“ anhand verschiedener Theorien des Sehens
- Analyse der Bild-Text-Kombination in „The Eyes of Gutete Emerita“
- Die Rolle des „Unsichtigen“ in der Darstellung von Trauma und Gewalt
- Ethische Implikationen des Zeigens und Nicht-Zeigens von Gewalt
- Der Kontext des Rwanda-Projekts und seine globale politische Bedeutung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt Alfredo Jaars Installation „The Eyes of Gutete Emerita“ (1996), bestehend aus Text und Foto, die in zwei Leuchtkästen präsentiert wird. Der Text schildert die Erfahrung von Gutete Emerita, die den Mord ihrer Familie während einer Messe miterlebt. Die Einleitung führt die zentrale Forschungsfrage ein: Wie kann das „Unsichtige“ in der Darstellung von Gewalt in Jaars Werk definiert und analysiert werden? Die Arbeit kündigt die Auseinandersetzung mit Geimers Begriff des „Unsichtigen“ und dessen Anwendung auf Jaars Installation an.
2. Hauptteil: Der Hauptteil gliedert sich in zwei Abschnitte. Der erste Abschnitt konzentriert sich auf die Begriffsbestimmung des „Unsichtigen“. Hierbei werden die Theorien des Sehens von Husserl, Boehm und Didi-Huberman herangezogen, um Geimers Konzept zu erläutern und zu präzisieren. Der zweite Abschnitt wendet den Begriff des „Unsichtigen“ auf Jaars Installation an. Er untersucht die Beziehung zwischen Blick, Ansicht, Bild und Text im Werk, sowie die ethischen Fragen, die sich aus der Darstellung von Gewalt ergeben. Die Analyse beleuchtet, wie Jaar Trauma, Leid und Versagen durch die Auswahl und Anordnung von Bild und Text sichtbar und zugleich unsichtbar macht.
Schlüsselwörter
Alfredo Jaar, The Eyes of Gutete Emerita, Unsichtiges, Gewalt, Bild, Text, Sehen, Phänomenologie, Ethik der Darstellung, Rwanda-Projekt, Trauma.
Häufig gestellte Fragen zu "The Eyes of Gutete Emerita" - Analyse des Unsichtbaren
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese akademische Arbeit analysiert Alfredo Jaars Installation „The Eyes of Gutete Emerita“ (1996/1997) unter besonderer Berücksichtigung des Begriffs des „Unsichtigen“, wie er von Peter Geimer definiert wird. Im Fokus steht die Darstellung von Gewalt durch die Kombination von Text und Bild und die Rolle des „Unsichtigen“ in dieser Darstellung.
Welche Theorien werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf phänomenologische Theorien des Sehens, insbesondere auf die Werke von Edmund Husserl (Logische Untersuchungen), Gottfried Boehm (Sehen) und Georges Didi-Huberman (Images malgré tout), um den Begriff des „Unsichtigen“ zu definieren und zu präzisieren. Diese Theorien werden verwendet, um Geimers Konzept zu erläutern und auf Jaars Installation anzuwenden.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen Hauptteil und ein Fazit. Der Hauptteil ist in zwei Abschnitte unterteilt: Der erste Abschnitt befasst sich mit der Begriffsbestimmung des „Unsichtigen“ anhand der genannten Theorien. Der zweite Abschnitt analysiert die Bild-Text-Kombination in „The Eyes of Gutete Emerita“, untersucht die Beziehung zwischen Blick, Ansicht, Bild und Text und erörtert die ethischen Implikationen der Darstellung von Gewalt.
Was ist die zentrale Forschungsfrage?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Wie kann das „Unsichtige“ in der Darstellung von Gewalt in Jaars Werk definiert und analysiert werden?
Welche Aspekte von "The Eyes of Gutete Emerita" werden analysiert?
Die Analyse umfasst die Untersuchung der Bild-Text-Kombination, die Rolle des „Unsichtigen“ in der Darstellung von Trauma und Gewalt, die ethischen Implikationen des Zeigens und Nicht-Zeigens von Gewalt sowie den Kontext des Rwanda-Projekts und seine globale politische Bedeutung.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Alfredo Jaar, The Eyes of Gutete Emerita, Unsichtiges, Gewalt, Bild, Text, Sehen, Phänomenologie, Ethik der Darstellung, Rwanda-Projekt, Trauma.
Welche Kapitel gibt es und worum geht es darin?
Die Einleitung stellt Jaars Installation vor und formuliert die Forschungsfrage. Der Hauptteil analysiert den Begriff des „Unsichtigen“ und wendet ihn auf die Installation an. Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Darstellung von Gewalt in „The Eyes of Gutete Emerita“ zu analysieren und den Beitrag des „Unsichtigen“ zu dieser Darstellung zu erörtern. Es geht um die Untersuchung der Verknüpfung von Text und Bild und die ethischen Implikationen dieser Darstellung.
- Arbeit zitieren
- Marie Egger (Autor:in), 2021, Eine Begriffsbestimmung des 'Unsichtigen' am Beispiel von Alfredo Jaars 'The Eyes of Gutete Emerita' (1996/97), München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1130851