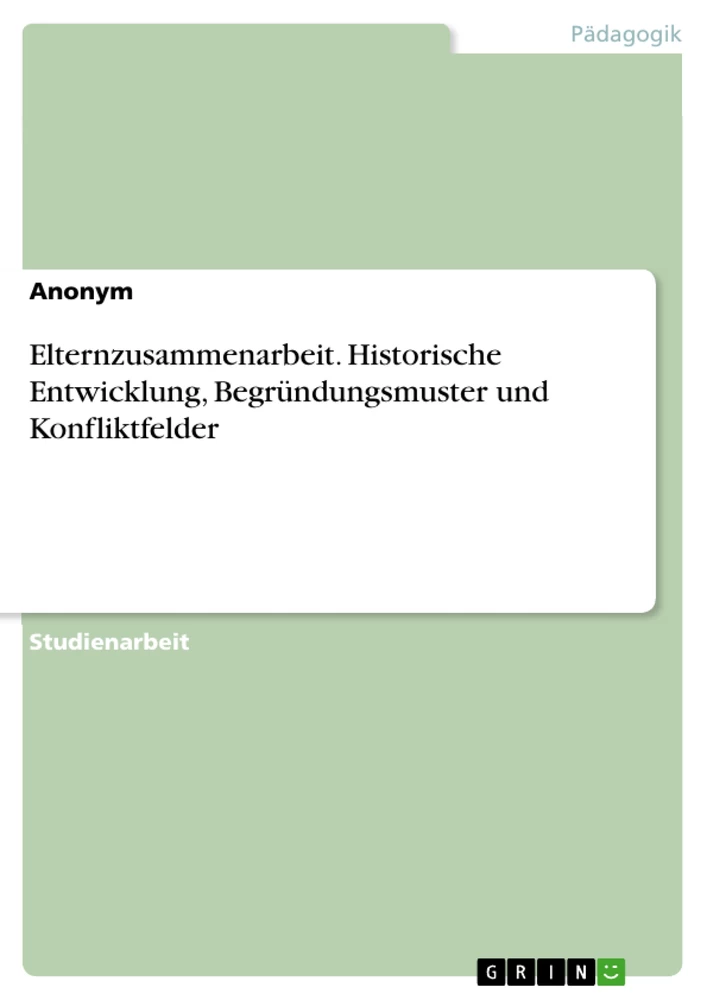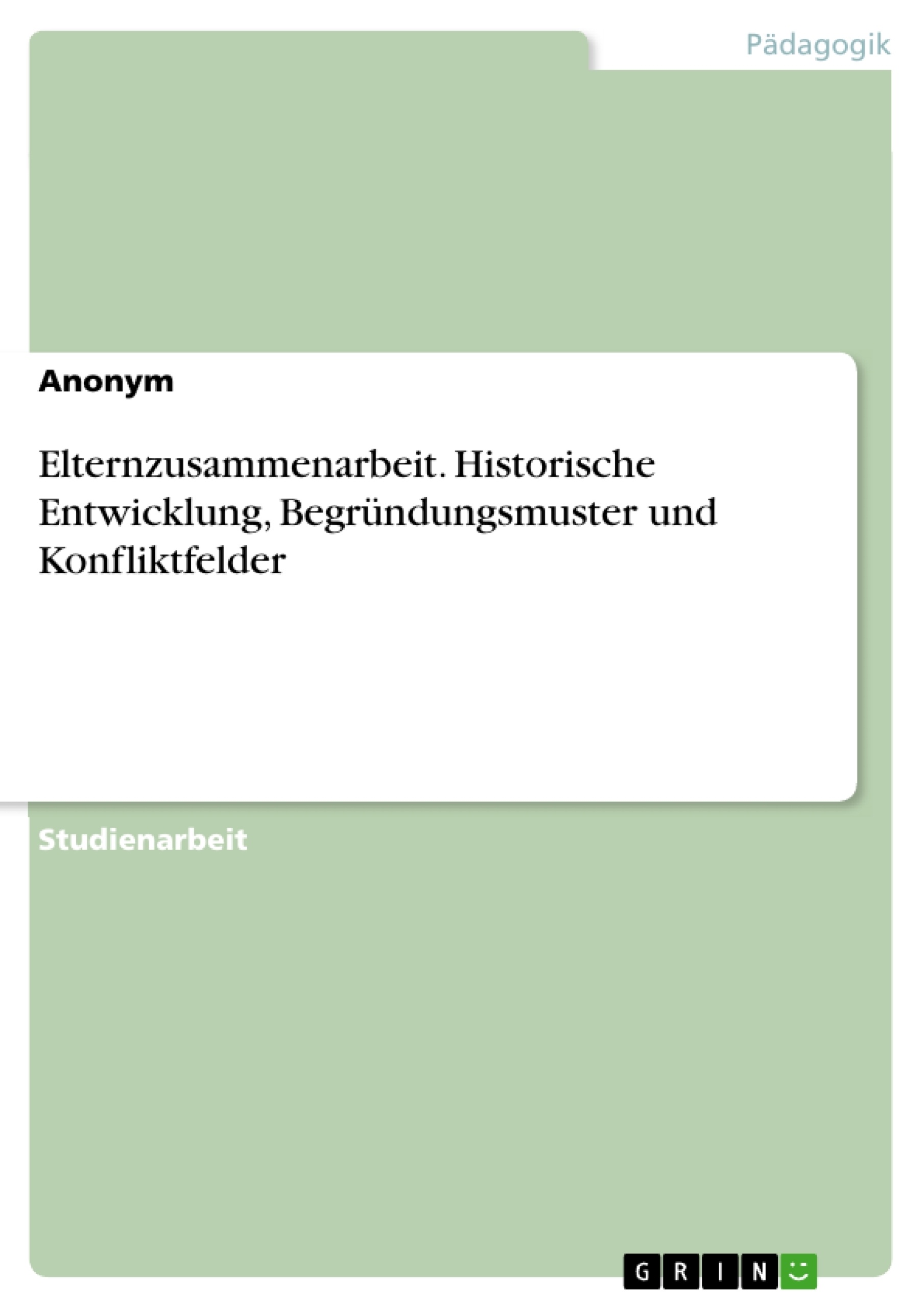Die Arbeit thematisiert die Elternzusammenarbeit. Zunächst geht es um die Frage, wie sich die Kooperation zwischen Familie und Schule mit Beginn der Unterrichts- und Schulpflicht entwickelt hat und wie sie sich in Abhängigkeit von gesellschaftlichen und bildungspolitischen Prozessen im Laufe der Zeit verändert hat. Die gesetzlichen Regelungen der heutigen Bildungs- und Erziehungspartnerschaft von Eltern und Lehrkräften stehen anschließend im Fokus. Darüber hinaus wird eine weitere Begründung für die Elternzusammenarbeit aufgezeigt: die positiven Auswirkungen auf die Lernleistung des Kindes. Kapitel 4 widmet sich den Konfliktfeldern der Kooperation aus Sicht der Eltern und der Lehrkräfte und richtet zugleich einen Blick auf die Defizite der Lehrausbildung. Abschließend enthält das Fazit die zusammenfassenden Ergebnisse dieser Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Historische Entwicklung
- Begründungsmuster
- Gemeinsame Erziehungs- und Bildungsverantwortung
- Positive Effekte auf die Lernleistung der Schülerinnen und Schüler
- Konfliktfelder und Hindernisse
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Thema Elternzusammenarbeit im deutschen Bildungssystem und untersucht die historische Entwicklung, die Begründungsmuster sowie die Herausforderungen der Kooperation zwischen Familie und Schule. Die Autorin möchte ein tieferes Verständnis für die Bedeutung der Elternzusammenarbeit im heutigen Bildungskontext gewinnen und die unterschiedlichen Perspektiven von Eltern und Lehrkräften beleuchten.
- Historische Entwicklung der Elternzusammenarbeit im deutschen Bildungssystem
- Begründungsmuster für die Bedeutung der Elternzusammenarbeit
- Konfliktfelder und Hindernisse in der Elternzusammenarbeit
- Aktuelle rechtliche Rahmenbedingungen der Elternzusammenarbeit
- Positive Auswirkungen der Elternzusammenarbeit auf die Lernleistung von Kindern
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Thematik der Elternzusammenarbeit. Die Autorin beschreibt ihre Motivation, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, und skizziert den Aufbau der Arbeit.
Kapitel 2 widmet sich der historischen Entwicklung der Elternzusammenarbeit. Die Autorin beschreibt die Situation vor der Einführung der Schulpflicht und zeigt die Veränderungen im Verhältnis von Familie und Schule im Laufe der Zeit auf. Sie analysiert die unterschiedlichen Ansätze, die im 19. und 20. Jahrhundert zur Gestaltung der Elternzusammenarbeit prägend waren.
Kapitel 3 behandelt die Begründungsmuster für die Elternzusammenarbeit. Es wird zunächst die gemeinsame Erziehungs- und Bildungsverantwortung von Eltern und Schule beleuchtet und die rechtlichen Rahmenbedingungen der heutigen Bildungs- und Erziehungspartnerschaft beleuchtet. Im zweiten Teil des Kapitels werden die positiven Effekte der Elternzusammenarbeit auf die Lernleistung von Schülerinnen und Schülern thematisiert.
Kapitel 4 untersucht die Konfliktfelder der Kooperation aus Sicht der Eltern und der Lehrkräfte. Die Autorin beleuchtet die Herausforderungen, die mit der Zusammenarbeit zwischen Familie und Schule verbunden sind, und analysiert die Defizite der Lehrausbildung im Hinblick auf die Elternzusammenarbeit.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen Elternzusammenarbeit, historische Entwicklung, Begründungsmuster, Konfliktfelder, Bildungspartnerschaft, Inklusion, Familienarbeit und Schule. Sie fokussiert auf die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Familie und Schule für die erfolgreiche Bildung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen. Die Arbeit analysiert sowohl die positiven Effekte der Elternzusammenarbeit als auch die Herausforderungen, die mit der Kooperation verbunden sind.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2020, Elternzusammenarbeit. Historische Entwicklung, Begründungsmuster und Konfliktfelder, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1127140