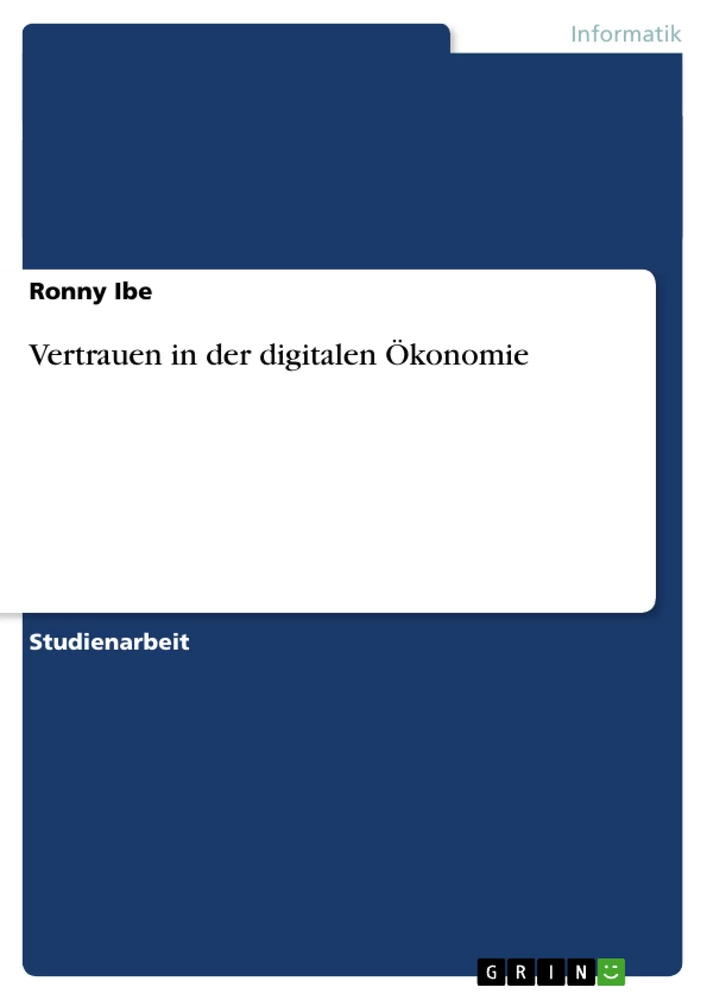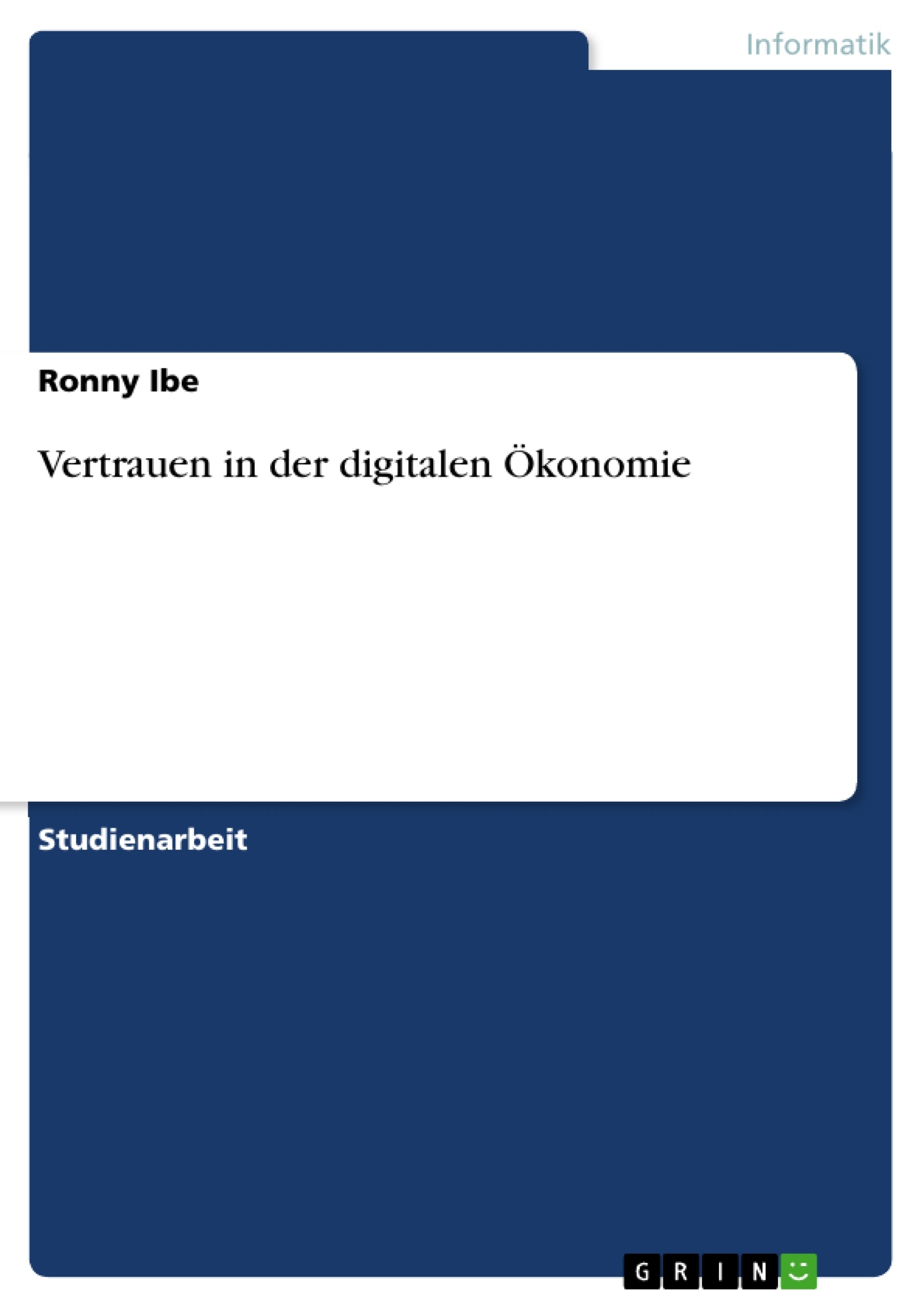Zu Vertrauen oder Vertrauen zu schenken sind Vorgänge, die zumeist eher unbewusst ablaufen. Man macht sich kaum aktiv Gedanken darüber, aus welchen Gründen jemand vertrauenswürdig erscheint oder nicht. Die Gründe für Vertrauen bleiben ebenso wie die Voraussetzungen für Vertrauensbildung im alltäglichen Leben weitestgehend unreflektiert. Im Fokus der Entstehung und Verbreitung neuer Technologien rücken solche Fragen jedoch mehr und mehr in den Mittelpunkt, schließlich kann hier nicht auf routinemäßige Vertrauensmuster wie bei lang erprobten und bewährten Verfahren zurückgegriffen werden. Das Internet bzw. die damit verbundene Frage nach Vertrauen in der digitalen Ökonomie bietet hier ein besonders ergiebiges und weites Untersuchungsfeld. Aufgrund der enormen Möglichkeit der Partizipation, einer riesigen Anzahl von Akteuren und des hohen Grades an Anonymität sind hier einschränkende Gesetze und Regeln nur schwer durchsetzbar. Ein solcher, nahezu gesetzloser Raum, macht die Bildung von Vertrauen zu einer Notwendigkeit, jedoch zugleich zur Unmöglichkeit. Das Internet unterliegt zwar einem stetigen Wachstum, allerdings werden noch lange nicht all seine Potenziale ausgeschöpft, was stark mit der Angst vieler Teilnehmer vor emotionalem und materiellem Schaden zusammenhängt. So werden kaum Verträge über das Internet vollständig abgeschlossen oder größere Summen in reine Online-Geschäfte investiert. Der reale Kontakt scheint für viele Menschen noch immer stark von Nöten zu sein. Auch die in den letzten Jahren durchgeführten rechtlichen und technischen Maßnahmen zur Steigerung der Sicherheit, konnten das Vertrauen der Anwender in digitale Transaktionen kaum steigern. So sind auf der Ebene der Europäischen Union seit 1997 einige gesetzgeberische Aktivitäten in Bezug auf digitale Transaktionen durchgeführt worden, was auch nationale Normen und eine zunehmende Anzahl einschlägiger Publikationen und Gerichtsentscheidungen nach sich zog. Es wurden in Deutschland allein im Zeitraum von April bis Dezember 2001 295 Aufsätze in Fachzeitschriften und Büchern sowie Dissertationen im Bereich des Internet- und Multimediarechts veröffentlicht. Im selben Zeitraum kam es auch zu 138 einschlägigen Gerichtsentscheidungen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vertrauen in digitale Transaktionen
- Funktion von Vertrauen
- Erhöhung des Vertrauens bei digitalen Transaktionen
- Vertrauensobjekte
- Vertrauensbildende Signale
- Strategien zur Erhöhung des Vertrauens
- Unsicherheit bei digitalen Transaktionen
- Arten der Unsicherheit
- Systemunsicherheit
- Partnerunsicherheit
- Kontrollsysteme zur Reduzierung von Unsicherheiten
- Technologische Kontrollsysteme
- Rechtliche Kontrollsysteme
- Organisatorische Kontrollsysteme
- Soziokulturelle Kontrollsysteme
- Arten der Unsicherheit
- Aktuelle Herausforderungen für Theorie und Praxis
- Konvergenz von technischen und rechtlichen Kontrollsystemen
- Vertrauen als Wettbewerbsvorteil
- Vertrauen als Gegenstand von Geschäftsmodellen
- Zusammenfassung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit dem Thema Vertrauen in der digitalen Ökonomie. Ziel ist es, die Bedeutung von Vertrauen für digitale Transaktionen zu analysieren und die Herausforderungen für die Bildung von Vertrauen in diesem Kontext zu beleuchten. Die Arbeit untersucht die Funktion von Vertrauen, die Entstehung von Unsicherheit bei digitalen Transaktionen und die verschiedenen Kontrollsysteme, die zur Reduzierung von Unsicherheiten eingesetzt werden können.
- Die Bedeutung von Vertrauen für digitale Transaktionen
- Die Herausforderungen für die Bildung von Vertrauen in der digitalen Ökonomie
- Die Rolle von Kontrollsystemen bei der Reduzierung von Unsicherheiten
- Die Bedeutung von Vertrauen als Wettbewerbsvorteil
- Die Integration von Vertrauen in Geschäftsmodelle
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Vertrauen in der digitalen Ökonomie ein und stellt die Relevanz des Themas dar. Sie beleuchtet die Herausforderungen, die mit der Bildung von Vertrauen in einem digitalen Kontext verbunden sind, und zeigt die Notwendigkeit, das Thema aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten.
Das Kapitel "Vertrauen in digitale Transaktionen" definiert den Begriff Vertrauen und untersucht seine Funktion in der digitalen Ökonomie. Es werden verschiedene Ansätze zur Erhöhung des Vertrauens bei digitalen Transaktionen vorgestellt, darunter die Identifizierung von Vertrauensobjekten, die Analyse von vertrauensbildenden Signalen und die Entwicklung von Strategien zur Steigerung des Vertrauens.
Das Kapitel "Unsicherheit bei digitalen Transaktionen" analysiert die verschiedenen Arten von Unsicherheiten, die bei digitalen Transaktionen auftreten können. Es werden die Systemunsicherheit und die Partnerunsicherheit näher betrachtet und die Auswirkungen dieser Unsicherheiten auf das Vertrauen in digitale Transaktionen untersucht.
Das Kapitel "Kontrollsysteme zur Reduzierung von Unsicherheiten" stellt verschiedene Kontrollsysteme vor, die zur Reduzierung von Unsicherheiten bei digitalen Transaktionen eingesetzt werden können. Es werden technologische, rechtliche, organisatorische und soziokulturelle Kontrollsysteme analysiert und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile diskutiert.
Das Kapitel "Aktuelle Herausforderungen für Theorie und Praxis" beleuchtet die Herausforderungen, die sich aus der Konvergenz von technischen und rechtlichen Kontrollsystemen ergeben. Es wird die Bedeutung von Vertrauen als Wettbewerbsvorteil und die Integration von Vertrauen in Geschäftsmodelle diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Vertrauen, digitale Ökonomie, digitale Transaktionen, Unsicherheit, Kontrollsysteme, Wettbewerbsvorteil, Geschäftsmodelle, Informationstechnologie, Management, Marketing, Ökonomik, Psychologie, Soziologie.
- Arbeit zitieren
- Ronny Ibe (Autor:in), 2007, Vertrauen in der digitalen Ökonomie, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/112601