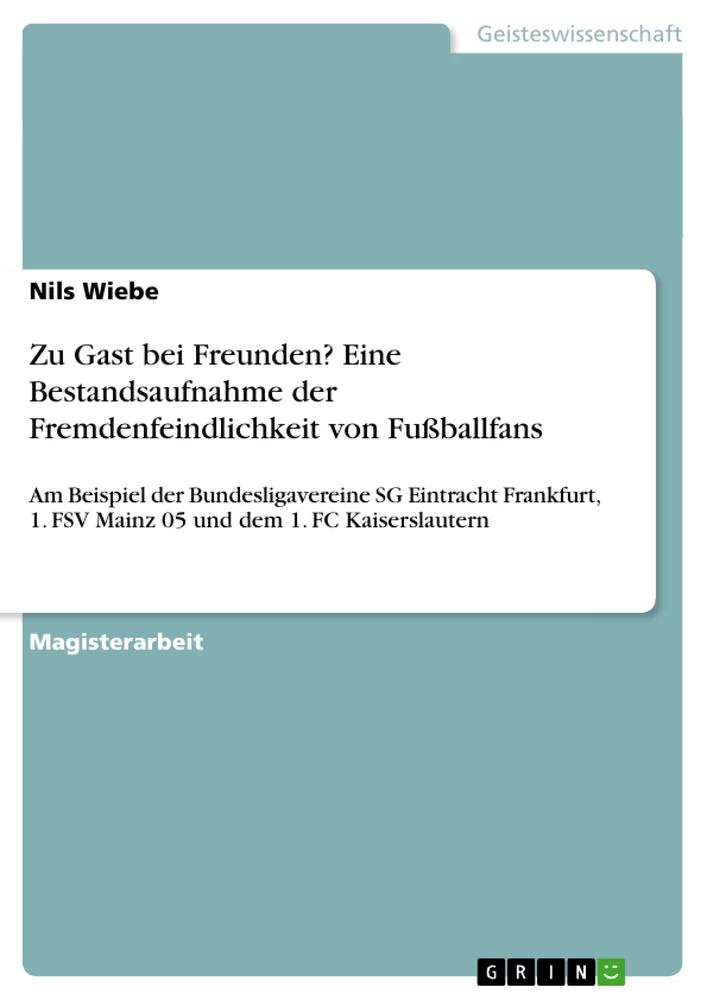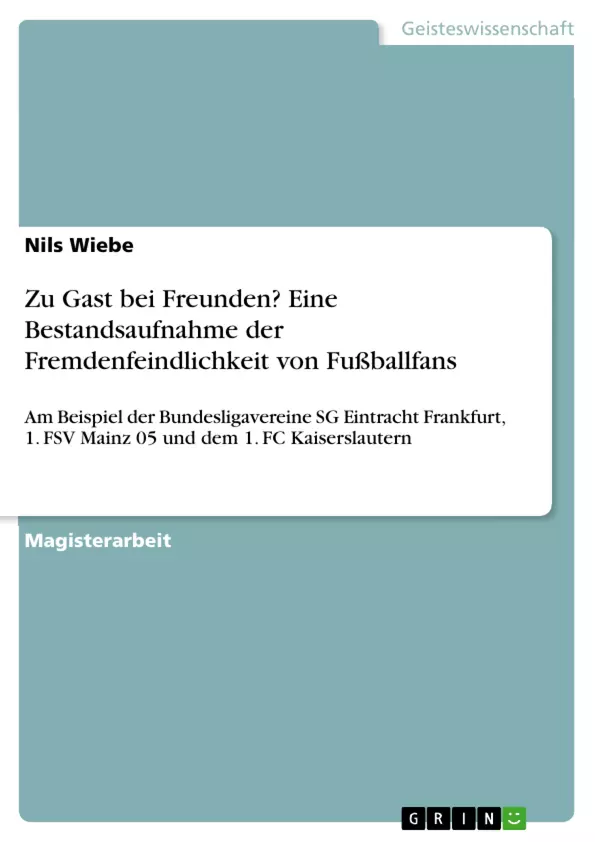Der zu Anfang etwas belächelte Slogan „Die Welt zu Gast bei Freunden“ bewahrheitete sich während der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft (kurz im folgenden WM genannt) im Jahr 2006 in Deutschland eindrucksvoll. Der damalige UN-Generalsekretär Kofi Annan sprach von der „besten WM aller Zeiten“ und während der gesamten Dauer von vier Wochen konnte von gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Fans verschiedener Mannschaften oder Übergriffen durch Hooligans nur vereinzelt berichtet werden. Eine solch friedliche WM war dabei nicht unbedingt zu erwarten gewesen. So waren z.B. die Bilder des verletzten, und am Boden liegenden französischen Polizisten, Daniel Nivel bei der WM in Frankreich im Jahr 1998 noch nicht verblasst. Deutsche Hooligans hatten Nivel in Lens im Juni 1998 lebensgefährliche Verletzungen zugefügt, als sie versuchten eine Straße zu passieren, die von ihm und einem Kollegen abgesperrt wurde (Blaschke 2007: 9). Ebenso gab es kaum zwei Jahre später, am Rande des EM-Vorrundenspiels zwischen England und Deutschland in Charleroi (Belgien), erneut einen Zwischenfall mit gewaltbereiten deutschen Fans und der Polizei. Schließlich, im März 2005 im Rahmen eines Testspiels zwischen Deutschland und Slowenien im Slowenischen Celje, waren es erneut gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen deutschen Fußballfans und der Polizei, die kein gutes Licht auf die deutsche Fußballanhängerschaft warfen.
Aber nicht nur in Deutschland gab bzw. gibt es ein Problem mit gewaltbereiten Fans. Gewaltdelikte sind beispielsweise in der italienischen Liga an der Tagesordnung. Immer wieder kommt es am Rande von Ligaspielen zu Ausschreitungen und schon mehrmals mussten diverse Vereine ihre Heimspiele unter Ausschluss von Zuschauern absolvieren, da es immer wieder zu Eskalationen kam. Im März 2004, beim Spiel des AS Rom gegen den Stadtrivalen Lazio Rom, war die Stimmung durch aufgeheizte, rivalisierende Ultra-Gruppen so groß, dass sogar Spieler durch Fans, die auf das Spielfeld gelaufen waren, bedroht wurden. Der damalige Kapitän des AS Rom, Francesco Totti, forderte den Spielabbruch mit den Worten: „Wenn wir weiter spielen, bringen die uns um“ (Blaschke 2007: 177).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Bisherige Studien über Fußballfans und ihre Einstellungen
- Ich, Wir und die Anderen — Diskriminierung von Fremden und Freunden
- Die Theorie der autoritären Persönlichkeit
- Die Gruppe und ihr Verhalten
- Der Interessenkonflikt verschiedener Gruppen
- Das Minimalgruppen-paradigma
- Die Theorie der sozialen Identität
- Methodische Vorgehensweise
- Fan ist nicht gleich Fan
- Die Auswahl der Vereine
- Vergleichsstudien
- Der ALLBUS 2006
- Politische Einstellungen, politische Partizipation und Wählerverhalten im vereinigten Deutschland 2002
- Art der Befragung
- Fragebogenentwicklung
- Umfragedurchführung
- Die Einstellungen "aller" Deutschen
- Auswertungsmethoden und -besonderheiten
- Ergebnisdarstellung
- Fremdenfeindlichkeit
- Antisemitismus
- Pro-Nazismus
- Autoritarismus
- Nationalismus
- Zuwandererung & Politikverdrossenheit
- Faneinstellungen
- Demographische Analysen der Stichprobe
- Einstellungen zu ausländischen Spielern
- Allgemeine Einstellungen und Vergleich
- Fremdenfeindlichkeit
- Antisemitismus
- Pro-Nazismus
- Autoritarismus
- Nationalismus
- Zuwandererung & Politikverdrossenheit
- Zusammenfassung und Interpretation
- Resümee und Ausblick
- Anhang
- Abbildungsverzeichnis
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit beschäftigt sich mit der Frage nach der Fremdenfeindlichkeit von Fußballfans in Deutschland. Sie untersucht, ob und in welchem Maße Fußballfans gegenüber Ausländern und anderen gesellschaftlichen Gruppen diskriminierende Einstellungen zeigen. Die Arbeit basiert auf einer empirischen Untersuchung, die mit Hilfe eines Fragebogens an Fans der Bundesligavereine SG Eintracht Frankfurt, 1. FSV Mainz 05 und 1. FC Kaiserslautern durchgeführt wurde. Die Ergebnisse werden mit Daten aus zwei repräsentativen Vergleichsstudien, dem ALLBUS 2006 und der DFG-Studie "Politische Einstellungen, politische Partizipation und Wählerverhalten im vereinigten Deutschland 2002", verglichen.
- Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus im deutschen Fußball
- Die Theorie der sozialen Identität als Erklärungsmodell für diskriminierendes Verhalten
- Empirische Untersuchung der Einstellungen von Fußballfans
- Vergleich der Ergebnisse mit repräsentativen Bevölkerungsstudien
- Analyse der Unterschiede in den Einstellungen zwischen den Fangruppen der drei Vereine
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problematik von Fremdenfeindlichkeit und Rassismus im Fußball vor und führt die Arbeitshypothese ein, die auf der Theorie der sozialen Identität basiert. Sie argumentiert, dass Fußballfans aufgrund ihres ausgeprägten Gruppenzugehörigkeitsgefühls und der daraus resultierenden sozialen Identität eher dazu neigen, andere Menschen zu diskriminieren.
Kapitel zwei präsentiert eine Auswahl bisheriger Studien über Fußballfans und deren Einstellungen. Es werden unter anderem die Untersuchungen von Heitmeyer/Peter (1987, 1988) und Pilz (2005, 2006) vorgestellt, die sich mit der Verbreitung von Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit in der Fanszene auseinandersetzen.
Kapitel drei beschäftigt sich mit der Theorie der sozialen Identität von Tajfel und Turner. Es wird erläutert, wie die Theorie die Entstehung von Vorurteilen und diskriminierendem Verhalten von Gruppenmitgliedern erklärt. Dabei werden die verschiedenen Komponenten der sozialen Identität und die Bedeutung des sozialen Vergleichs zwischen der eigenen und der Fremdgruppe beleuchtet.
Kapitel vier beschreibt die methodische Vorgehensweise der empirischen Untersuchung. Es wird die Auswahl der Vereine, die Entwicklung des Fragebogens und die Durchführung der Online-Befragung erläutert. Außerdem werden die beiden Vergleichsstudien, der ALLBUS 2006 und die DFG-Studie, vorgestellt und deren Relevanz für die Untersuchung der Einstellungen von Fußballfans erläutert.
Kapitel fünf präsentiert die Ergebnisse der beiden Vergleichsstudien. Es werden die verschiedenen Dimensionen des Rechtsextremismus, einschließlich der drei Varianten der Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus, Pro-Nazismus, Autoritarismus und Nationalismus, analysiert. Außerdem werden die Ergebnisse bezüglich der Politikverdrossenheit vorgestellt.
Kapitel sechs widmet sich den Einstellungen der befragten Fußballfans. Zunächst werden die demographischen Merkmale der Stichprobe dargestellt. Anschließend werden die Ergebnisse der fußballspezifischen Fragen zur Liga und zu ausländischen Spielern vorgestellt. Im weiteren Verlauf werden die Ergebnisse der einzelnen Dimensionen des Rechtsextremismus und der Politikverdrossenheit präsentiert und mit den Vergleichsstudien verglichen. Die Ergebnisse werden auf der Ebene der drei Vereine (Eintracht Frankfurt, 1. FSV Mainz 05 und 1. FC Kaiserslautern) analysiert, um Unterschiede in den Einstellungen der Fangruppen zu identifizieren.
Das Resümee und der Ausblick fassen die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammen und diskutieren die Limitationen der Untersuchung. Es werden mögliche Erklärungen für die Ergebnisse und die Bedeutung der Untersuchung für die weitere Forschung diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Förderschwerpunkt Lernen, den inklusiven und exklusiven Unterricht sowie die schulische Inklusion, insbesondere in Nordrhein-Westfalen. Empirische Forschungsergebnisse werden präsentiert, um die Rahmenbedingungen und Herausforderungen der inklusiven Beschulung von Kindern mit dem Förderschwerpunkt Lernen zu beleuchten. Ein besonderer Fokus liegt auf der Bielefelder Längsschnittstudie (BiLieF-Projekt), die die Leistungsentwicklung und das Wohlbefinden von Schülern in inklusiven und exklusiven Förderarrangements vergleicht. Weitere Themen sind Förderempfehlungen, die Herausforderungen der Inklusion sowie Implikationen für die Schulentwicklung und Inklusionspraxis.
- Quote paper
- Nils Wiebe (Author), 2008, Zu Gast bei Freunden? Eine Bestandsaufnahme der Fremdenfeindlichkeit von Fußballfans , Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/112238