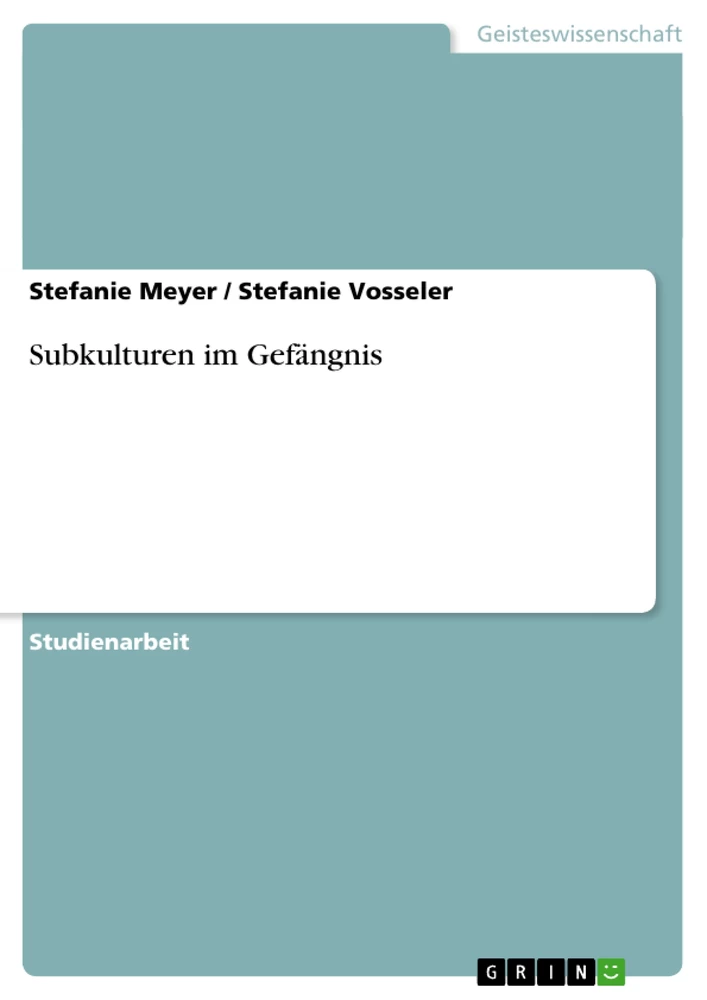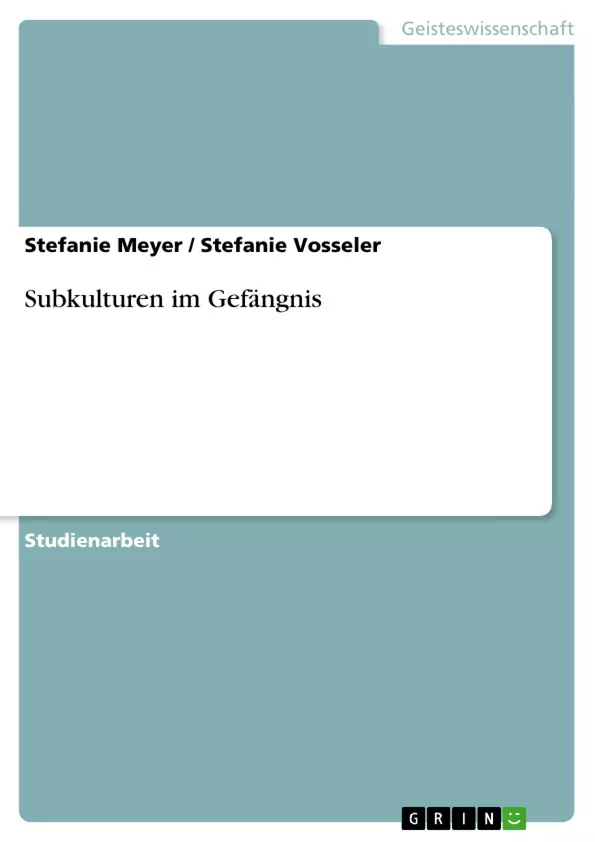Dostojewski hat es erlebt, ebenso Oscar Wilde und andere Menschen, die ihre Erfahrungen später autobiographisch festhielten - das Leben im Gefängnis. Verschwommen zwischen Mythos und Vorurteilen entwickelt jeder Mensch einen Eindruck von dem Leben hinter den Mauern, eine Vorstellung, die in den meisten Fällen nicht von der Realität in Form einer gerichtlichen Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe eingeholt wird.
Während der Gesetzgeber mit der Festlegung der Vollzugsziele durch den Vollzug der Freiheitsstrafe den Gefangenen dazu befähigen will, in Zukunft ein sozial verantwortliches Leben ohne Straftaten zu führen, gibt es zahlreiche Untersuchungen, die darauf hinführen, dass der Strafvollzug eine negative Auswirkung auf gesellschaftskonforme Orientierungen der Inhaftierten ausübt. Doch woher kommt diese Diskrepanz zwischen den Zielen des Freiheitsentzugs und der daraus resultierenden Realität?
Das Leben eines Menschen erfährt mit seiner Inhaftierung in ein Gefängnis eine einschneidende Veränderung. Die neue Situation stellt den Mensch vor die Aufgabe, mit seiner fremden, ungewohnten Umgebung umzugehen. Möglicherweise sind es diese Eindrücke oder vielleicht doch eher die Einflüsse aus der individuellen kulturellen Vergangenheit der Inhaftierten, welche das Leben im Gefängnis langfristig prägen?
Einig ist man sich darüber, dass das Leben im Gefängnis besondere Formen annimmt und sich bestimmte Lebensweisen ausbilden, welche in unterschiedlichen Subkulturen ihren Ausdruck finden.
Auch wenn es im Gefängnis die Subkultur der Wärter und die Gefangenensubkultur, wird es in dieser Arbeit hauptsächlich um die Gefangenensubkultur gehen.
Nach einer kurzen allgemeinen Einführung in die gängigen Subkulturkonzepte, die Geschichte des Gefängnisses und die Gefängnissituation in Deutschland wird in dieser Hausarbeit auf das Gefängnis als totale Institution eingegangen. Anschließend werden die grundlegenden Theorien zur Subkulturbildung im Gefängnis vorgestellt, bevor die Gruppenbildung und die Ausbildung von Führungspersönlichkeiten beleuchtet werden. Das Verhältnis zwischen Wärtern und Gefangenen, sowie die Sprache im Gefängnis werden betrachtet, ehe die Arbeit mit zwei Beispielen und einem Exkurs über einen Vergleich zwischen Big Brother und dem Gefängnis abgerundet wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Einführung in den Subkulturbegriff
- Geschichte des Gefängnisses
- Gefängnissituation in Deutschland
- Aktuelle Zahlen
- Tagesablauf
- Die Zellensituation
- Gefängnis als totale Institution
- Theorien zu Gefängnissubkultur
- Prozess der Prisonierung
- Deprivationstheorie
- Theorie der kulturellen Übertragung
- Neuere Entwicklungen
- Die Entstehung und Bildung von Gruppen
- Die allgemeine Gruppenbildung
- Die Gruppenbildung im Gefängnis
- Die Führerpersönlichkeiten im Gefängnis
- Das Verhältnis zwischen Wärtern und Gefangenen
- Die Sprache im Gefängnis
- Beispiele unterschiedlicher Subkulturausbildung
- Frauen im Gefängnis
- Jugendliche im Gefängnis
- Exkurs: Vergleich zwischen Gefängnis und Big Brother
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Phänomen der Subkulturen im Gefängnis. Ziel ist es, die Entstehung und Entwicklung dieser Subkulturen vor dem Hintergrund der spezifischen Bedingungen des Gefängnislebens zu analysieren. Dazu werden verschiedene Theorien zur Subkulturbildung sowie die Rolle von Faktoren wie Gruppenbildung, Führungspersönlichkeiten und dem Verhältnis zwischen Wärtern und Gefangenen beleuchtet.
- Die Entstehung und Entwicklung von Subkulturen im Gefängnis
- Theorien zur Subkulturbildung im Gefängnis
- Einflüsse von Gruppenbildung und Führungspersönlichkeiten
- Das Verhältnis zwischen Wärtern und Gefangenen
- Die Bedeutung der Sprache im Gefängnis
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Kontext und die Relevanz des Themas erläutert. Im zweiten Kapitel wird der Begriff „Subkultur“ definiert und in verschiedenen Kontexten betrachtet. Kapitel 3 beleuchtet die Geschichte des Gefängnisses und Kapitel 4 die aktuelle Situation in Deutschland, inklusive Zahlen, Tagesablauf und Zellensituation. Kapitel 5 behandelt das Gefängnis als totale Institution. Anschließend werden in Kapitel 6 verschiedene Theorien zur Subkulturbildung im Gefängnis vorgestellt, wie z. B. die Deprivationstheorie und die Theorie der kulturellen Übertragung. Kapitel 7 analysiert die Entstehung und Bildung von Gruppen im Gefängnis, während Kapitel 8 sich mit den Führerpersönlichkeiten auseinandersetzt. Das Verhältnis zwischen Wärtern und Gefangenen sowie die Sprache im Gefängnis werden in Kapitel 9 und 10 betrachtet. Kapitel 11 beleuchtet Beispiele unterschiedlicher Subkulturausbildung, wie z. B. die Subkultur von Frauen und Jugendlichen im Gefängnis. Ein Exkurs in Kapitel 12 vergleicht das Gefängnis mit dem Reality-TV-Format „Big Brother“.
Schlüsselwörter
Subkulturen, Gefängnis, totale Institution, Deprivationstheorie, kulturelle Übertragung, Gruppenbildung, Führungspersönlichkeiten, Wärter, Gefangene, Sprache, Frauen im Gefängnis, Jugendliche im Gefängnis, Big Brother
- Quote paper
- Stefanie Meyer (Author), Stefanie Vosseler (Author), 2001, Subkulturen im Gefängnis, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/11023