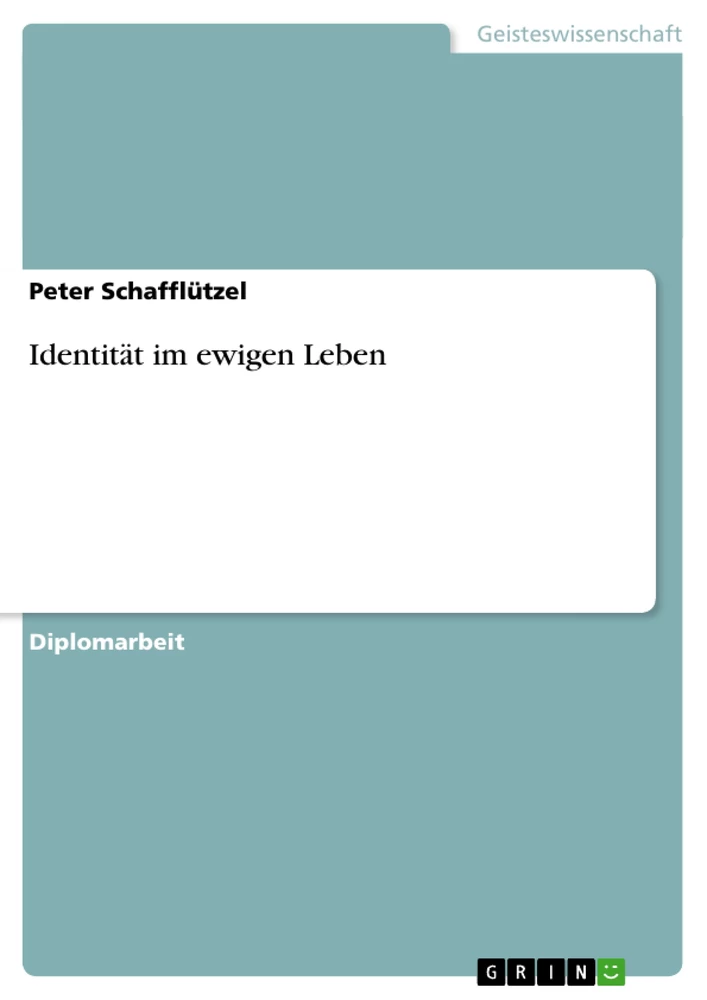„Was tröstet dich der Artikel vom ewigen Leben?“ heisst die 58. Frage im Heidelberger Katechismus. Die Antwort darauf lautet: „Dass, nachdem ich jetzt den Anfang der ewigen Freude in meinem Herzen empfinde, ich nach diesem Leben vollkommene Seligkeit besitzen werde […]“.1
In der vorliegenden Untersuchung geht es um das Wort, das in der Antwort zweimal vorkommt: „ich“. Das erste Ich ist das gegenwärtige Ich einer glaubenden Person, das zweite das künftige Ich einer Person, die jenseits der Grenzen dieses Lebens im ewigen Leben existieren wird. Wer den Satz nachspricht oder liest, setzt selbstverständlich voraus, dass es sich bei beiden Nennungen um dasselbe Ich handelt. Wer jedoch genauer darüber nachdenkt, erkennt, dass dies keineswegs ein selbstverständlicher Sachverhalt ist. Stellt er sich den Übergang ins ewige Leben so vor, dass nur die Seele der jetzigen Person den physischen Tod überleben und ins ewige Leben gelangen wird, muss er sich die Frage gefallen lassen, ob die künftige Person, die nur noch aus einem Teil der jetzigen bestehen wird, noch dieselbe wie die jetzige genannt werden kann. Wenn er aber davon ausgeht, dass die jetzige Person ganz sterben und ganz zu neuem Leben erweckt werden wird, sieht er sich mit dem Verdacht konfrontiert, dass die künftige Person eine blosse Kopie der jetzigen sein könnte. Diese und zahlreiche weitere Probleme stellen sich, wenn man nach der Identität im ewigen Leben, dem Gegenstand dieser Untersuchung, fragt.
Ob und wie die Person des jetzigen Lebens und die des ewigen Lebens miteinander identisch sein können, sind die Leitfragen, an denen sich die Untersuchung orientieren wird. Entsprechend soll zuerst anhand der Replica-Debatte erörtert werden, ob persönliche Identität über den physischen Tod hinweg überhaupt logisch möglich ist. Danach ist der Frage nach dem Wie der Identitätserhaltung am Beispiel zweier profilierter Vorschläge, demjenigen von John Hick und demjenigen von Wolfhart Pannenberg, nachzugehen, und schliesslich werden die im Verlauf der Untersuchung gewonnenen Erkenntnisse in Form einer kurzen Skizze zu einem eigenen Vorschlag zusammengetragen werden.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- DIE MÖGLICHKEIT DER IDENTITÄT
- Die Replica-Theorie
- Die Replica-Debatte
- Körperliche Kontinuität oder Entscheidung
- Mehrere Kopien
- Die Bedeutung der Möglichkeit
- Alle sind identisch
- Keine ist identisch
- Beurteilung
- Vorüberlegungen
- Die Argumentation der Verteidiger der Theorie
- Die Argumentation der Gegner der Theorie
- Identität ist möglich
- IDENTITÄT DURCH DIE SEELE (J. HICK)
- Grundzüge der Eschatologie Hicks
- Die Vollendung des Menschen im Endzustand
- Entwicklung durch viele Leben
- Der Übergang ins nächste Leben
- Hicks Lösung des Identitätsproblems
- Beurteilung
- Würdigung
- Einwände
- Körperunabhängige Seele
- Identität ohne Leib
- Mehrere Leben
- Fazit
- IDENTITÄT DURCH GOTT (W. PANNENBERG)
- Grundzüge der Eschatologie Pannenbergs
- Die Vollendung in der Zukunft des Reiches Gottes
- Verwandlung in Auferstehung und Gericht
- Pannenbergs Lösung des Identitätsproblems
- Beurteilung
- Einwände
- Die Leiblichkeit der Auferstehung
- Veränderung des Lebensinhaltes
- Der Massstab des Gerichts
- Die interne Instanz
- Individuelle Bestimmung
- Zwei unterschiedliche Identitätsbegründungen
- Fazit
- DIE WIRKLICHKEIT DER IDENTITÄT
- Die eschatologische Wirklichkeit
- Die Erfüllung der Bestimmung
- Eschatologische Existenz
- Eschatologische Identität
- Konsequenzen
- Konsequenzen für das gegenwärtige Leben
- Konsequenzen für Tod und Auferstehung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Frage nach der persönlichen Identität im ewigen Leben. Sie analysiert die Möglichkeit der Identitätserhaltung über den Tod hinaus und beleuchtet verschiedene Ansätze zur Lösung des Identitätsproblems, insbesondere die Theorien von John Hick und Wolfhart Pannenberg. Die Arbeit zielt darauf ab, ein besseres Verständnis der Beziehung zwischen dem gegenwärtigen und dem zukünftigen Ich zu erlangen.
- Die Möglichkeit der persönlichen Identität im Jenseits
- Verschiedene Ansätze zur Erklärung der Identitätserhaltung
- Die Rolle der Seele und des Körpers in der Identität
- Die Bedeutung von Gottes Rolle in der Bestimmung der Identität
- Die Konsequenzen für das Verständnis von Tod, Auferstehung und ewigem Leben
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik der Identitätsfrage im ewigen Leben ein. Es beleuchtet die Herausforderung, die sich aus der Vorstellung von Tod und Auferstehung für das Konzept der persönlichen Identität ergibt. Das zweite Kapitel untersucht die Möglichkeit der Identitätserhaltung anhand der Replica-Theorie. Es diskutiert die Argumente für und gegen die Möglichkeit, dass eine Person nach dem Tod als Kopie ihrer selbst im Jenseits existiert. Das dritte Kapitel befasst sich mit der Lösung des Identitätsproblems, die von John Hick vorgeschlagen wird. Hick argumentiert, dass die Seele als Träger der Identität über den Tod hinaus besteht und im Jenseits fortbesteht. Das vierte Kapitel untersucht den Ansatz von Wolfhart Pannenberg zur Identität im ewigen Leben. Pannenberg betont die Rolle Gottes bei der Gestaltung der Identität im Jenseits. Das fünfte Kapitel diskutiert die Konsequenzen der unterschiedlichen Ansätze für das Verständnis der eschatologischen Wirklichkeit und ihrer Auswirkungen auf das gegenwärtige Leben sowie auf Tod und Auferstehung.
Schlüsselwörter
Persönliche Identität, ewiges Leben, Eschatologie, Replica-Theorie, John Hick, Wolfhart Pannenberg, Seele, Körper, Auferstehung, Gericht, Gott, eschatologische Wirklichkeit, Tod.
- Quote paper
- Peter Schafflützel (Author), 1996, Identität im ewigen Leben, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/11018