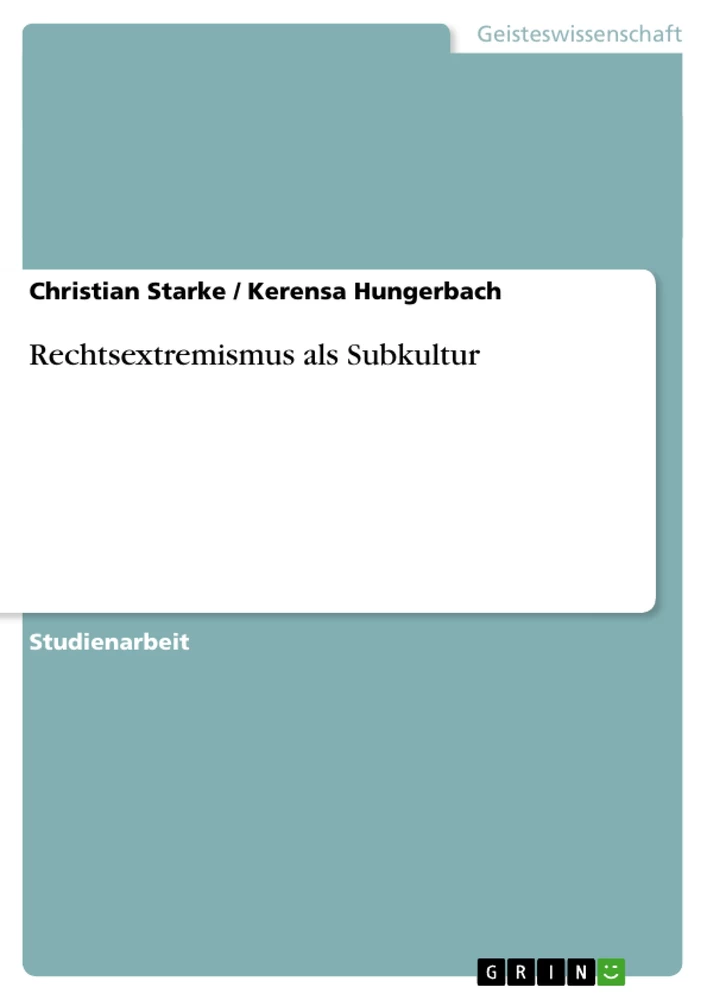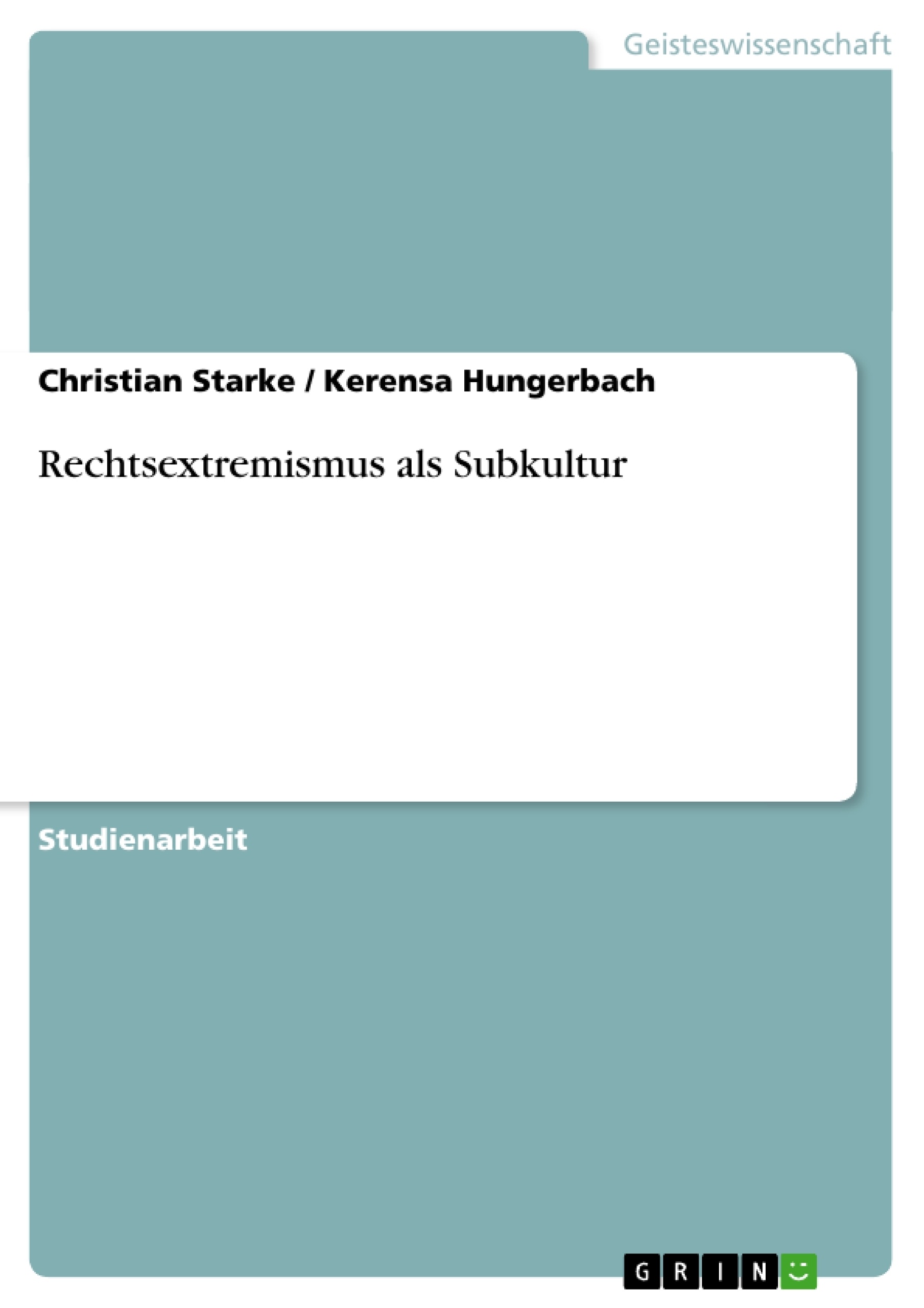Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Definitionen
Normen
Abweichendes Verhalten
Rechtsextremismus/Rechtsradikalismus
3. Rechtsextremismus in Deutschland
4. Einführung in die Theorien abweichenden Verhaltens
5. Die Subkulturtheorie
Die These von der Unterschicht-Kultur (Miller)
Die Subkultur der Gewalt nach Wolfgang und Ferracuti
Die Kontrakultur nach Yinger
Die Subkulturtheorie nach Cohen
6. Die Subkultur der Rechtsextremen (Anwendung der Theorie von Cohen)
Versuch der Eingrenzung
Normen und Werte
Alters- und Geschlechtsstruktur
Territoriale Eingrenzung (oder: Rechtsextremer Osten?)
Sozialer Status als gemeinsames Merkmal?
Gewalt als Lösung? (nicht – utilitaristische Gewaltausübung)
1. Einleitung
Die Wissenschaft gibt viele Begründungsansätze für abweichendes Verhalten und Gewalt. Die Ansätze reichen von der Psychologie, der Biologie, der Kommunikationswissenschaften bis zur Soziologie und sicherlich noch viel weiter. Abweichendes Verhalten in allen seinen Facetten, Ausprägungen und Hintergründen zu erklären ist wohl kaum möglich. Dennoch kann man versuchen die Situation, das Verhalten, die Motive und die Auswirkungen der Abweichung von der Realität zu abstrahieren und dieses anhand einer bestimmten Theorie zu analysieren. An diesem Punkt werden wir mit unserer Hausarbeit anknüpfen. Wir werden im weiteren Verlauf erst einmal wichtige Begriffe abgrenzen und definieren um klar zu machen wovon diese Hausarbeit handelt um dann die Frage zu beantworten: „Sind die Anhänger des Rechtsextremismus eine einzugrenzende Subkultur und welche Merkmale weisen sie auf?“ Diese Frage ist besonders in der Hinsicht interessant, da man das, in der Gesellschaft verbreitete Bild von Rechtsextremen hinterfragen und vielleicht sogar teilweise widerlegen kann. Der Versuch dieses Bild teilweise zu widerlegen sollte nicht gleichgesetzt werden mit einer Schmälerung der Gefahr, die von einer solchen Bewegung / „Subkultur?“ ausgehen kann bzw. ausgeht. Man sollte es sich aber auch nicht zu einfach machen und rechtsextremes Verhalten mit statistisch nicht bewiesenen Phrasen zu erklären. Demzufolge werden wir im Rahmen dieser Hausarbeit das Verhalten von Rechtsextremen, welche im weiteren Verlauf noch weiter eingegrenzt werden, mit der Subkulturtheorie von Cohen erklären und versuchen möglichst viele Analogien zwischen Rechtsextremismus und Cohen’s Subkulturbegriff, zu finden.
2. Definitionen
2.1 Normen
Das Leben der Menschen untereinander ist an bestimmte Regeln und Standards gebunden. Ohne diese verbindlichen Regeln wäre jeder der Willkür seines Gegenübers ausgesetzt, es würde zu Kommunikationsproblemen kommen und unser Verständnis für unsere Mitmenschen würde wahrscheinlich auf einen Tiefpunkt sinken. Soziale Normen begrenzen diese uneingeschränkte Handlungsfreiheit des Menschen, so dass wir unser Verhalten an einen Rahmen des „erlaubten“ anpassen um verstanden, toleriert und nicht ausgeschlossen zu werden. Normen sind also explizit gemachte Verhaltensregeln, welche im Sozialisationsprozess internalisiert werden.
Wir unterscheiden drei verschiedene Normverbindlichkeiten. „Muss – Normen“ stellen in unserer Gesellschaft die Gesetze dar. „Soll – Normen“ sind als Sitten verbreitet und „Kann – Normen“ bezeichnen wir als Gewohnheiten.
Werte dagegen sind die allgemeinsten Grundprinzipien der Handlungsorientierung und der Ausführung bestimmter Handlung. Sie sind „kulturelle, religiöse, ethische und soziale Leitbilder“ (KORTE/SCHÄFERS 2002, 6.Auflage) und das Grundgerüst der Kultur.
2.2 abweichendes Verhalten:
Mit abweichendem Verhalten werden Verhaltensweisen bezeichnet, die gegen die in einer Gesellschaft oder einer ihrer Teilstrukturen geltenden sozialen Normen verstoßen und im Falle der Entdeckung soziale Reaktionen hervorrufen, die darauf abzielen, die betreffende Person zu bestrafen, isolieren, behandeln oder zu bessern. Abweichendes Verhalten in der einen oder anderen Form findet man überall dort, wo es Regeln gibt. Beispiele dafür sind Missachtung der Verkehrsregeln, Betrug bei der Einkommenssteuererklärung oder auch nur das Versäumnis den Nachbarn zu grüßen.
Die Soziologie hat sich besonders mit Abweichungen von den gesamtgesellschaftlichen Normen und Werten befasst. So gelten in diesem Sinne als abweichendes Verhalten in erster Linie Kriminalität, aber auch Alkoholismus, illegaler Drogenkonsum, Geisteskrankheit, Suizid, Homosexualität und Prostitution.
Gemein ist allen Arten abweichenden Verhaltens, dass es sich um Abweichungen von gesamtgesellschaftlich dominanten Normen handelt, die jeden Menschen als Mitglied der Gesellschaft betreffen und der Stabilisierung des gesellschaftlichen Status quo dienen. Abweichendes Verhalten gilt deshalb nicht nur als gesellschaftliche Störung, sondern ist ein Verstoß gegen zentrale Normen.
2.3 Rechtsextremismus/ Rechtsradikalismus:
Der Extremismus ist eine Verhaltensweise, die die bestehende Gesellschafts- und Staatsordnung radikal umstürzen will und entsprechende Strategien, einschließlich der Anwendung von Gewalt, entwickelt. Der Rechtsextremismus äußert sich in einer autoritären, nationalistischen und rassistischen Gesinnung und ist eine politische Bewegung, deren Anhänger, so individuell sie auch sein können, eine Reihe gemeinsamer Merkmale aufweisen.
Die Bedeutung des Rechtsextremismus besteht insbesondere in Krisenzeiten darin, vielfältigen Gefühlen der Anspannung, Unsicherheit, Orientierungslosigkeit, Ohnmacht aber auch Wut und des ungesicherten Hasses ein Angebot vermeintlich eindeutiger Erklärungen und Schuldzuweisungen, Rechtfertigungen und Kompensation von Schuld- und Versagensgefühlen zu stellen.
3. Der Rechtsextremismus in Deutschland
Die rechtsextreme Landschaft ist nicht leicht zu überschauen: Neben den drei Hauptparteien der Rechtsextremisten (DVU, REP und NPD) existieren laut dem Verfassungsschutz noch über 130 rechtsextremistische Klein- und Kleinstorganisationen, wie die Skinheads und die Neonazis. In den letzteren beiden Gruppen ist die Gewaltbereitschaft sehr hoch. Laut Verfassungsschutz gibt es 9000 gewaltbereite Rechtsextreme in Deutschland. Tendenz: steigend. Die Mitglieder rechtsextremer Parteien hingegen sind eher nicht gewaltbereit. Insgesamt gab es 1999 laut Verfassungsschutz 51.400 Rechtsextremisten in Deutschland, 4 Prozent weniger als 1998. Das bedeutet jedoch nicht, das der Aussteiger nicht mehr rechtsextreme Gesinnungen vertritt, nur weil er aus der Partei ausgestiegen ist.
4. Einführung in die Theorien abweichenden Verhaltens
Alle Theorien abweichenden Verhaltens legen nur eine spezielle Sichtweise an den Tag, behandeln nur einige von vielen Aspekten oder sehen das zu untersuchende Gebiet nur aus einem speziellen Blickwinkel.
Um nicht dem Vorwurf zu erliegen, die im späteren Verlauf erläuterte und angewandte Theorie sei die universell erklärende Theorie, sollen hier kurz weitere Theorien dargestellt werden. Dabei beschränken wir uns jedoch aus Platzgründen auf die sozialwissenschaftlichen Theorien. Die wohl älteste Theorie aus dem sozialwissenschaftlichen Bereich ist die Anomietheorie von Emile Durkheim. Diese ist in die Reihe der ätiologischen Devianztheorien einzuordnen. Sie sucht die Bedingungen der Anomie, also des abweichenden Verhaltens in der sozialen Umwelt des Täters, genauer gesagt in der Entwicklung der Gesellschaft. Diese Tatsache, also die Betrachtung der sozialen Umgebung als Grund des abweichenden Verhaltens, war dabei eine völlig neue Sichtweise in der Kriminologie, die Devianz vorher ausschließlich biologisch oder psychologisch betrachtete. Die Definition abweichenden Verhaltens ist in der Anomietheorie aber kulturell relativ beschränkt, da alles von der Norm abweichende, als abweichendes Verhalten definiert wird. In diesem Punkt setzt eine weitere Theorie an, die kurz angeschnitten werden soll. Der Labeling Approach – Ansatz, begründet von Tannenbaum, nimmt die Zuschreibung eines Verhaltens als „abweichend“ im Sinne von „normabweichend“ nicht einfach hin, sondern fragt nach den Hintergründen der Normen und betrachtet vor allen Dingen den Prozess der Normsetzung. Wird jemand als „abweichend“ etikettiert, so ein weiteres Argument der Vertreter des Labeling – Approach, nimmt er diese Rolle und dieses Identitätsmerkmal im Laufe des Prozesses an und reproduziert es.
5. Die Subkulturtheorie
5.1 Die These von der Unterschicht-Kultur (Miller)
Die Subkulturtheorie von Walter Miller betrachtet Teile der Unterschicht als eine eher eigenständige abweichende Subkultur mit eigenen Werten und Normen. Es ist also nicht die Reaktion auf das Nichterreichen von Mittelschichtzielen- und Normen, wie es bei Cohen der Fall ist, das Problem behandelt also die Kultur der Unterschicht.
Dieser Teil der Kultur, insbesondere delinquente Banden, hat demnach sein eigenes Wertesystem.
Dazu zählt Miller unter anderem Themen wie
- „Härte“ (Symbole der Männlichkeit, wie Mut oder Indifferenz gegenüber Literatur und Kunst)
- „Erregung“ (das Genießen spannender Ereignisse, wie Alkoholgenuss, Glücksspielen etc.)
- „Schwierigkeiten“ ( Kennzeichen der Unterschichtkultur, Streben nach der Umsetzung der Mittelschichtnormen endet häufig in gesetzwidrigem Verhalten)
- „Schicksal“ ( das Glücksspiel erfährt eine große Bedeutung in Kreisen der Unterschicht, das hängt damit zusammen, dass häufig an das Schicksal geglaubt wird und so zielgerichtete Bestrebung eher selten der Fall sind.)
- „Geistige Wendigkeit“ ( „Fähigkeit, den anderen zu überlisten, um zu verhindern, selbst Opfer einer Täuschung zu werden“ (Zitat Siegfried Lamnek, S. 170, Z. 7 f)
- „Autonomie“ ( Konflikt zwischen Unabhängigkeit und Abhängigkeit andere Menschen, werten und Normen
Insbesondere bei Jugendlichen zählt Miller zu den oben genannten
Merkmalen noch zwei andere Motivationen:
- „Zugehörigkeit“ (große Funktion der Gruppe, Zugehörigkeitsgefühl ist unabdingbar für das Individuum, Angst vor Ausschluss)
- „Status“ ( prägende Motive sind Härte, Geistige Wendigkeit und Widerstand gegenüber Autoritätspersonen.
All diese Komponenten erhöhen die Wahrscheinlichkeit mit dem Gesetz in Konflikt zu geraten.
„Bei Bandendelinquenz handelt es sich demnach nicht um eine Reaktion auf aktuelle, sozialstrukturell induzierte Frustrationen, sondern um mehr oder weniger zufällige Begleiterscheinungen von Handlungen, die der kulturellen Tradition der Unterschicht oder von Teilen der Unterschicht entsprechen“
(Zitat: Korte/ Schäfers, S. 114, Z. ...)
5.2 Die Subkultur der Gewalt nach Wolfgang und Ferracuti
Zu Beginn muss erwähnt werden, dass sich diesen beiden Amerikaner hauptsächlich mit der amerikanischen Gewalttätigkeit der Subkultur beschäftigt haben. Man hat sich aus diesem Grund außerhalb der Vereinigten Staaten kaum mit diesem Problem befasst. Ansätze werden jedoch trotzdem geliefert.
Die Autoren versuchen „die Gewaltkriminalität theoretisch zu fassen und auf die Existenz von Werte- und Normensystemen zurückzuführen, die den Gebrauch von physischer Gewalt gegen andere Personen regulieren und legitimieren“ (Ziatat Lamnek S.181, Z)
Ferracuti und Wolfgang befassen sich mit unterschiedlichen Einzelansätzen, wie beispielsweise mit dem psychometrischen, dem biologischen und medizinischen Ansatz, doch sind sie meistens nur mit Teilen dieser Theorien einverstanden.
Sie befassen sich vorrangig unter anderem mit folgenden Überlegungen:
- Gewalt ist in diesen bestimmten Subkulturen normativ verankert
- Nur in bestimmten Situationen wird Gewalt als korrekt angewandt betrachtet
- „Die Entwicklung einer die Gewalt begünstigende Einstellung und ihr Gebrauch sind erlernt“ Lamnek, S. 184, Z...)
- Gewalt stellt sich in dieser Subkultur als eine legitime Form dar, weswegen Schuldgefühle eher selten auftreten.
- Gewalt steht mit Ansehen, Prestige und Macht in engem Zusammenhang.
5.3 Die Kontrakultur nach Yinger
Yinger arbeitet hauptsächlich mit dem Begriff der Kontrakultur, den er „als Ergebnis eines Konflikts einer Gruppe mit der Gesamtgesellschaft“ (Zitat Lamnek, S. 163) versteht. Er stellt aber auch enge Bezüge zu der Behauptung her, dass Subkultur als ein normatives (Teil-)System einer größeren Einheit verstanden wird muss. Er nimmt dabei an, dass es zwischen diesen beiden Aussagen einen Zusammenhang gibt – so gehen Kontrakulturen aus Subkulturen hervor. Und doch hat jede ihr eigenes prägnantes Hauptnormsystem.
Yinger beschränkt den Begriff der Subkultur jedoch darauf, dass er lediglich „normative Systeme von Gruppen innerhalb einer Gesellschaft, die sich von dieser in bestimmten Eigenschaften wie Sprache, Werten, Religion oder Lebensstil unterscheiden“ (Zitat Lamnek, S.163, Z...) Gemeint sind damit beispielsweise Sekten, nicht dauerhafte Zusammenschlüsse, Cliquen oder der Zusammenschluss von einer Wissenschaftlergruppe.
Somit muss der Begriff der Subkultur auf verschiedenen Weise klassifiziert werden. Als Merkmale der Klassifizierung kann man differenzieren unter Größe der Gruppe, Lebensdauer oder Motivation.
Yinger hat Kriterien für das Vorliegen einer Kontrakultur herausgearbeitet, wobei es ihm hauptsächlich darum geht, aufzuzeigen, warum es zu Konflikten innerhalb einer Gesellschaft kommen kann.
- Die Entstehung eines Konfliktthemas zwischen einer Gruppe und der Gesamtgesellschaft
- Persönlichkeitsvariablen – und Merkmale sind direkt beteiligt und bestimmen den Zusammenschluss und das Thema bzw die Motivation des Zusammenschlusses
- Gruppennormen entstehen in der Gruppe als Reaktion auf die sie umgebende Kultur
Die Kontrakultur erklärt den Grund des abweichenden Verhaltens, jedoch sagt sie nicht über deren Entstehung aus.
Yinger differenziert also folgendermaßen zwischen Subkultur und Kontrakultur:
- Normen einer Subkultur beruhen auf normaler Sozialisation innerhalb einer Subgesellschaft. Normen einer Kontrakultur entstehen aus Konflikts- und Frustrationserfahrungen derer, die ursprünglich die gesamtgesellschaftlichen Werte teilen diese aber nicht realisieren können
- Kontrakulturelle Normen sind immer relational in Beziehung zu den abgelehnten Normen der Gesamtgesellschaft zu verstehen
- In dieser Relationalität manifestiert sich der Konflikt zwischen Kultur und Kontrakultur
- In das Konzept der Kontrakultur werden auch psychologische und sozialpsychologische Komponenten aufgenommen, weil sie für die Entstehung der Kontrakultur mitentscheidend sind.
5.4 Die Subkulturtheorie nach Cohen
Albert K. Cohen befasst sich mit der Theorie der Bandendelinquenz. Er stellt fest, dass der größte Teil dieser Banden bösartig und zerstörerisch ist, was suggeriert, dass die Handlungen der Banden negativistisch, d.h. nichtutilitaristisch, und von blinden Aggressionen geleitet ist. Die allgemeingültigen Werte der Mittelschicht haben eine Reichweite bis hin zur Unterschicht und werden auch dort, wenn zwar in abgeschwächter Form, von den Jugendlichen verinnerlicht. Nun stellt sich aber das Problem der sozialen Herkunft, aufgrund dessen die Jugendlichen den Leistungserwartungen der Mittelschicht nicht gewachsen sind, was zwangsweise zu Anpassungsproblemen führt.
Dieser Spannungszustand kann laut Cohen auf verschiedene Arten gelöst werden. Zusammenschlüsse, in denen sich mehrere Jugendliche in ähnlichen Situationen befinden, bieten die Chance neue Statuskriterien zu schaffen, die die Eigenschaften positiv bewerten, die zu den Normen und Werten der Mittelschicht different sind. Ein Wechsel der Bezugsgruppe ist eine andere Möglichkeit. Damit stellt das Individuum sicher, dass es sich in einer Gruppe befindet, die exakt die gleichen Ansprüche an das Leben stellt bzw. gleiche Orientierungen verfolgt. Der Spannungszustand kann aber auch durch eine legale Form überwunden werden, d.h. jemand mit niedrigem Einkommen bekommt durch Lottospielen die Chance auf mehr Geld.
Für die Bildung von Subkulturen und die damit zusammenhängende Beständigkeit der Abeichung nennt er unter anderem die folgenden Motive:
- Subkulturen rechtfertigen ihre Feindseeligkeit und ihr aggressives Verhalten indem sie die Schuld bei gesellschaftlich angepassten Menschen (hauptsächlich Mittelschicht) suchen
- Mitgliedern einer Subkultur wird ein gewisses Maß an Status verliehen, den sie in der Gesellschaft der Mittelschicht nicht erreichen können
- Durch den Zusammen- und Rückhalt der Gruppe werden Unsicherheit, Angst und Schuldgefühle in der Subkultur vermindert
Subkulturen stellen also eine Möglichkeit der kollektiven Lösung eines gemeinsamen Problems dar.
6. Die Subkultur der Rechtsextremen (Anwendung der Theorie von Cohen)
6.1 Versuch der Eingrenzung
Wollen wir nun wirklich an der These festhalten, dass Rechtsextremismus in Deutschland eine Subkultur bildet, müssen wir uns fragen, welche Merkmale diese Subkultur überhaupt hat. Auf diesem Wege versuchen wir nun sowohl gemeinschaftliche Eigenschaften zu erkennen, welche diese Subkultur verbindet, als auch Eigenschaften die sie von einer anderen Kultur unterscheidet. Findet man solche Dispositionen, wie zum Beispiel gemeinsame Normen und Werte, oder einen gemeinsamen sozialen Status, muss man sie im zweiten Durchgang mit den Eigenschaften der Gesamtgesellschaft vergleichen. So kann man systematisch analysieren, ob das abweichende Verhalten durch die sozialen Bedingungen oder Strukturen der Subkultur zu erklären ist.
Demgemäß wollen wir im nächsten Teil versuchen, gemeinschaftliche Kennzeichen einer potentiellen Rechtsextremen Subkultur ausfindig zu machen und diese gleichzeitig mit den gesamtgesellschaftlichen vergleichen.
Es scheint als hätte unsere Gesellschaft schon ein gefestigtes Bild einer rechtsradikalen Subkultur. Intuitiv neigen viele Menschen dazu den Prototypen eines Rechtsradikalen, als gewaltbereiten, fremdenfeindlichen und männlichen Jungendlichen mit niedrigem Bildungsstatus zu bezeichnen. Dieser, so die landläufige Meinung, komme hauptsächlich aus den neuen deutschen Bundesländern und ist eher am unteren Rand unserer sozialen Schichtung anzusiedeln. Ob dieses Bild den Tatsachen entspricht, werden wir an den Merkmalen gemeinsame Normen, Werte, sozialer Status, Altersstruktur, Herkunft, Bildung und Gewaltbereitschaft festmachen.
6.2 Normen und Werte
6.3 Alters- und Geschlechtsstruktur
Betrachtet man die Statistiken zur Alters- und Geschlechtsstruktur der Tatverdächtigen von fremdenfeindlich motivierten Straftaten, fällt auf, dass sich die These vom gewaltbereiten, männlichen Jugendlichen Straftäter zu bewahrheiten droht. 1992 wurden 3986 fremdenfeindliche Straftaten begangen. 3394 der Tatverdächtigen, das sind 85%, waren unter 25 Jahre alt. Nur 592 (15%) hatten das Alter von 25 überschritten. Es scheint also, die Gewalt gehe hauptsächlich von jugendlichen Personen aus. Jedoch muss neben den Aspekten, dass die Jugend ohnehin auch gesamtgesellschaftlich, eine höhere Kriminalitätsrate hat und gleichzeitig auch leichter anfällig ist für politische Ideologien und Gewaltverherrlichung, die Tatsache betrachtet werden, dass 1996 der Anteil der unter 25 – jährigen zwar nicht signifikant gesunken ist, aber mit minus 8 %, einen kleinen Rückwärtstrend verzeichnet. Leider muss man aber im Großen und Ganzen, in diesem Punkt, das in der Gesellschaft verbreitete Bild bestätigen. Auch bei der Geschlechtstruktur zeichnet sich ein ähnlich deutliches Ergebnis ab. 1992 waren 3679 der Tatverdächtigen männlich und nur 185 weiblich. Zwar verringerten sich die männlich Tatverdächtigen bis 1996 um fast die Hälfte, wohingegen die Zahl der Frauen stagnierte, doch die Verteilung, bei 2099 fremdenfeindlichen Straftaten, von 1914 männlichen Verdächtigen zu 185 weiblichen, ist eindeutig.
Halten wir diese Tatsachen kurz fest. Die Rechtsextremen, die abweichendes Verhalten, in Form von Verletzung der „Muss – Normen“ , also das Brechen von Gesetzen, an den Tag legen, sind hauptsächlich männlich und jugendlich, also unter 25 Jahre alt.
Schon an diesem Punkt kann man die erste Brücke zur Theorie der Subkultur schlagen. Sie lässt sich überwiegend auf die Vertreter der Chicagoer Schule zurückführen, deren Mitglieder „zum Teil aus der Sozialarbeit mit kriminellen Jugendlichen kamen“ (LAMNEK, 1979, 7. Auflage, S.142.).
Auch Cohen selbst entwickelte sein Modell, anhand von Studien über delinquente Jugendliche, die er in seinem Buch „Kriminelle Jugendliche“ sogar als die Hauptform der Subkultur sieht. Darum scheint es uns angebracht, die scheinbar vor allem aus Jugendlichen bestehende Subkultur der gewalttätigen Rechtsextremen mit der Theorie Cohen`s zu untersuchen.
6.4 Territoriale Eingrenzung (oder: Rechtsextremer Osten?)
Versuchen wir also nun die gesuchte Subkultur territorial zu bestimmen und dem Mythos nachzugehen, der Ostendeutsche sei, aus welchen Gründen auch immer, anfälliger für die Ausübung rechtsextremer Taten.
1989 wurden in Westdeutschland 255 rechtsextreme Gewalttaten verübt, davon waren 146 fremdenfeindlich. Dieser Wert stieg zwar seit 1983 konstant mit zwischenzeitlichen Wachstumsraten von über 50 % (1986), fällt aber im Gesamtbild der Tabelle weniger auf bzw. wird überdeckt von den ersten Zahlen nach der deutschen Wiedervereinigung. 1991 verzeichnete man, nun in Gesamtdeutschland, 1492 rechtsextreme Straftaten, wovon 1255, also 84%, sich direkt gegen Mensch anderer Nationalität und Herkunft richteten, sprich fremdenfeindlich waren. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies bei den rechtsextremen Straftaten ein Anstieg von fast 400% und bei den fremdenfeindlichen gar um das siebenfache höher als vor der Wende. Dieses Faktum lässt vermuten, dass der Schwerpunkt der gewaltbereiten Rechtsextremen im Osten liegt, beziehungsweise gelegen hat. Betrachtet man nämlich die Zahlen von 1996 fällt auf, dass die rechtsextremen, genau wie die fremdenfeindlichen Straftaten deutlich gesunken sind. Sie sind zwar weiterhin wesentlich höher als vor der Wende, dennoch gab es im Vergleich zu 1991/92 70% weniger Straftaten. Ausserdem sticht hervor, dass der Anteil der fremdenfeindlichen unter den rechtsextremistischen Taten von 84% 1991 auf 56,5% 1996 gesunken ist.
Nun bleiben sicherlich einige Zweifel an der Aussagekraft der Statistik und an unserer Weise diese zu interpretieren. Trotzdem wollen wir es versuchen. Es scheint, dass entweder die Rechtsextremen aus dem Osten wesentlich gewaltbereiter sind, als jene im Westen, oder dass in den neuen deutschen Bundesländern prozentual zur Gesamtbevölkerung signifikant mehr Rechtsextreme leben als in den alten Bundesländern und die Statistik um die Wende deshalb solch einen sprunghaften Anstieg verzeichnet. Wendet man die beiden Thesen auf Cohen’s Subkulturbegriff an, der diese als „eine Möglichkeit der kollektiven Lösung eines Problems“ (LAMNEK, 1979, 7.Auflage, S.155) sieht, ist man geneigt, das vermeintlich kollektive Problem als ein Ausländerproblem zu betrachten, was sowohl der egalitären Erziehung in der DDR als auch deren propagiertes Ausländerbild nahe kommen würde. Es stellt sich also die Frage, ob die rechtsextremen Straftaten in Ostdeutschland wirklich daraus resultieren, dass ein Aufeinandertreffen der Kulturen im besonderen Maße geschieht. Diese Tatsache kann jedoch nicht bestätigt werden. Die neuen deutschen Bundesländer, hatten, mit Ausnahme Berlins, 1996 nur einen Ausländeranteil zwischen 1,2 % (Thüringen) und 2,4 % (Brandenburg). Dies ist im Vergleich zu 11,1 % in NRW oder 16,4 % in Hamburg ein deutlich niedrigerer Anteil.
Fassen wir diese Tatsachen kurz zusammen und versuchen wir sie mit der Subkulturtheorie in Verbindung zu bringen. Nach der Wende stieg der Anteil der rechtsextremen Straftaten eindeutig. Bis 1996 ist er aber auch wieder stark gesunken. Die allgemein verbreitete Meinung, die Subkultur der Rechtsextremen, komme vor allen Dingen aus dem Osten, scheint man also statistisch belegen zu können. Es fällt jedoch auch auf, dass sich dieses Merkmal mit der Zeit, aufgrund der rückläufigen Zahlen rechtsextremer Straftaten, relativiert. Die Subkultur wird, was diesen Punkt betrifft, in den letzten Jahren weniger eindeutig und weniger klar eingrenzbar. Ausserdem scheint das kollektiv zu lösende Problem, wie es Cohen einer Subkultur unterstellt, bei der rechtsextremen jugendlichen Subkultur, nicht das Zusammenleben mit ausländischen Mitbürgern zu sein. Denn Fakt ist, dort wo es am wenigsten zum Aufeinandertreffen der Nationalitäten und Kulturen kam (im Osten), wurden die meisten rechtsextremen Straftaten verübt. Das Auftreten der rechtsextremen Gewalt liegt also, unserer Meinung nach, nicht im direkten Nebeneinander der Kulturen, sondern scheinbar in abstrakten Begriffen wie Normen, Werten, sozialem Status und der Art und Weise wie die Jugendlichen in ihrer Sozialisation, in ihrer spezifischen Subkultur, gelernt haben mit Menschen anderer Nationalität und Herkunft umzugehen.
6.5 Sozialer Status als gemeinsames Merkmal?
Den dritten Punkt aus dem vorangegangenen Abschnitt, der soziale Status der rechtsextremen Jugendlichen, möchten wir nun direkt aufgreifen um ihn wiederum mit Cohen’s Theorie zu verbinden und möglicherweise auch zu erklären. Cohen sieht „Devianz als eine irrationale Reaktion auf die, durch die Diskrepanz zwischen demokratischer Ideologie und Klassengesellschaft entstandenen Anpassungs- und vor allem Statusprobleme Jugendlicher der Unterschicht.“ (LAMNEK, 1979, 7.Auflage, S.153/154) Er ist der Meinung, dass das Handeln, welches eine Subkultur an den Tag legt, einen Versuch darstellt, sich an die Normen der Mittelschicht anzupassen um im Konkurrenzkampf um den sozialen Status innerhalb der Gesellschaft besser abzuschneiden. Da dies aber kaum möglich ist, weil die Normen der Mittelschicht in der Unterschicht nicht internalisiert wurden, komme es zu einem Spannungszustand, oder wie Cohen es noch bezeichnet, zu einer „Deprivation der Unterschicht“. „Der Unterschicht – Jugendliche kann nicht erreichen, was von ihm nach gesamtgesellschaftlichen Statuskriterien erwartet wird […]; teilweise übernimmt der Jugendliche diese [die Statuskriterien, C.S.] sogar für sich. So ergeben sich Statusprobleme, die zu Anpassungsproblemen führen.“ (COHEN 1961, S.90) An diesem Punkt, so Cohen haben die Personen die Wahl. Sie können weiterhin versuchen ihre Anpassungsprobleme auf legalem Wege zu lösen, sie können versuchen die Bezugsgruppe zu wechseln, die ihnen möglicherweise neue institutionalisierte Mittel zu Problemlösung anbietet, oder sie können sich zu einer Gruppe mit gemeinsamen Normen, Werten und Verhaltensweisen, zusammenschließen, kurz gesagt eine Subkultur bilden.
Stellen wir uns also nun die Frage, ob der Zusammenschluss zu einer rechtsextremen Subkultur aus einer bestimmten sozialen Schicht resultiert, oder ob eine mögliche, gleiche Schichtzugehörigkeit in dieser Subkultur nicht eindeutig auszumachen ist. Findet man eine solche Gemeinsamkeit kann man außerdem dem Zusammenhang zwischen sozialer Schicht und Gewaltausübung nachgehen.
An diesem Punkt möchten wir auf die Tübinger Untersuchung von Held, Horn, Leiprecht und Marvakis 1992 zurückgreifen. Sie befragten Jugendliche und junge Arbeitnehmer im Raum Tübingen nach ihrem politischen Orientierungen und fanden heraus, dass Benachteiligte auf den Gebieten Arbeitsplatz, berufliche Zukunft, Bildung, ökonomische Absicherung und soziale Einbindung deutlich weniger rassistisches Gedankengut an den Tag legten als Nicht – Benachteiligte. Auch Johann Bacher vom Lehrstuhl für Soziologie an der Universität Erlangen – Nürnberg konnte bei seinem Aufsatz „Arbeitslosigkeit und Rechtsextremismus“ von 1999 in der er die Forschungsergebnisse des ALLBUS 1996 und der Nürnberger BerufsschülerInnenbefragung von 1999 analysierte, nicht genau klären ob es eine Korrelation zwischen Arbeitslosigkeit bzw. niedrigem sozialen Status und Rechtsextremismus gibt.
„Auf der Grundlage der Ausführungen von Heitmeyer und Falter läßt sich ein Zusammenhang der aktuellen und drohenden Arbeitslosigkeit mit rechtsextremen Einstellungen vermuten, der sich dadurch erklären läßt, daß aktuelle oder drohende Arbeitslosigkeit zu Deprivationsgefühlen führt, die ihrerseits politische Unzufriedenheit auslösen mit der Folge, daß rechtsextreme Einstellungen und rechtsextremes Handeln verstärkt werden. Im Unterschied dazu ergibt sich kein oder ein sehr schwacher Zusammenhang der aktuellen oder drohenden Arbeitslosigkeit mit rechtsextremen Einstellungen, wenn in Anlehnung an Pfeiffer/Wetzels in (autoritären) Sozialisationserfahrungen die primäre Ursache von Rechtsextremismus gesehen wird.“ (BACHER, Arbeitslosigkeit und Rechtsextremismus 1999).
Einen empirischen Beweis für den Zusammenhang zwischen sozialem Status und Rechtsextremismus scheint es demzufolge nicht zu geben. Folglich muss man wohl feststellen, dass Cohen’s Subkulturtheorie in diesem Punkt nicht ganz zutreffend ist für die Subkultur der Rechtsextremen.
Wir haben überdies das intuitive Bild der Gesellschaft über den „Rechtsradikalen am unteren Rand der Gesellschaft“, zwar nicht widerlegen können, gleichzeitig fanden wir aber auch keinen direkten Beweis für diese Behauptung. Ob es nicht aber doch, wie Cohen behauptet ein „Auftreten einer Diskrepanz zwischen Klassengesellschaft einerseits und der demokratischen Ideologie anderseits, die einheitliche Bewährungs- und Aufstiegskriterien und den Anspruch der Chancengleichheit enthält“ (LAMNEK, 1979, 7. Auflage, S. 155) gibt, lässt sich an dieser Stelle trotz der eben angebrachten Argumente, im Rahmen dieser Hausarbeit, nicht klären.
6.6 Gewalt als Lösung? (nicht – utilitaristische Gewaltausübung)
Eine weitere Frage die man sich stellen muss, wenn man eine Soziologie des abweichenden Verhaltens betreibt, ist die Frage nach dem Sinn und Zweck des abweichenden Verhaltens. Um den Rahmen dieser Hausarbeit nicht zu sprengen, beschränken wir uns auf Normverletzungen in Form von Gewaltanwendung.
Cohen behauptet, ein weiteres Charaktermerkmal einer Basis – Subkultur ist ihre nicht – utilitaristische Handlungsausrichtung. Wir wollen dies im weiteren Verlauf anhand einer Studie überprüfen, auf die sich Wolfgang Frindte in seinem Buch „Jugendlicher Rechtsextremismus und Gewalt zwischen Mythos und Wirklichkeit“ bezieht. 1992 wurden 23 jugendliche Tatverdächtige aus der gewaltbereiten Jugendszene Thüringens interviewt und weitere 100 Strafakte von jungen Gewalttätern ausgewertet. Man fand dabei heraus, dass die am häufigsten genannten Motive für gewalttätige Straftaten Beweggründe wie Langeweile, Frust, Spaß und Hass waren. An zweiter Stelle folgten Anlässe die in das „Rechts – Links Schema“ einzuordnen sind (Gewalt gegen Linke Gruppierungen), und erst an dritter Stelle standen ausländerfeindliche Beweggründe. Diese Aussagen weisen auf noch einen weiteren relevanten Aspekt hin. Das Planen dieser Gewalttaten kann man kaum einem der Straftäter vorwerfen. Zwar ist es möglich auch affektuellen Straftaten eine Nutzenorientierung zu unterstellen, doch Nutzen bzw. eine Zielorientierung im Sinne von geplanten Gewalthandlungen, gab es den Auswertungen entsprechend selten. Noch interessanter war die Erkenntnis, dass nur „21% der Gewalttäter ihr Handeln mit allgemeinen politischen Erklärungen untersetzt“ (FRINDTE, 1995, S.65) und das nur „8% der Gewalttäter ihre Gewalttaten mit Forderungen nach einer radikalen Änderung der gesellschaftlichen Verhältnisse begründeten“ (FRINDTE, 1995, S.66). Anscheinend hat Cohen demnach auch in diesem Punkt Recht. Die Anwendung der Gewalt bei jugendlichen Subkulturen ist selten ein Mittel zur Erreichung eines bestimmten Zieles oder Vorteiles, dies gilt auch für die rechtsextreme Subkultur der heutigen Zeit. Ihr Antrieb dabei ist, wie Cohen es bezeichnen würde eher die „Böswilligkeit“ mit dem Zweck andere zu „ärgern“ und um bewusst gesellschaftliche (Mittelschicht-)Normen zu brechen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Ausländer in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 1996 in v. Hd.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Literaturverzeichnis
Lamnek, S.(1979). Theorien abweichenden Verhaltens 7.A. UTB
Frindte, W (1995). Jugendlicher Rechtsextremismus und Gewalt zwischen Mythos und Wirklichkeit. LIT - Verlag
Jansen, Mechthild M. …(Hg.) (1992). Rechtsradikalismus: politische und sozialpsychologische Zugänge. Arnoldshainer Texte ; Bd.73
Kreutzberger, W. (1984). Rechtsradikalismus in der Bundesrepublik. Materialis Verlag
Böhnisch, L. (2001). Abweichendes Verhalten. Juventa Verlag
Korte/Schäfers (2002). Einführung in die Hauptbegriffe der Soziologie 6.A. Leske und Buderich
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema des Textes "Inhaltsverzeichnis"?
Der Text untersucht Rechtsextremismus in Deutschland und analysiert, ob Anhänger des Rechtsextremismus als eine Subkultur betrachtet werden können. Dabei wird insbesondere die Subkulturtheorie von Cohen angewendet.
Welche Definitionen werden im Text erläutert?
Der Text definiert und grenzt die Begriffe Normen, abweichendes Verhalten und Rechtsextremismus/Rechtsradikalismus voneinander ab. Auch Wert werden als Grundprinzipien der Handlungsorientierung definiert.
Welche Theorien abweichenden Verhaltens werden im Text angesprochen?
Neben der ausführlich dargestellten Subkulturtheorie von Cohen werden auch die Anomietheorie von Durkheim und der Labeling Approach kurz erwähnt. Auch die These von der Unterschicht-Kultur (Miller), die Subkultur der Gewalt nach Wolfgang und Ferracuti, und die Kontrakultur nach Yinger werden betrachtet.
Was sind die Hauptmerkmale der Subkulturtheorie nach Cohen?
Cohen befasst sich mit Bandendelinquenz und stellt fest, dass Jugendliche der Unterschicht, die den Leistungserwartungen der Mittelschicht nicht gewachsen sind, sich zu Subkulturen zusammenschließen, um neue Statuskriterien zu schaffen und Spannungszustände zu lösen. Die Motive der Subkulturen liegen dabei oft in Feindseligkeit, Aggressivität und der Rechtfertigung von abweichendem Verhalten.
Welche Merkmale der Rechtsextremen werden im Text untersucht, um sie als Subkultur einzugrenzen?
Der Text untersucht die gemeinsamen Normen und Werte, die Alters- und Geschlechtsstruktur, die territoriale Eingrenzung (insbesondere die Frage, ob es einen "rechtsextremen Osten" gibt), den sozialen Status und die Gewaltbereitschaft der Rechtsextremen.
Welche Erkenntnisse gewinnt der Text bezüglich des Alters und Geschlechts der Rechtsextremen?
Statistiken zeigen, dass die Tatverdächtigen von fremdenfeindlich motivierten Straftaten hauptsächlich männlich und jugendlich (unter 25 Jahre alt) sind.
Wie bewertet der Text die These, dass Rechtsextremismus vor allem im Osten Deutschlands verbreitet ist?
Der Text räumt ein, dass die Zahlen rechtsextremer Straftaten nach der Wende im Osten stark anstiegen, aber bis 1996 wieder sanken. Der Text argumentiert aber, dass die rechtsextremen Straftaten nicht direkt mit dem Zusammenleben mit Ausländern korrelieren, da die Ausländeranteile im Osten geringer waren als im Westen.
Gibt es einen empirischen Beweis für den Zusammenhang zwischen sozialem Status und Rechtsextremismus?
Der Text verweist auf Studien, die keinen eindeutigen Zusammenhang zwischen Arbeitslosigkeit/niedrigem sozialem Status und Rechtsextremismus feststellen konnten.
Wie bewertet der Text die Gewalt als Lösung bei Rechtsextremen?
Der Text zitiert eine Studie, die zeigt, dass die Motive für gewalttätige Straftaten oft in Langeweile, Frust, Spaß und Hass liegen und dass politische Erklärungen oder Forderungen nach gesellschaftlichen Veränderungen selten eine Rolle spielen. Die Gewaltanwendung bei jugendlichen Subkulturen ist demnach selten ein Mittel zur Erreichung eines bestimmten Zieles oder Vorteiles, dies gilt auch für die rechtsextreme Subkultur der heutigen Zeit.
- Arbeit zitieren
- Christian Starke (Autor:in), Kerensa Hungerbach (Autor:in), 2005, Rechtsextremismus als Subkultur, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/109723