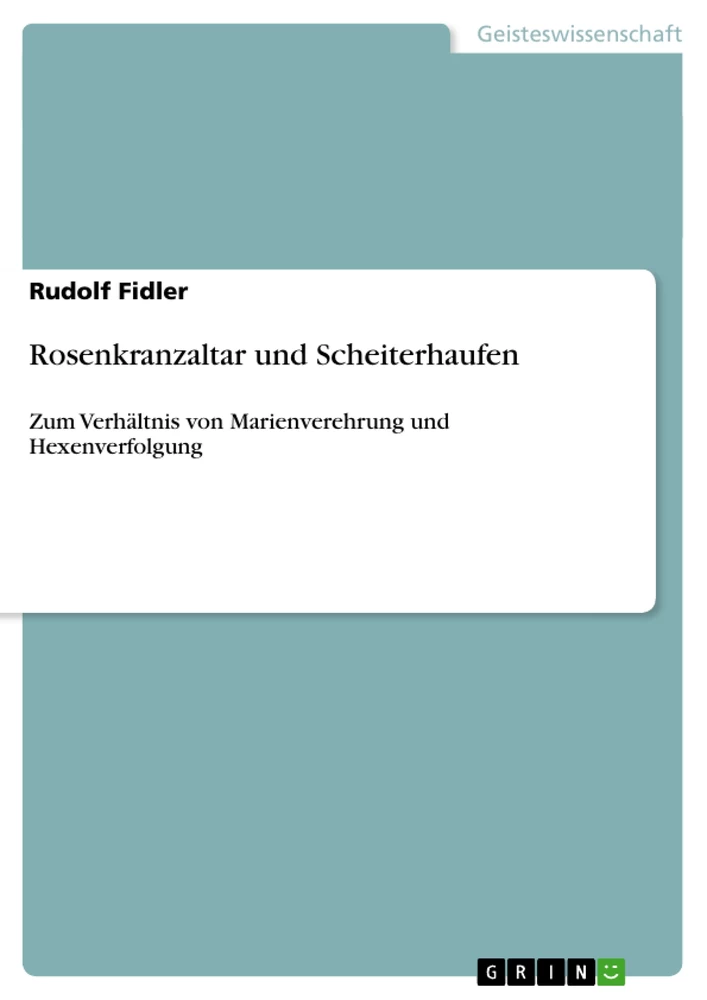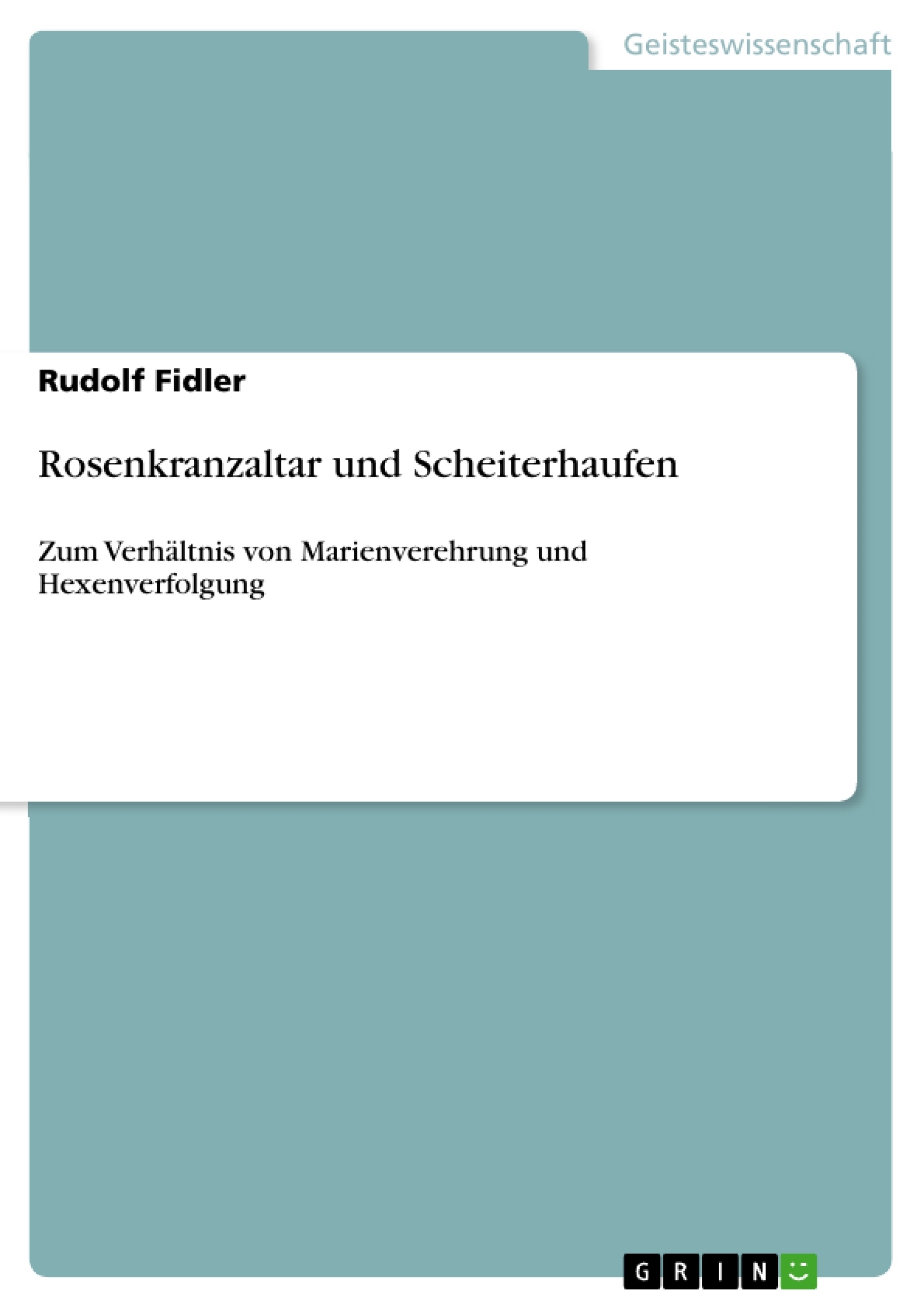Was haben ein prächtiger Rosenkranzaltar und qualmende Scheiterhaufen gemeinsam? Diese Frage führt den Leser auf eine fesselnde Reise in das Werl des 17. Jahrhunderts, einer Zeit tiefster Frömmigkeit und erschreckender Hexenverfolgung. Rudolf Fidler enthüllt in "Rosenkranzaltar und Scheiterhaufen" einen verblüffenden Zusammenhang zwischen Marienverehrung und dem düsteren Kapitel der Hexenprozesse. Entdecken Sie, wie der imposante Rosenkranzaltar in Werl, ein Symbol katholischer Andacht und Krisenbewältigung während des Dreißigjährigen Krieges, gleichzeitig als Spiegelbild eines komplexen Frauenbildes fungierte, in dem Idealisierung und Dämonisierung auf unheimliche Weise miteinander verwoben waren. Fidler analysiert die theologischen Wurzeln dieser Dichotomie, beleuchtet die Rolle von Weiblichkeit und Sexualität in der Konstruktion von Marien- und Hexenbildern und deckt die erschreckenden Mechanismen auf, die zur Verfolgung unschuldiger Frauen führten. Das Buch nimmt den Leser mit auf eine spannende Spurensuche in Archiven, um die dunkle Seite der Marienverehrung zu beleuchten, ohne die heutigen Marienverehrer zu beschuldigen. Es ist eine Analyse über mittelalterlicher Religiosität, Hexenwahn, Mariologie, und die Frauenbilder im Kontext von Hexenverfolgung. Die Rosenkranzbruderschaft, einst ein Bollwerk des Glaubens, wird hier zum Schauplatz einer verstörenden Ambivalenz. Das Buch entlarvt die Schattenseiten einer Epoche, in der die Verehrung der reinen Jungfrau Maria mit der grausamen Ausrottung vermeintlicher Hexen einherging. Abschließend wirft Fidler einen kritischen Blick auf die heutige Bedeutung des Werler Rosenkranzaltars als Mahnmal und Impulsgeber für eine zeitgemäße Auseinandersetzung mit theologischen Irrwegen und gesellschaftlichen Verdrängungen. Eine provokante These wird aufgestellt, die Konsequenzen für die heutige Kirche hat. "Rosenkranzaltar und Scheiterhaufen" ist mehr als nur eine historische Abhandlung; es ist ein aufwühlendes Plädoyer für eine differenzierte Sichtweise auf Religion, Geschlecht und die dunklen Kapitel unserer Vergangenheit. Dieses Werk ist ein Muss für alle, die sich für Kirchengeschichte, Frauenforschung, Hexenverfolgung und die Psychologie religiöser Extreme interessieren. Es bietet eine erschütternde Perspektive auf die Ambivalenz menschlicher Überzeugungen und die Gefahren ideologischer Verblendung. Lassen Sie sich von dieser brisanten Analyse in eine Zeit entführen, in der Glaube und Grausamkeit auf unvorstellbare Weise miteinander verschmolzen.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Entstehung und Funktionen des Werler Rosenkranzaltars
3 Maria und die Hexen
4 Theologische Sichtweisen von Weiblichkeit und ihre Bedeutung für die Entwicklung von Marien- und Hexenbildern
5 Die Rolle des Störfaktors Lust bei der Definition von Hexen und der Jungfrau Maria
6 Schluss - zu einer heutigen Funktion des Werler Rosenkranzaltars
7 Quellen
Rosenkranzaltar und Scheiterhaufen
Zum Verhältnis von Marienverehrung und Hexenverfolgung
Rudolf Fidler
Bei dem vorliegenden Text handelt es sich um ein Manuskript, das unter dem o.g. Titel in der Monographie: Urs Beat Frei/Freddy Bühler (Hrsg.), Der Rosenkranz - Kunst der Andacht, Bern 2003 (Begleitband zur gleichnamigen Ausstellung vom 25. Mai bis 28. November des Bruder Klaus Museums in Sachseln, Schweiz) abgedruckt ist. Die Publikation ist in Zusammenarbeit mit der Universität Luzern entstanden und enthält Beiträge eines international zusammengesetzten Autorenteams, die sich dem Phänomen 'Rosenkranz' unter volkskundlichen, frömmigkeits- und kirchengeschichtlichen, kunstgeschichtlichen, psychologischen sowie literatur- und musikgeschichtlichen Aspekten annähern.
Der Aufsatz basiert auf den Forschungsergebnissen meiner Dissertation: R. Fidler, Rosenkranzaltar und Scheiterhaufen. Das Rosenkranzretabel zu Werl/Westfalen (1631) im Wirkfeld von Konfessionspolitik, Marienfrömmigkeit und Hexenverfolgung, zugl. phil. Diss. a. d. Univ. Dortmund, Köln 2002 (Bezug über den Buchhandel oder die Homepage www.rudolf-fidler.de)
1. Einleitung
Die westfälische Stadt Werl ist vielen Katholiken nicht nur als Marienwallfahrtsort bekannt, sondern auch wegen des Rosenkranzaltars in der Propsteikirche St. Walburga aus dem 17. Jahrhundert. Dass es in Werl aber zeitgleich mit der Errichtung dieses Altars auch zur Hinrichtung von etwa 70 Hexen kam1 und Marienverehrung und Hexenverfolgung in unmittelbarem Zusammenhang stehen, ist weitgehend unbekannt geblieben. Diesem - unbewussten - Zusammenhang soll im Folgenden nachgegangen werden, aber auch den Funktionen2, die diesem Kunstwerk mit seiner Aufstellung bewusst zugedacht waren oder von ihm im Laufe der Zeit übernommen wurden.3 Nach dieser historischen Aufarbeitung soll auch nach einer möglichen heutigen Funktion dieses bedeutenden Rosenkranzaltars gefragt werden.
2. Entstehung und Funktionen des Werler Rosenkranzaltars
Signiert ist der Altar „ANNO 1631“, er entstand folglich mitten im Dreissigjährigen Krieg (1618-1648), in einer Zeit schwerster wirtschaftlicher Notlage der damals etwa 2'500 Einwohner zählenden Ackerbürgerstadt Werl. Mit der Zahlung einer horrenden Ablösungssumme von 3'000 Reichsthalern im Sommer 1622 hatte die Werler Bevölkerung gerade erst die unmittelbar drohende Einäscherung ihrer Stadt durch den für die protestantische Union kämpfenden Herzog Christian von Braunschweig verhindern können, als sie im folgenden Winter 7'000 Soldaten des kaiserlichen Entsatzheeres aufnehmen und verpflegen musste. Werl geriet dadurch ein zweites Mal in eine so tiefe wirtschaftliche Depression, dass sich die Einwohner auch 50 Jahre später noch nicht davon erholt hatten. Hinzu kamen Unwetterkatastrophen und sogar begrenzte Pestausbrüche. Als katholischem Vorposten, der auf drei Seiten von der protestantischen Grafschaft Mark umgeben war, drohten der zum Erzbistum Köln gehörenden Stadt überdies während des gesamten Dreissigjährigen Krieges Übergriffe durch die feindlichen Nachbarn. Außerdem war Werl wegen seiner fruchtbaren Ackerböden immer in der Gefahr, von marodierenden Truppen zwecks Verpflegung aufgesucht zu werden.
Irdische Notlagen ereigneten sich nach damaliger Ansicht der Menschen nicht zufällig, sondern wurden nach der bereits im Alten Testament beschriebenen Tradition als göttliche Strafe gedeutet.4 In ihrer nicht nur wirtschaftlich, sondern vor allem auch existenziell schwierigen Situation orientierten sich die Bewohner von Werl an einem Krisenbewältigungsmodell, das sich den Chroniken zufolge bereits lange vor ihrer Zeit als erfolgreich erwiesen hatte: 150 Jahre früher befand sich die Stadt Köln in einer vergleichbar ausweglosen Situation. Während des Neusser Erbfolgekriegs 1474 war das kölnische Land von den Truppen Karls des Kühnen heftig bedrängt und immer wieder verwüstet worden. Damals hatten die Kölner Bürger eine Rosenkranzbruderschaft gegründet und unablässig ihre Gebete zur Gottesmutter Maria geschickt, damit sie helfen möge, diesen Krieg zu beenden.5 Dazu schrieb der Präfekt der Rosenkranzbruderschaft, Aegidius Gelenius: „Das, was der Kaiser, die Vornehmen des Reiches, der Senat und das Volk von Köln zwar heiß ersehnt, aber schon nicht mehr erhofft hatten, wurde Wirklichkeit. [...] Niemanden gab es, der den Ruhm des Friedensschlusses nicht ganz und gar dem einen Gott zuschrieb. Nächst Gott aber bewegte den Geist fast aller die Nähe der Gottesgebärerin, die Bewunderung der Rosenkranzbruderschaft und der von Tag zu Tag größere Andrang zu ihr.“6 Die flehentliche Anrufung der Gottesmutter Maria durch die Rosenkranzbruderschaft - so jedenfalls glaubte man - hatte geholfen, den Krieg zu beenden. Die frommen Katholiken in Werl übernahmen dieses Kölner Erfolgsmodell und versuchten ihrerseits, die Gottesmutter Maria mit der Gründung einer Rosenkranzbruderschaft7 und der Stiftung eines riesigen, über zehn Meter hohen Rosenkranzaltars in ihrer Stadtpfarrkirche nicht nur auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen, sondern sie auch als Verbündete zu gewinnen. Wohl um Maria zu zeigen, wie sie helfen sollte, versahen die Werler Bürger ihren neuen Altar mit einem deutlichen Hinweis auf deren erfolgreiches Mitwirken am Kölner Friedensschluss im Jahr 1475: Sie bildeten die damals beteiligten geistlichen und weltlichen Herrscher als Bittsteller zu Füßen der Madonna ab. Ergänzt wurde die Altarstiftung durch die Opferung von drei Rosenkränzen und dreimal je fünf Vaterunsern, die jedes Mitglied der Rosenkranzbruderschaft wöchentlich verrichten sollte.
Neben seiner Funktion als Mittel des Krisenmanagements kamen dem Werler Rosenkranzaltar aber noch weitere Aufgaben zu, die mit der besonderen Situation der Stadt zur Zeit seiner Stiftung zusammenhängen. Die zwischenzeitlich (von 1547 bis 1577) bikonfessionelle Bevölkerung war 1583/84 zum Calvinismus übergetreten, aber bereits Ende März 1584 vom Kölner Erzbischof zurückerobert und im Rahmen einer gründlichen innerkirchlichen Reform des Bistums rekatholisiert worden.8 Mit der Stiftung des Rosenkranzaltars konnte die Bevölkerung ihrem Landesherrn, dem Kölner Erzbischof Ferdinand von Bayern, nicht nur demonstrieren, dass sie voll zu seinem insbesondere durch die Marienverehrung gekennzeichneten Rekatholisierungsprogramm stand. 9 Die Installation der 15 Rosenkranzgeheimnisse innerhalb der Altararchitektur stellte darüber hinaus auch ein langfristig wirksames religionsdidaktisches Medium dar, mittels dessen die wesentlichen lehramtlichen Aussagen der katholischen Kirche in konzentrierter Form abgebildet und jedem Werler Bürger zeitlebens vor Augen gestellt werden konnten.
Als erstes gemeinsames Projekt der häufig verfeindeten Gilden der Bäcker, der privilegierten Salzkocher sowie der ‚Bauleute’ (= Ackerbauern) spielte der Rosenkranzaltar für die Bürger der Stadt Werl auch eine identitätsstiftende Rolle. Rosenkranzaltar und Marienverehrung können deshalb zusätzlich als Instrumente zur Aufhebung innerstädtischer Konflikte auf einer übergeordneten, religiösen Ebene gedeutet werden. Sie stehen damit in einer seit der Spätantike nachweisbaren Tradition der Funktion Marias als Helferin bei der „Befriedung konkurrierender, sich bekämpfender sozialer Gruppen“.10
Doch nicht nur im Diesseits sollte Maria helfen, auch hinsichtlich der Jenseitsvorsorge wurde sie angerufen. Denn im Bewusstsein der Menschen war auch verankert, dass sündiges Fehlverhalten vom strengen Richtergott nicht nur im Diesseits, sondern ebenso im Jenseits geahndet würde. Viele Gläubige ängstigten sich deshalb zusätzlich vor Strafen nach ihrem Tod, z.B. in Form von längeren Fegefeueraufenthalten oder gar der Verstoßung ins ewige Höllenfeuer.
Die Anrufung der Gottesmutter im ‘Gegrüßt seist du, Maria’ berücksichtigt beide Aspekte möglicher göttlicher Strafen: Der Passus „Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes“ deckt mit der Zeitbestimmung „jetzt“ unmissverständlich die Bitte um Hilfe in der irdischen Welt ab. Die Zeitbestimmung „in der Stunde unseres Todes“ hingegen bezieht sich auf die Bitte um Unterstützung anlässlich der unmittelbar nach dem Tod anstehenden Entscheidung über die endgültige Verstoßung der Seelen in die Hölle oder deren zeitlich begrenzten Aufenthalt im Fegefeuer, an dessen Ende die Aufnahme in das Himmelreich steht. Die häufige Wiederholung des ‘Gegrüßt seist du, Maria’ im Rosenkranzgebet galt im Sinne der Werkgerechtigkeit als eine Möglichkeit, die Mutter Gottes den Bitten der ihr vertrauenden Gläubigen gegenüber geneigt zu stimmen. Auch Stiftungen waren, wie vielfach bezeugt, Versuche der Gläubigen, durch Vorleistungen günstige Voraussetzungen für das zukünftige Wohlergehen zu schaffen. Letztlich liefen solche Bemühungen darauf hinaus, dass der Gebende versuchte, zu Gott und seinen Heiligen durch das dargebrachte Opfer eine Beziehung der Gegenseitigkeit herzustellen, in welcher der Opfernde im Sinne des bereits seit der Antike gültigen Grundsatzes ‘do ut des’ (ich gebe, damit du gibst) hoffte, Gott und die Heiligen zur Erfüllung seiner Wünsche und Anliegen zu verpflichten.11
Wie wirksam sich dieser merkantile Gedanke innerhalb des Christentums hatte etablieren können, zeigen Formulierungen etwa von Tertullian12, Papst Gregor dem Großen13, und Petrus Damiani, der stellvertretend hier zitiert sei: „Was man nämlich auf Erden Gott gibt, wird im Himmel angenommen; man darf Lohn erwarten von dort, wohin die dargebrachte Gabe vorausgegangen ist. Glückbringender Austausch, bei dem der Mensch zum Leihgeber und Gott zum Schuldner wird.“14 Der Glaube an die Macht des ‘do ut des’ war im Mittelalter und darüber hinaus so stark, dass der entsprechende Gabentausch tatsächlich "gewaltige Dimensionen“ annahm.15
Auch die Stiftung sakraler Kunstwerke wurde von den Gläubigen als Vorleistung verstanden, um sich eine gute Ausgangsposition für den Eintritt ins Himmelreiches zu verschaffen. Peter Jezler weist darauf hin, dass die auf uns gekommenen entsprechenden Kunstobjekte nur die sichtbare „Spitze eines Eisbergs“ sind. Denn ein Altar zum Beispiel war gewöhnlich mit Pfründen ausgestattet, von deren Erträgen der am Altar zelebrierende Priester lebte und für deren Inanspruchnahme er rituelle Handlungen zugunsten der Stifter vollziehen musste. Weitere mit dem Altar verbundene Stiftungen z.B. in Form von Grundzinsabgaben dienten der Finanzierung von Kerzen, die vor dem Altar aufgestellt und abgebrannt wurden. Auch Armenspeisungen wurden häufig aus diesem Kapital bezahlt, das die Kirche treuhänderisch zu verwalten hatte.16
Solche Glaubensüberzeugungen, davon kann ausgegangen werden, haben sicher auch bei der Stiftung des Werler Rosenkranzaltars eine Rolle gespielt. Mit seiner Errichtung und den damit verbundenen Stiftungen sowie mit den vor ihm verrichteten Gebeten und liturgischen Handlungen sollten Sühneopfer und Vorleistungen erbracht werden, um Gott zu verpflichten, nicht nur für das irdische Wohlergehen der Betenden einzutreten, sondern auch und vor allem deren Seelenheil zu garantieren.
Marienverehrung und ihre Beziehung zum vorbürgerlichen Frauenleitbild
Betrachten wir nun den Werler Rosenkranzaltar, so fällt auf, dass die Darstellung der Muttergottes Elemente verwendet, die darauf abzielen, bei den Betrachtenden Assoziationen von Mütterlichkeit auszulösen. Das Jesuskind sitzt in kindlicher Pose auf dem Arm seiner Mutter und greift spielerisch nach der Rose17, die diese ihm entgegenhält. Die Haltung der Gottesmutter kann leicht als Ausdruck des mütterlich-spielerischen Umgangs mit einem Kleinkind wiedererkannt werden. Marias Gesicht ist über eine Diagonale mit ihrem Kind verbunden, so dass der Eindruck mütterlicher Hin- und Zuwendung entsteht. Der nachdenklich-versunkene Blick ist unschwer mit den um die Gottesmutter angeordneten Rosenkranzgeheimnissen in Beziehung zu setzen und als Ausdruck ahnungsvoller mütterlicher Sorge zu verstehen.
Die in der biblischen Überlieferung als Mutter des Gottessohnes bezeugte Maria musste im Umgang mit Jesus viele Erfahrungen machen, die auch Mütter irdischer Kinder erleben: Von der Babypflege über widerfahrenes Unverständnis (anlässlich des Auftretens ihres 12-jährigen Sohnes im Tempel von Jerusalem), bis zur Konfrontation mit dem sich emanzipierenden Nachwuchs (anlässlich des Weinwunders zu Kana); mütterliches Leid und Einsamkeit, Schmerz, aber auch Verbundenheit mit dem Kind in Extremsituationen sowie Trauer über dessen Tod und darüber hinaus. Insofern konnte Maria für Frauen grundsätzlich attraktiv sein und als Identifikationsfigur akzeptiert werden. Wegen der in den Evangelientexten nicht eindeutig fassbaren, offenen Biographie konnten allerdings spätere Autoren ihr auch zusätzliche - als wünschenswert erachtete - Merkmale zuordnen und sie seit der Frühen Neuzeit sogar als Leitmedium zur Propagierung eines Frauenideals instrumentalisieren, das wesentlich durch den Aspekt der Mutterschaft definiert wurde.18 Manuel Simon spricht in diesem Zusammenhang davon, dass „Mediziner und Theologen die Frau aus gesundheitlichen und moralischen Gründen ins Haus verwiesen und sie einem strikten Reglement unterwarfen, das sie von der Schwangerschaftsdiät bis zur Kindererziehung auf ihre Mutterpflichten festlegte.“19
Wegen der im Zweiten Testament zu findenden Aussagen: „Ich bin die Magd des Herrn" und „mir geschehe, wie du gesagt hast“ (Lk 1,38), war Maria außerdem geradezu dafür prädestiniert, ein Frauenbild theologisch zu legitimieren, das die dienende Funktion und den Gehorsam gegenüber dem Mann betonte. Der als „zweiter Apostel Deutschlands“20 gerühmte Jesuit Petrus Canisius (1521-1597) zum Beispiel betonte in seinem Marienwerk ‚De Maria virgine Incomparabile et Dei Genitrice Sacrosancta’(Maria, die unvergleichliche Jungfrau und hochheilige Gottesgebärerin) besonders die vorbildliche Einstellung Marias gegenüber ihrem Ehemann Josef: „Und sie hielt ihren Mann für ihren wahren Vorgesetzten und schätzte ihn so hoch, wie nur überhaupt eine Frau ihren Mann hochschätzen kann. Treu gehorchte sie ihm, als es hieß, nach Bethlehem sich aufzumachen, um dort die Steuer zu zahlen, ebenso bei der Flucht nach Ägypten und auf der Rückreise nach Galiläa nach dem Tode des Herodes und wo sonst noch Aufenthalt zu nehmen war“.21 Die angeblich vorbildliche weibliche Unterordnung Mariens konnte so die in den Eheschriften des 16. Jahrhunderts enthaltenen Aussagen unterstützen, welche die Frau vornehmlich als Objekt der innerehelichen Kontrolle und Erziehung ansahen, die vom vernunftbegabteren und willensstärkeren Mann geleistet werden sollten.22
Neben demütigem Gehorsam und Mütterlichkeit galten auch Affektbeherrschung und rationales Verhalten als zunehmend wichtigere gesellschaftliche Leitziele der Neuzeit.23 Gerade Frauen wurden jedoch im Gegensatz zu Männern traditionell als affektgesteuert und wenig rational denkend angesehen.24 Genau an dieser Stelle setzt die - hier durch Canisius vertretene - katholische Theologie an, indem sie den Frauen in der Person der Gottesmutter Maria ein neues Leitbild vorgibt: „Bei Maria war dies nicht so. Sie beherrschte alle ihre Gefühle in der rechten Weise.“25 Offensichtlich um diese Aussage zu unterstreichen, fährt Canisius fort, indem er einige ältere Autoren zitiert: „Johannes Damascenus [675-749?] sagt: ‘sie war frei von jeder Störung der Seele’. [...] Epiphanius [9. Jh.] lehrt: ‘Maria war immer gemäßigt, blieb sich immer gleich, hatte niemals ungeordnete Affekte, gebrauchte alle Regungen ihrer Seele aufs beste und hielt sie auch beim Tode des Herrn in den rechten Schranken’.“26 Diese Zitate ergänzt Canisius dann mit eigenen Behauptungen über Marias Gefühlsleben, die in die gleiche Richtung weisen: „Bei einer solchen Jungfrau aber sind ungeordnete Regungen der Leidenschaften ganz ausgeschlossen; denn es gehört zur Tugend, sie zu beherrschen. [... Maria] war in allem überaus ehrbar, gemäßigt, besonnen, umsichtig, und zwar so sehr, daß man sie nicht genug bewundern kann.“27
Auffällig ist, dass die kämpferische Maria und ihr prophetisch-revolutionäres Magnificat (Lk 1,46-55) bei einer solchen Betrachtung völlig ausgeblendet werden. Auch Marias autonome Mitwirkung am befreienden Handeln des Gottessohnes wird meines Erachtens nur unzureichend gewürdigt, wenn sie vorrangig unter dem Aspekt ihrer demütigen Unterwerfung interpretiert wird. Der Neutestamentler Detlev Dormeyer jedenfalls sieht in Marias (bereits zitierter) Antwort: „mir geschehe, wie du gesagt hast“ (Lk. 1,38) weniger ein ängstlich-demütiges Zurückweichen vor einer überwältigenden göttlichen Macht, denn vielmehr eine reflektierte, selbstbestimmte Entscheidung, und er verweist darauf, dass diese erst nach kritisch-zögernder Nachfrage („Wie soll das geschehen?“, Lk 1,34) getroffen wurde.28
Rosenkranzaltar und Scheiterhaufen
Im Rahmen der Recherchen zum Rosenkranzaltar wurden im Stadtarchiv der Stadt Werl Quellen entdeckt, die eindeutig darauf hinweisen, dass - wie eingangs erwähnt - zeitgleich mit der Errichtung des Rosenkranzaltars in Werl auch 70 Hexenprozesse stattgefunden haben.29 Weiter ist bekannt, dass der Gründer der Rosenkranzbruderschaft in Deutschland, der Dominikaner Jakob Sprenger (1436-1495),30 mit jenem Jakob Sprenger identisch ist, der als (Mit-) Verfasser des Malleus maleficarum (Der Hexenhammer) traurige Berühmtheit erlangt hat. Der 1487 erstmals erschienene und von ihm und seinem Mitbruder Heinrich Institoris (Kramer) verfasste „Malleus maleficarum“31 gilt als Standardwerk der Hexenliteratur und lieferte fast 200 Jahre lang in Europa die juristischen Grundlagen für die Durchführung von Hexenprozessen. Auch wenn Zweifel über das Ausmaß der geistigen Urheberschaft Sprengers am ‚Hexenhammer’ möglich sind, bleibt doch festzuhalten, dass seine 1481 erfolgte Ernennung zum Inquisitor in den Erzbistümern Mainz, Trier und Köln ebenso unbestritten ist wie der ihm 1484 zusammen mit seinem Ordensbruder Heinrich Institoris erteilte Auftrag zur Verfolgung von Hexen in der sog. 'Hexenbulle' des Papstes Innozenz VIII. 32
Bezüglich der Stadt Werl stellte sich bei den Recherchen im Stadtarchiv des weiteren heraus, dass der Werler Bürgermeister und Jurist Dr. jur. utr. Johann Poelmann († nach 1715) vor seiner dortigen Tätigkeit als Hexenkommissar im paderbornischen Fürstenberg eine Untersuchung gegen Hexen geführt hatte, in deren Folge 26 Personen beiderlei Geschlechts enthauptet und verbrannt worden waren, weil sie angeblich das Dorf hatten in Brand stecken wollen.33 In Werl setzte sich Poelmann dann kurz nach seinem Amtsantritt 1701 dafür ein, dass die Bevölkerung zusammen mit den Franziskanern vor dem Marien-Gnadenbild der dortigen Wallfahrtsbasilika Mariae Heimsuchung eine Novene abhielt, um Kloster und Stadt vor Feuersbrünsten zu bewahren.34
Diese wenigen Hinweise illustrieren, dass es sich bei der eingangs beschriebenen Gleichzeitigkeit von Marienverehrung und Hexenverfolgungen in Werl wohl kaum um einen Einzel- oder gar Zufall gehandelt haben kann. Jedenfalls berichtet der als großer Marienverehrer und Verfasser des Werkes ‚De Maria Virgine ...’35 bereits erwähnte Petrus Canisius (1521-1597), dass zu seiner Zeit „Hexen allenthalben verbrannt würden und daß es niemals zuvor so viele gegeben habe“.36
Ausdrücklich soll an dieser Stelle festgehalten werden, dass trotz dieser auffälligen Fälle von Synchronizität und Personalunion zur Zeit des 15.-17. Jahrhunderts keinerlei Anlass besteht, Rosenkranzbruderschaften oder gar heutige Marienverehrer in einen wie auch immer gearteten Zusammenhang mit Hexenverfolgern zu bringen! Beunruhigend bleiben die genannten Tatsachen aber dennoch. Schliesslich kommt ihnen zusätzliche Bedeutung zu, wenn man berücksichtigt, dass der als machtvoller Kritiker der Hexenverfolgungen bekannte Jesuit Friedrich Spee von Langenfeld (1591-1635) gerade nicht als großer Marienverehrer in Erscheinung getreten ist. Die Hamburger Historikerin Anne Conrad stellt sogar ausdrücklich fest, dass dieser Theologe „Distanz gegenüber Maria“ hatte.37 Vor dem Hintergrund solcher Beobachtungen kann die Frage nach möglichen Verbindungen zwischen Marienverehrung und Hexenverfolgungen nicht länger abgewiesen werden. Ihr wird im Folgenden nachgegangen, wodurch eine weitere Funktion des Werler Rosenkranzaltars in den Blick kommt: die kompensatorische.38
3 Maria und die Hexen
Eine weiter gehende Beschreibung der im Zentrum des Werler Rosenkranzaltars stehenden Gottesmutter Maria macht deutlich, dass alle bei dieser beobachtbaren, positiven Zuschreibungen nur umgekehrt werden müssen, damit Marias exaktes Gegenteil in Gestalt einer Hexe39 aufscheint: Während Maria in einer besonderen Beziehung zu Gott steht, haben die Hexen einen Pakt mit dem Teufel geschlossen und sich dem Bösen unterworfen. Durch Maria ist das Heil in der Gestalt des Erlösers in die Welt gekommen, durch die Hexen wird Schaden und Unheil auf der Erde verbreitet. Und die bereits angesprochene, sichtbare Geste der Hinwendung der Gottesmutter zu ihrem göttlichen Sohn symbolisiert Marias Mütterlichkeit und (Mit-)Menschlichkeit. Auf diese Weise konnte die Mutter Gottes deutlich von den natürlich nicht dargestellten, doch im zeitgenössischen Bewusstsein vorhandenen Vorstellungen von Hexen abgehoben werden. Letztere sind mit dem Teufel verbunden und schaden ihren Mitmenschen. Maria hat als neue Eva den Teufel besiegt, Hexen dagegen haben sich ihm in der Nachfolge der alten, sündigen Eva unterworfen.
Weitere aufeinander bezogene Gegensätze zwischen Maria und den Hexen ergeben sich hinsichtlich der kirchlichen Lehre von der allzeit reinen, von Sünde und Sexualität unbefleckten Jungfrau Maria auf der einen und der Unterstellung von Teufelsbuhlschaft und sexuellen Orgien bei den Hexen auf der anderen Seite. Hexen wurde der Umgang mit teuflischen Mächten und Dämonen nachgesagt,40 Maria hingegen hat persönlichen Umgang mit dem Gottessohn und befindet sich, den Lehren der Kirche zufolge, seit ihrem Tod im Himmel in der unmittelbaren Nähe Gottes. Es fällt auf, dass Maria zeitgleich mit der Entwicklung eines sexualisierten Hexenstereotyps41 immer idealisierter und überirdischer dargestellt wurde und sich so auch immer mehr als Projektionsfläche aller als positiv erachteten weiblichen Eigenschaften anbot.
Verallgemeinernd lässt sich feststellen, dass die Vorstellungen von Maria und den Hexen während der Frühen Neuzeit durch Inversion durchgängig miteinander verknüpft waren und sich wechselseitig bedingten. Das Schaubild und die anschließende Tabelle machen dies deutlich:
Das Prinzip der Umkehrung als Bindeglied zwischen Maria und den Hexen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Maria und die Hexen - ein Vergleich
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Als besonders problematisch muss in diesem Zusammenhang auch das unter der Folter erpresste ‚Geständnis’ einer Hexe angesehen werden, in welchem sie alle ihr zu Last gelegten Phantasie-Untaten bestätigen musste.42 Für den Hexenverfolgungsgegner Friedrich Spee war klar, dass solche von Frauen unter der Folter erpressten bzw. aus Angst vor der Folter gemachten Geständnisse keinerlei Wert haben und allein aufgrund der gezielten Fragen der Peiniger zustande kamen.43 Auf die meinungsbildende Funktion solcher Geständnisse, die Spee als wesentlich für die Ausbreitung von Hexenglauben und -verfolgung ansah, und auf die Bedeutung der weltlichen Gerichte für die Verbreitung der Ideen von Teufelspakt und Teufelsbuhlschaft hat Heide Wunder hingewiesen.44 Der Bevölkerung blieb angesichts einer solchen ‚Beweislage’ nichts anderes übrig, als den Fachleuten zu glauben und mit ihnen gegen die Hexen in den Kampf zu ziehen.
Marienverehrung und Hexenwahn stellen sich damit vor dem Hintergrund einer solchen durch Inversion gekoppelten Zuordnung weiblicher Eigenschaften als extreme Pole eines spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Frauenbildes dar, das wesentlich durch Idealisierung und Dämonisierung von Weiblichkeit (s.u.) und durch eine negative Einschätzung der Sexualität als böse und teuflisch gekennzeichnet ist.45 Der enge zeitliche Zusammenhang zwischen der Errichtung des Rosenkranzaltars (1631) und dem Höhepunkt der Hexenverbrennungen in Werl (1628‑30) erweist sich deshalb ebenso wie die Personalunion von Hexenverfolgern und Marienverehrern während der Frühen Neuzeit nicht als zufällig, sondern als inhaltlich bedingt. Die Rosenkranzaltarstiftung zu Ehren Marias und die Hexenverbrennungen erscheinen unter solchen Aspekten als logische Konsequenzen eines durch Überhöhung und Verteufelung gekennzeichneten Frauenbildes und einer darauf aufbauenden irrationalen Idealisierung und Dämonisierung weiblicher Eigenschaften, bei deren Festlegung dem Faktor ‚Sexualität’ eine besondere Bedeutung zukommt (s.u.).
4 Theologische Sichtweisen von Weiblichkeit und ihre Bedeutung für die Entwicklung von Marien- und Hexenbildern
Als grundlegender Text für die Sichtweisen von Weiblichkeit innerhalb der Kirche gilt die bekannte Geschichte des Sündenfalls der Urmenschen Adam und Eva sowie der darauf folgenden Vertreibung der beiden aus dem Paradies (Gen 2,16f; 3,1-24).
Nach Eva Schirmer erfolgte die männliche Auslegung dieser Stellen seit der Antike im wesentlichen auf der Grundlage folgender, durchgängig beobachtbarer Motive:
- „Die Frau ist minderwertig oder zweitrangig, weil sie als zweite geschaffen wurde.
- Sie ist leichter zu verführen, also weniger gläubig als der Mann.
- Durch ihre Sünde ist der Tod in die Welt gekommen.
- Sie ist selbst daran schuld, dass sie dem Mann untertan ist; vor dem Sündenfall durfte sie ebenfalls herrschen.
Dazu kommt in unterschiedlichen Ausprägungen, vor allem in der Westkirche:
- Sie ist stärker von ihrer Sexualität bestimmt und verführt den Mann eben dadurch zur Sünde.“46
Weibliche Autoren dagegen, die sich mit der Geschichte vom Sündenfall auseinandergesetzt haben, kamen zu ganz anderen Deutungen. Die im Mittelalter hochangesehene Hildegard von Bingen (1098-1179) etwa legte dar, es sei für die Menschheit von Vorteil gewesen, dass Eva in Gen 3 zuerst gesündigt habe,47 und die französische Schriftstellerin Christine de Pizan (1365-1430) deutete in ihrem Werk „Stadt der Frauen“ (um 1400) gar die ganze Sündenfallgeschichte positiv.48
In der für uns fraglichen Zeit, zu Beginn des 17. Jahrhunderts, setzte sich Lucretia Marinella mit der Schöpfungsgeschichte auseinander und zeigte, dass sich auch die Erschaffung der Frau aus der Rippe des Mannes (Gen 2, 21f) positiv zugunsten der Frauen auslegen lässt: „... denn da die Frau aus der Rippe des Mannes, der Mann aber aus Lehm und Erde gemacht ist, so ist sie sicherlich hervorragender als der Mann; ist doch die Rippe unvergleichlich edler als der Lehm. Fügen wir hinzu, daß sie im Paradies, der Mann außerhalb davon geschaffen wurde. Wie scheint es euch: sind nicht die Ursachen, von denen die Frauen abhängen, edler als jene der Männer? Und daß die weibliche Natur weit wertvoller und edler als die der Männer ist, beweist auch ihre Entstehung, denn da die Frau nach dem Mann entstanden ist, ist es notwendig, daß sie auch hervorragender ist als er, so wie die weisen Schriftsteller sagen, daß die zuletzt entstandenen Dinge edler seien als die ersten.“49 Außerdem lehnt Marinella die von den Männern immer wieder behauptete Schuld Evas am Sündenfall mit einer auf Gen 3 gestützten Argumentation ab: „Zum Schluß muß ich noch auf die leichtfertigen Argumente einiger Männer eingehen. Hauptsächlich führen sie an, Eva sei Ursache für die Sünde Adams und folglich für unseren Fall und unser Elend gewesen. Ich antworte, daß Eva den Mann in keiner Weise zur Sünde brachte, sondern ich glaube, daß sie ihm vielmehr einfach vorschlug, von der verbotenen Frucht zu essen. Doch liest man nicht in der Bibel, daß sie ihn mit Bitten, Klagen oder zornigen Worten dazu antrieb, vielmehr glaube ich, sie brachte ihn auf dem Weg des guten Rats dahin, es sei gut, von dieser edlen Frucht zu essen. Denn dadurch würden sie über alles Maß hinaus groß und vortrefflich. Doch sie wußte nicht, daß davon essen Sünde war, und ebensowenig erkannte sie, daß die Schlange, welche ihr Größe versprach, der Teufel war. [...] Wenn sie ihn also nicht erkannte und von Gott keinen Befehl hatte, nicht davon zu essen, wie können wir dann sagen, daß sie sündigte? Denn die Sünde setzt ja eine vorangehende Erkenntnis voraus. Wohl aber sündigte Adam, der das Gebot Gottes überschritt, der ihm zuvor angezeigt hatte, er dürfe nicht davon essen. Und daß es sich um die Sünde Adams handelte, zeigt klar die ihm verhängte Strafe [...], denn daraufhin befahl das alte Gesetz die Beschneidung der Männer wegen des begangenen Irrtums. Deshalb hängt die Erbsünde mehr vom Mann als von der Frau ab. Dies zeigt Gott selbst, der ruft: ‘Adam, wo bist du?’ Er rief nicht Eva sondern ihn, um ihn wegen des begangenen Irrtums zu tadeln - offenbar ein Zeichen, daß er es war, der die Sünde begangen hatte, nicht die Frau. Und wenn sie die Ursache dafür war, dann aus Unwissenheit, nicht wissend, daß sie sündigte; aber der Mann sündigte aus sicherer und gewisser Kenntnis. Und wenn es so ist ..., dann kann ich keinen Grund finden, weshalb die Männer der Frau den Grund unseres Elends zuschreiben - außer wenn ich sage, daß sie sich wie blinde Eulen vor der leuchtenden Sonne der Wahrheit verhalten.“50
In der kirchlichen Praxis allerdings hatten solche ‚vorfeministischen’ Auslegungen keinerlei Bedeutung, sie wurden schlichtweg ignoriert. Wesentlich mehr Einfluss auf die Sichtweisen von Weiblichkeit hatte die Feststellung des Dominikaners Thomas von Aquin (1225/26-1274), des wohl einflussreichsten mittelalterlichen Theologen: „Hinsichtlich der Einzelnatur ist das Weib etwas Mangelhaftes und eine Zufallserscheinung; denn die im männlichen Samen sich vorfindende Kraft zielt darauf ab, ein ihr vollkommen Ähnliches hervorzubringen. Die Zeugung des Weibes aber geschieht auf Grund einer Schwäche der wirkenden Kraft wegen schlechter Verfassung des Stoffes.“51 Da Gottes Schöpfung aber nicht unvollkommen sein konnte, durfte die Frau als „verfehlter Mann“ bei der Urbegründung der Dinge nicht hervorgebracht werden.52
Auf dieser von einer der höchsten mittelalterlichen Autoritäten verkündeten und damit nicht mehr hinterfragbaren Grundlage konnten später Jakob Sprenger, auch er war Dominikaner, und sein Mitbruder Heinrich Institoris aufbauen und weitere unglaublich negative Feststellungen über Frauen entwickeln, die diese ihrer Ansicht nach dazu prädestinierten, dem Teufel in die Hände zu fallen und Hexenwerke zu treiben. Im Hexenhammer informieren sie ihre Leser, „warum bei dem so gebrechlichen Geschlechte [der Frauen] diese Art der Verruchtheit [=Hexerei] mehr sich findet als bei den Männern.“53
„Einige Gelehrte [...] sagen, es gebe dreierlei in der Welt, was im Guten und Bösen kein Maß zu halten weiß: die Zunge, der Geistliche und das Weib, die vielmehr, wenn sie die Grenzen ihrer Beschaffenheit überschreiten, dann eine Art Gipfel und höchsten Grad im Guten und Bösen einnehmen. [...] Von der Bosheit der Weiber wird gesprochen Prediger [Buch Koheleth] 25: ‘Es ist kein schlimmeres Haupt über dem Zorn des Weibes. Mit einem Löwen oder Drachen zusammen zu sein wird nicht mehr frommen als zu wohnen bei einem nichtsnutzigen Weibe’. Und neben mehreren, was ebendort über das nichtsnutzige Weib vorangeht und folgt, heißt es zum Schlusse: ‘Klein ist jede Bosheit gegen die Bosheit des Weibes’. Tullius [Marcus Tullius „Pseudo-Cicero“54 ]endlich sagt [in] ‚Rhetor[ica ad Herrenium’, 4,16,23]: ‘Die Männer treiben zu einem jeden Schandwerke einzelne, d.h. mehrere Ursachen an, die Weiber zu allen Schandwerken nur eine Begierde: denn aller Weiberlaster Grund ist die Habsucht’; und Seneca [um 4 v.Chr.-65 n.Chr.]sagt in seinen Tragödien: ‘Entweder liebt oder hasst das Weib; es gibt kein Drittes. Dass ein Weib weint, ist trügerisch. Zwei Arten von Tränen sind in den Augen der Weiber, die einen für wahren Schmerz, die andern für Hinterlist; sinnt das Weib allein, dann sinnt es Böses’.“55
Als weitere Gründe, die erklären, „weshalb sich die Weiber in größerer Zahl als die Männer abergläubisch zeigen,“56 nennen die beiden Dominikanerpatres: „... der erste [Grund] ist der, dass sie leichtgläubig sind; und weil der Dämon hauptsächlich den Glauben zu verderben sucht, deshalb sucht er lieber diese auf. Der zweite Grund ist, weil sie von Natur wegen der Flüssigkeit ihrer Komplexion leichter zu beeinflussen sind zur Aufnahme von Eingebungen durch den Eindruck gesonderter Geister. [...]Der dritte Grund ist, dass ihre Zunge schlüpfrig ist, und sie das, was sie durch schlechte Kunst erfahren, ihren Genossinnen kaum verheimlichen können und sich heimlich, da sie keine Kräfte haben, leicht durch Hexenwerke zu rächen suchen.“ Zusammenfassend wird festgestellt: „[...] also schlecht ist das Weib von Natur, da es schneller am Glauben zweifelt, auch schneller den Glauben ableugnet, was die Grundlage für die Hexerei ist.“57 Als abschließende Antwort auf die Frage, welche besonderen Eigenschaften die Frauen zur Hexerei prädestinieren, wird im Hexenhammer verkündet: „Alles geschieht nur aus fleischlicher Begierde, die bei ihnen unersättlich ist. Sprüche am vorletzten: ‘Dreierlei ist unersättlich (etc.) und das vierte, das niemals spricht: es ist genug, nämlich die Öffnung der Gebärmutter’. Darum haben sie [die Frauen]auch mit den Dämonen zu schaffen, um ihre Begierden zu stillen.“58
5 Die Rolle des Störfaktors Lust bei der Definition von Hexen und der Jungfrau Maria
Die von Petrus Canisius, dem wie gesagt grossen Marienverehrer und bekannten Organisator der Gegenreformation in Deutschland, im 16. Jahrhundert im Rahmen seines Marienstandardwerkes „De Maria Virgine ...“59 geleistete und für uns wegen ihrer zeitgenössischen Resonanz besonders aufschlussreiche Zusammenstellung der Quellen einer fast 1000jährigen Tradition christlichen Nachdenkens über Eva und Maria (Justin 2. Jh. - Innozenz III. 12. Jh.) kreist in immer wieder neuen Formulierungen um eine einzige zentrale Aussage: Evas Versagen sei durch die Leistungen Marias aufgewogen worden. An sich ist das nichts Neues, interessant aber ist es, zu verfolgen, wie in der von Canisius geordneten Zusammenstellung zunächst die Ursachenpaare Unglauben-Glauben und Ungehorsam-Gehorsam als die entscheidenden Weichen dafür eingeführt werden, wie Unheil beziehungsweise Heil in die Welt gelangen. Im weiteren Verlauf seiner Darstellung lässt dann der Jesuit den Benediktiner Rupert von Deutz (1075/80-1129) zu Wort kommen, um die Gegensatzpaare Unglauben-Glauben und Ungehorsam-Gehorsam durch eine sexualisierte Betrachtung der Frauen Eva und Maria zu ergänzen: Rupert ordnet Eva die Schande zu „wegen ihrer Lüsternheit, von der sie gleichsam trieft,“ während über Maria „nicht die Nacktheit der bösen Lust“, sondern der „Heilige Geist“ gekommen sei. Wobei die Verdammung der „bösen Lust“ und das Lob der Keuschheit eine metaphysische Überhöhung erfahren in dem Sinne, dass Rupert diese Ansicht nicht als die eigene deklariert, sondern als direkt aus dem Munde Gottes empfangene. So heisst es denn bei Canisius: „Rupert von Deutz läßt Gott zu Eva und Maria sprechen.“60
Das Kapitel „Eva und Maria: ein Vergleich“ bei Canisius liefert nicht nur Hinweise auf gewisse Vorstellungen von Männern bezüglich gutem und schlechtem Verhalten von Frauen, sondern macht auch deutlich, dass in der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Theologie nicht - wie vielfach angenommen - Maria, sondern Eva „die konstitutive Rolle in der Entwicklung des theologischen Frauenbildes“ zukommt. „Aufgrund der antithetischen Struktur bleibt die Gestalt Marias unabdingbar an die Evas gebunden.“61 Die damit vorgenommene Festschreibung des Negativen in Eva und des Positiven in Maria enthält darüber hinaus eine inhaltliche Bestimmung des christlichen Rollenbildes von Frauen. Dabei spielt "die Beurteilung menschlicher Sexualität eine wesentliche Rolle [...]. Die sogenannte Verführung Evas wird sexualisiert und mit Frau gleichgesetzt, wovon Maria und mit ihr die Jungfrauen deutlich abgesetzt werden.“62 Die von Demosthenes Savramis beobachtete „Umfunktionierung der Marienverehrung in eine sexualfeindliche Ideologie“63 könnte darum auch erklären, warum die Phänomene Rosenkranzaltar und Hexenverbrennung in Werl zeitgleich zu beobachten sind. Die Vernichtung der mit Sexualität assoziierten bösen Hexen wäre dann ‚nur’ der logisch konsequente Gegenpol zur Verehrung der sexuell enthaltsamen, guten Jungfrau Maria.
Im Hexenhammer wird die Frau in der Nachfolge der alten sündigen Eva „zum Inbegriff der concupiscentia [Begehrlichkeit, Begierde, böse Lust64 ], welche die Ursache aller Sünden und zugleich das Verbindungsglied zu den dämonischen Mächten darstellt. [...] Es ist also nicht die Vorstellung von der biologisch bedingten Fragilität des weiblichen Geschlechts, sondern das Bild von der boshaften, sündhaften und vor allem wollüstigen Frau, das der Hexenlehre zugrunde liegt.“65
Die im Rahmen der genannten Eva-Maria-Antithese entwickelte Zuspitzung des Frauenbildes auf eine ‚gute’, sexuell abstinente Maria und eine ‚böse’, sexualisierte Eva diente neben der Dämonisierung der Hexen auch einer ganz allgemeinen Verdammung von Sexualität. Nur der Fortpflanzung dienende Sexualakte wurden von der Kirche offiziell gebilligt; ansonsten predigte sie sogar die Keuschheit in der Ehe als erstrebenswertes Ziel. Enthaltsamkeit als einziges kirchlich anerkanntes Mittel der Familienplanung wurde auf diese Weise zu einem besonders hohen Gut stilisiert und wiederum durch einen metaphysischen Kontext zusätzlich legitimiert. Petrus Canisius meint: „An Maria und Joseph ist den christlichen Eheleuten ein Beispiel gezeigt, daß sie in einer wahren Ehe miteinander leben können kraft beiderseitigen Ehekonsenses, ohne daß ein fleischlicher Verkehr stattfindet und daß die Ehe dadurch nicht ungültig, sondern noch fester wird, wenn keine Vermischung der Leiber stattfindet, falls die gegenseitige Liebe bewahrt wird.“66 Die während der Frühen Neuzeit auch von nichtkirchlicher Seite geförderte zunehmende Affektbeherrschung und Triebunterdrückung67 konnte also auf der von der Kirche seit Jahrhunderten propagierten Sexualfeindlichkeit aufbauen. Auf der gesellschaftlichen Ebene erfuhr die sexualisierte Ursünde Evas, von der laut kirchlicher Überlieferung das gesamte Frauengeschlecht „in seinem Verlangen nach dem Mann“ (Gen 3,16) betroffen war, eine Weiterentwicklung sowie die Zuspitzung auf den Prototyp der wollüstigen Hexe hin.
Maria und die Hexen bzw. Marienverehrung und Hexenverfolgung erweisen sich mithin als Kehrseite eines in der Frühen Neuzeit eingeleiteten Zivilisations- und Verdrängungsprozesses.68 In diesem Zusammenhang sind u.a. die Unterstellungen zu sehen, denen zufolge die als Hexen verdächtigten Frauen mit dem Teufel und seinen Dämonen sexuelle Orgien feierten. Ihren gegenteiligen Ausdruck fand die Verdrängung der Sexualität in der gleichzeitig zu beobachtenden Entsexualisierung und Idealisierung der Mutter Gottes.
Aus der ursprünglich vor allem apologetisch bedingten jungfräulichen Geistempfängnis69 entstanden als Folge dieser Entwicklung eine zunehmend biologisch definierte asexuelle Empfängnis und eine angeblich jegliche Sexualität ablehnende Jungfrau Maria. Im 19. Jahrhundert wurde im Rahmen der Festlegung des Immaculata-Dogmas (1854) von der Kirche sogar verkündet, dass bereits die Empfängnis Marias im Schoß ihrer Mutter Anna ohne Lustempfindungen erfolgte, damit die ‚Sünde Adams’ nicht an Maria hatte weitergegeben werden können.70 Der jungfräulichen Gottesmutter Maria wird von den Theologen jede Triebhaftigkeit abgesprochen. Sie wird zu einem zunehmend entsexualisierten Konstrukt entwickelt, das den Männern nicht schaden kann, wenn sie sich ihm zuwenden. Hexen hingegen wird unterstellt, dass sie ihre Sexualität ausleben. Sie werden dadurch zu einer latenten Gefahr für Männer, die sich von ihnen verführen lassen könnten und so nicht nur körperlich (z.B. durch die Syphilis, die in Europa erstmals 1493 auftrat und sich dann epidemisch ausbreitete71 ), sondern auch seelisch geschädigt werden: Durch die schwere Sünde des Ehebruchs und der Unzucht riskierte der verführte Mann, den „Verlust der heiligmachenden Gnade“, die „Feindschaft mit Gott“, den „Verlust der ewigen Seligkeit“, die „ewige Verdammnis“, und die „Herrschaft des Teufels und des Todes.“72
6 Schluss - zu einer heutigen Funktion des Werler Rosenkranzaltars
Idealisierende Verehrung der allzeit reinen und unbefleckten Jungfrau Maria und brutale Verfolgung von Frauen im Rahmen eines zunehmend sexualisierten Hexenmusters des 16./17. Jahrhunderts stehen in Verbindung mit unbewältigten Konflikten im Umgang mit Sexualität. Sie basieren auf einer Tradition kirchlicher Leib- und Frauenfeindlichkeit, die Frauen seit dem frühen Christentum wegen des Sündenfalls ihrer Stammmutter Eva als zweitrangig ansah und sexuelle Lust als teuflisch verdammte. Zu diesen Auffassungen muss heute gesagt werden, dass sie offensichtlich im Widerspruch stehen zur biblischen Überlieferung einer Schöpfung, von der in Gen 1,31 gesagt wird, dass sie "sehr gut" sei. Sie widersprechen außerdem der Haltung Jesu Christi, der sich trotz seiner Herkunft aus dem traditionell patriarchal strukturierten Judentum Männern und Frauen in gleicher Weise zuwandte. Auch seiner Botschaft sind sie diametral entgegengesetzt: „Denn das Heil, das Jesus verspricht, setzt die Versöhnung voraus, die Versöhnung mit Gott, mit sich selbst, mit seiner Natur und mit seiner sozialen und sonstigen Umwelt.“73 Idealisierung der Jungfräulichkeit Mariens und Verdammung sexueller Triebe, die auf Hexen projiziert und bei ihnen bekämpft wurden, können in Anbetracht des Gesagten als Folgen theologischer Reflexionen bezeichnet werden, die sich im Laufe ihrer Entwicklung von der biblischen Überlieferung entfernt und diese teilweise sogar verkehrt haben.
Das am Rosenkranzaltar künstlerisch umgesetzte theologische Konstrukt einer allzeit reinen und unbefleckten, demütigen Jungfrau Maria reflektiert ein Marienbild, das in dieser Form nicht Inhalt der biblischen Überlieferung ist und das sich wohl auch deswegen nicht vollständig in den Herzen der Gläubigen verankerte. Legenden des 16./17. Jahrhunderts74 und volkstümliche Verehrung75 künden von einer lebendigeren, für irdische Nöte und menschliche Erfahrungen aufgeschlosseneren und verständnisvolleren Mutter des Erlösers und der Gläubigen. Diese Maria hat Mitleid und zeigt Einfühlungsvermögen für die schwangere Äbtissin des Klosters Scheyern76, für die Nonne Beatrix, die mit einem Geistlichen aus dem Kloster entlaufen und später Prostituierte geworden ist77 und sogar für den Mönch Theophilus, der sich mit dem Teufel eingelassen und deshalb sie und ihren göttlichen Sohn verleugnet hat.78 Machtvoll demonstriert Maria in diesen Legenden ihre Bereitschaft, sogar jenen Menschen zu helfen, die in den Augen einer in (un-)menschlichen Kategorien denkenden Gesellschaft abgrundtief gesündigt haben.
Dass die Frau und Mutter Maria trotz ihrer jahrhundertelangen mariologischen Überformungen und ihrer Instrumentalisierung als frühneuzeitliches Leitbild einer demütigen, gehorsamen und keuschen Weiblichkeit bis in die Gegenwart auf Interesse stößt und imponiert, mag eine neulich erfolgte Stellungnahme der zur extremen Linken zählenden PDS-Politikerin Sahra Wagenknecht aufzeigen. Gefragt nach ihrem Lieblingsbild, nannte sie den Reportern des Hamburger Stern-Magazins ausgerechnet die ‚Sixtinische Madonna’ von Raffael.79 Die Politikerin zeigte sich vor allem vom „Mut und Stolz“ Marias beeindruckt: „Barfüßig, verletzlich, das Kind schützend und selbst ungeschützt, geht die Madonna in eine Welt, von der sie - zu Recht - wenig Gutes erwartet. Aber sie geht nicht demütig gebeugt, sondern in Würde, ihrer Schönheit, Weiblichkeit und Überlegenheit bewusst. Unangreifbar, weil in sich ungebrochen. Ein wunderbares Ideal in einer Zeit, deren Rollenverständnis Frauen die fatale Wahl zwischen unterwürfiger Hausmutter und maskuliner Emanze aufzuzwingen scheint.“80 Eine solche Sichtweise entdeckt Haltungen an Maria, die in krassem Gegensatz stehen zu ihrer Einschätzung während des 16./17. Jahrhunderts als geschlechtlich indifferente, demütige und gehorsame Magd Gottes.
Die am Werler Rosenkranzaltar dargestellte Mutter Gottes spiegelt ein Frauenbild, das die Theologin Dorothee Sölle schlagwortartig mit „Entsexualisierung plus Demut" umreißt: "Ein Symbol, geschaffen, den Unterdrückten die Selbstunterdrückung beizubringen.“81 Einem solchen Frauenbild hält sie entgegen, dass es auch die subversive Maria gibt, die im Magnificat „das Lied von der Befreiung“ singt und die Macht der Herrschenden zersetzt.82 Und sie sinniert: „Es fällt mir schwer, die Millionen Frauen vor mir, die Maria geliebt haben, für nur blind oder betrogen zu halten. Da muss auch Widerstand gewesen sein, Widerstand, aus dem wir lernen können.“83
Sich der im Zentrum des Rosenkranzaltars hervorgehobenen Mutter Gottes vor diesem Hintergrund zu nähern, könnte neue Orientierungspunkte erschließen und helfen, auch im kirchlichen Raum Zugänge zu ganzheitlichen, integrierten Sichtweisen von Weiblichkeit und Sexualität zu finden. Der Werler Rosenkranzaltar und sein (defizientes) Marien- und Frauenbild könnte insofern die Funktion eines Mahnmals erfüllen. Zusammen mit den längst erloschenen Scheiterhaufen und der Trauer über die damals auch durch kirchliche Festlegungen von Weiblichkeit und Sexualität bedingten Verbrechen an den Hexen könnte er ein Impuls sein, sich vorurteilsfrei mit kultur- und traditionsgeschichtlich bedingten theologischen Positionen und Irrwegen auseinander zu setzen sowie sich kollektive und individuelle Verdrängungen und Kompensationen bewusst zu machen. Als gesellschaftliche Institution könnte die Kirche so dazu beitragen, Fehlentwicklungen, die sie selbst wesentlich mitzuverantworten hat, zu korrigieren.
7 Quellen
[...]
1 Stodt, Hans: Alß die Zauberschen gerichtet ...“ oder „Sehet da Werl, so vieler Hexenjäger Mutter!“ - Hexenwahn und Zaubereiprozesse in Stadt und Amt Werl im 17. Jahrhundert (1628-1630, 1642/43, 1660) - Ein Beitrag zur Sozialgeschichte Werls des 17. Jahrhunderts, in: Heinrich Josef Deisting (Hrsg.), Mitteilungen der Werler Arbeitsgemeinschaft für Familienforschung, Bd. 6, Heft 1, Jahrgang 20/1999
2 Zu einer am Begriff der Funktion festgemachten Kunstbetrachtung vgl. Busch, Werner (Hg.), Funkkolleg Kunst. Eine Geschichte der Kunst im Wandel ihrer Funktionen, 2 Bde, München 1987, beso. S. 5-26. Zum Konzept der 'Resonanz' vgl. de Duve, Thierry, Pikturaler Nominalismus. Marcel Duchamp, die Malerei und die Moderne, München 1987, beso. 134-164.
3 Die folgenden Ausführungen basieren auf meiner Dissertation: Rosenkranzaltar und Scheiterhaufen. Das Rosenkranzretabel zu Werl/Westfalen (1631) im Wirkfeld von Konfessionspolitik, Marienfrömmigkeit und Hexenglaube, Köln 2002. In dieser Arbeit finden sich auch alle hier nicht aufgeführten Belege.
4 Borst, Arno: Lebensformen in Mittelalter, Frankfurt a.M. - Berlin 1973, S. 109-113
5 Gelenius, Aegidius: De Admiranda, Sacra et Civili Magnitudine Coloniae ..., Köln 1645, dt.: Die Begründung der Kölner Rosenkranzbruderschaft, in: Walter Schulten (Hrsg.), 500 Jahre Rosenkranz, 1475 Köln 1975, Katalog zur gleichnamigen Ausstellung des Erzbischöflichen Diözesan-Museums Köln vom 25. Oktober 1975 bis zum 15. Januar 1976, Köln 1975, S. 102-105
6 ebd., S. 105. Vgl. dazu auch Küffner, Hatto: Zur Kölner Rosenkranzbruderschaft, in: ebd. S. 109-117 sowie den Beitrag von Stefan Jäggi in diesem Band. Die private Gründung der Kölner Rosenkranzbruderschaft erfolgte 1474, die offizielle 1475.
7 Authentische Quellen zur Gründung dieser Bruderschaft sind - vermutlich wegen der fünf großen Stadtbrände zwischen 1633 und 1737 - nicht mehr erhalten, eine Sekundärquelle (Staatsarchiv Münster Urk. Nr. 488) gibt jedoch ebenso wie die Gestaltung des Altars deutliche Hinweise auf die Gründung einer Werler Rosenkranzbruderschaft im Zeitraum 1620-1631; erste Mitgliederlisten sind für 1675/76 im Sterberegister der Pfarrkirche St. Walburga zu Werl bezeugt.
8 Grüter, Maria Elisabeth: „Unruhiger Geist“ - Politik und Religion im 16. Jahrhundert, in: Amalie Rohrer/Jürgen Zacher (Hrsg.), Werl: Geschichte einer Stadt (Studien und Quellen zur westfälischen Geschichte; Bd. 31), Bd. 1, Paderborn 1994, S. 363-390. Vgl. auch Franzen, August: Ferdinand von Bayern, in: LThK (1987), Bd. 4, Sp. 78f.
9 „Die Gegenreformation setzte auf Maria im Gegenzug zur protestantischen Nüchternheit und Christuszentriertheit.“, Ruster, Thomas: Mariologie. Eine Einführung in die Grundlagen, Skript zur Vorlesung im SS 2001 an der Universität Dortmund, Dortmund 2001, S. 7
10 Röckelein, Hedwig/Opitz, Claudia: Für eine Sozialgeschichte mittelalterlicher Marienverehrung, in: Hedwig Röckelein (Hrsg.), Maria, Abbild oder Vorbild. Zur Sozialgeschichte mittelalterlicher Marienverehrung (Dokumentation der Tagung „Maria - Abbild oder Wunschbild? Marienbilder als geschlechtsspezifische Identifikationsmodelle im Mittelalter“, 15.-17. September 1989 in Weingarten), Tübingen 1990, S. 16
11 Angenendt, Arnold: Geschichte der Religiosität im Mittelalter, Darmstadt 1997, S. 373‑378
12 Tertullianus, Qunitus Septimius Florens: De paenitentia II,11, in CChr.SL 1, S. 32344, zit. n. Angenendt a.a.O., S. 376
13 Gregor der Große: Registrum epistolarum I, 13, in: CChr.SL CXL, S. 1413, zit. n. Angenendt a.a.O., S. 376
14 Damiani, Petrus: De eleemosyna 6, in: PL 145, 1, Sp. 219 BC, zit. n. Angenendt a.a.O., S. 376
15 Angenendt a.a.O., S. 378
16 Jezler, Peter: Jenseitsmodelle und Jenseitsvorsorge. Eine Einführung, in: Ders. (Hrsg.), Himmel - Hölle - Fegefeuer, Das Jenseits im Mittelalter, Katalog zur Ausstellung des Schweizerischen Landesmuseums in Zusammenarbeit mit dem Schnütgen-Museum und der Mittelalterabteilung des Wallraff-Richartz-Museums der Stadt Köln, München 21994, S. 22-26
17 Mit ihren fünf Blütenblättern verweist die Rose auf die fünf Wundmale Christi am Kreuz und seine zukünftige Passion. vgl. Seibert, Jutta: Lexikon christlicher Kunst. Themen - Gestalten - Symbole, Freiburg - Basel - Wien 1987, S. 267 (Erstausg. Freiburg etc. 1980)
18 Simon, Manuel: Heilige-Hexe-Mutter. Der Wandel des Frauenbildes durch die Medizin im 16. Jahrhundert, Berlin 1993 (Bd. 20 der Reihe Historische Anthropologie, hrsg. v. Forschungszentrum für Historische Anthropologie der Freien Universität Berlin), S. 74-135
19 ebd., S. 156
20 Papst Leo XIII. (1878-1903), zit. n. Wagner, Harald: Canisius, Petrus, in: Härle, Wilfried/Wagner, Harald, Theologenlexikon. Von den Kirchenvätern bis zur Gegenwart, München 21994, S. 74
21 Canisius, Petrus: De Maria Virgine Incomparabili et Dei Genitrice Sacrosancta. Maria, die unvergleichliche Jungfrau und hochheilige Gottesgebärerin, aus dem Lateinischen zum erstenmal als Ganzes in das Deutsche übersetzt (mit Weglassung nicht mehr zeitgemäßer Kontroversen) von Karl Telch, Warnsdorf 1933 (Erstdruck in Latein Ingolstadt 1577), S. 313
22 Simon a.a.O., S. 158
23 Elias, Norbert: Über den Prozess der Zivilisation. Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen, 2 Bde., Bern - München 1969, Bd. 2, S. 312f.
24 Canisius a.a.O., S. 342
25 ebd.
26 ebd., Ausl. u. Erg. R.F.
27 ebd., Ausl. u. Erg. R.F.
28 vgl. Dormeyer, Detlev, Die Rolle der Imgination im Leseprozeß bei unterschiedlichen Leseweisen von Lk 1,26-38, in: Biblische Zeitschrift 39/1995, S. 164, 179; vgl. auch Halkes, Catharina J.M.: Maria, die Frau. Mariologie und Feminismus, in: Walter Schöpsdau (Hrsg.), Mariologie und Feminismus, Göttingen 1985, (Bensheimer Hefte; Heft 64), S. 43-70
29 vgl. Stodt, Anmerkung 1
30 Gelenius a.a.O.,S. 102-108
31 Sprenger, Jakob/Institoris, Heinrich: Der Hexenhammer (Malleus maleficarum) (1487), a. d. Lat. übertr. u. eingel. v. J.W.R. Schmidt, Berlin 1906, unveränd. ND München 141999; vgl. auch: Malleus Maleficarum von Heinrich Institoris (alias Kramer) unter Mithilfe Jakob Sprengers aufgrund der dämonologischen Tradition zusammengestellt, Wiedergabe des Erstdrucks von 1487 (Hain 9238), hrsg. v. André Schnyder, Göppingen 1991 (Litterae - Göppinger Beiträge zur Textgeschichte, hrsg. v. Ulrich Müller, Franz Hundsnurscher und Cornelius Sommer; Bd. 116); Schnyder, André: Malleus Maleficarum von Heinrich Institoris (alias Kramer) unter Mithilfe Jakob Sprengers aufgrund der dämonologischen Tradition zusammengestellt, Kommentar zur Wiedergabe des Erstdrucks von 1487 (Hain 9238), Göppingen 1993
32 ebd.; vgl. auch: Ulpts, Ingo: Sprenger, Jakob OP, in: LMA 2002, Bd. VII, Sp. 2134 (Erstausgabe 1999)
33 Falke, Didacus OFM: Geschichte des früheren Kapuziner- und jetzigen Franziskanerklosters zu Werl, Paderborn 1911, S. 36
34 ebd.
35 Canisius a.a.O.
36 Behringer, Wolfgang: Hexen und Hexenprozesse in Deutschland, München 1988, S. 46
37 Conrad, Anne: Nähe und Distanz - katholische Frauen im Spannungsfeld der frühneuzeitlichen Mariologie, in: Claudia Opitz et al., Maria in der Welt. Marienverehrung im Kontext der Sozialgeschichte 10.-18. Jahrhundert, Zürich 1993, S. 185
38 In meiner in Anm. 2 erwähnten Arbeit wurde diese Frage zu einer Hauptfrage, vgl. S. 111-196.
39 vgl. Sprenger /Institoris a.a.O.
40 vgl. Sprenger/Institoris a.a.O.; Bodin, Jean: De Daemonomania magorum. Vom außgelaßnen Wütigen Teuffelsheer der Besessenen Unsinnigen Hexen und Hexenmeyster [...], dt. Übers. von Johann Fischart, Straßburg 1581, Augsburger Staats- und Stadtbibliothek Sig. 80 Kult 239 (auszugsweise abgedruckt in: Nicoline Hortwitz (Hrsg.): Hexenwahn. Quellenschriften des 15. bis 18. Jahrhunderts aus der Augsburger Staats- und Stadtbibliothek. Mit einer historischen Einführung von Getrud Roth-Bojadzhiev, Stuttgart 1990, S. 80-85); Binsfeld, Peter: TRACTAT Von Bekantnuß der Zauberer unnd Hexen. Ob und wie viel denselben zu glauben [...], Trier 1590, Augsburger Staats- und Stadtbibliothek Sig. 80 ThH 1938 (Adl.) (auszugsweise abgedruckt in: Nicoline Hortwitz (Hrsg.) a.a.O., S. 80-85); Zusammenfassung in: Fidler a.a.O., S. 116-128
41 Brackert, Helmut: Zur Sexualisierung des Hexenmusters in der Frühen Neuzeit, in: Hans-Jürgen Bachorski (Hrsg.), Ordnung und Lust: Bilder von Liebe, Ehe und Sexualität in Spätmittelalter und Früher Neuzeit, Trier 1991, S. 337-358
42 Spee, Friedrich: Friedrich von: Gewissens=Buch: von PROZESSEN Gegen die Hexen [...], Bremen 1647, Augsburger Staats- und Stadtbibliothek Sig. X 251,3 (aus Studienbibliothek Dillingen) (auszugsweise abgedruckt in: Nicoline Hortwitz (Hrsg.) a.a.O., S. 167
43 ebd.
44 Wunder, Heide: Friedrich von Spee und die verfolgten Frauen, in: Doris Brockmann/Peter Eicher (Hrsg.), Die politische Theologie Friedrich von Spees, München 1991, S. 119-132
45 zu dieser Thematik vgl. auch: Deschner, Karlheinz: Das Kreuz mit der Kirche, Düsseldorf 1974; Honegger, Claudia: Die Hexen der Neuzeit. Studien zur Sozialgeschichte eines kulturellen Deutungsmusters, Frankfurt a.M. 1978, S. 61; Simon, Manuel: Heilige - Hexe - Mutter. Der Wandel des Frauenbildes durch die Medizin im 16. Jahrhundert, Berlin 1993 (Bd. 20 der Reihe Historische Anthropologie, hrsg. v. Forschungszentrum für Historische Anthropologie der Freien Universität Berlin), S. 6f.
46 Schirmer, Eva: Eva-Maria. Rollenbilder von Männern für Frauen, Offenbach 1988., S. 33
47 „Hätte Adam früher als Eva gesündigt, so wäre diese Sünde so schwer und auch so unverbesserlich gewesen, daß der Mensch in eine solch große Verhärtung der Nichtwiedergutmachung gefallen wäre, daß er weder hätte gerettet werden können noch hätte gerettet werden wollen. Da aber Eva zuerst sündigte, konnte dies eher getilgt werden; denn sie war gebrechlicher als der Mann.“ Hildegard von Bingen, zit. n. Schipperges, Heinrich (Hg.): Hildegardis. Geheimnis der Liebe. Bilder von des Menschen leibhaftiger Not und Seligkeit. Nach d. Quellen übers. u. bearb. v. Heinrich Schipperges, Olten 1957, S. 103
48 „Dank der Frau thront der Mensch an Gottes Seite. Und wenn jemand vorbringen will, er sei wegen einer Frau, wegen Eva, aus dem Paradies vertrieben worden, so sage ich, daß er dank der Jungfrau Maria eine weit höhere Stufe erreicht hat als den Zustand, den er durch Eva verlor, und zwar indem sich die Menschheit mit der Gottheit verbunden hat; dies wäre ohne Evas Missetat nie eingetroffen. Vielmehr sollte man Mann und Frau wegen dieses Fehltritts loben, aus dem eine solche Ehre erwachsen ist. Denn so tief auch die menschliche Natur aufgrund ihres kreatürlichen Elements fiel, um so höher erhob sie der Schöpfer.“Christine de Pizan, zit. n. Zimmermann, Margarete (Hrsg): Christine de Pizan. Die Stadt der Frauen, a. d. Mittelfranz. übers. u. komm. v. Margarete Zimmermann, Berlin 1986, S. 55
49 Lucretia Marinella 1601, zit. n. Schüngel-Straumann, Helen: Zur Wirkungsgeschichte biblischer Texte im Hinblick auf das christliche Frauenbild, in: Dieter R. Bauer (Hrsg.), Eva. Verführerin oder Gottes Meisterwerk? Philosophie- und theologiegeschichtliche Frauenforschung, Rottenburg - Stuttgart 1987, S. 37-72 (Hohenheimer Protokolle; Bd. 21), S. 58
50 ebd., S. 58f.
51 Sancti Thomae Aquinatis Summa Theologiae, in: Bibliotheca De Auctores Christianos, Madrid 31961, 1 q.92 a.1, dt.: Christ, Hannelore: Frauenemanzipation durch solidarisches Handeln, in: Literatur in der Schule, Bd. 2, München 1976, S. 74
52 ebd.,
53 Sprenger/Institoris a.a.O., 1. Teil, S. 93, Erg. R.F.
54 Schnyder, Kommentar, a.a.O., S. 127, Fußnote 159
55 Sprenger/Institoris a.a.O., 1. Teil, S. 96, Erg. R.F.
56 ebd., S. 97
57 ebd., S. 100, Erg. u. Ausl. R.F.
58 ebd., S. 106
59 Canisius a.a.O., S. 317-320
60 ebd., S. 342, Hervorh. R.F.
61 Leisch-Kiesl, Monika: „Ich bin nicht gut, ich bin nicht böse ...“ - Zur Eva-Maria-Antithese in Mittelalter und früher Neuzeit, in: Claudia Opitz et al., Maria in der Welt. Marienverehrung im Kontext der Sozialgeschichte 10.-18. Jahrhundert, Zürich 1993, S. 124
62 ebd., S. 125
63 Savramis, Demosthenes: Die Stellung der Frau im Christentum: Theorie und Praxis unter besonderer Berücksichtigung Marias, in: Walter Schöpsdau (Hrsg.), Mariologie und Feminismus, Göttingen 1985, S. 18-70 (Bensheimer Hefte; Heft 64), S. 31
64 Sleumer, Albert: Kirchenlateinisches Wörterbuch, Limburg a.d. Lahn 1926, S. 230, Erg. R.F.
65 Simon a.a.O., S. 5, Ausl. R.F.
66 Canisius, a.a..O., S. 111f.
67 van Dülmen, Richard: Kultur und Alltag in der frühen Neuzeit, 3 Bde, München 21999, Bd. 1, S. 184-197
68 vgl. Hergemöller, Bernd-Ulrich: Randgruppen der spätmittelalterlichen Gesellschaft - Wege und Ziele der Forschung, in: Ders. (Hrsg.), Randgruppen der mittelalterlichen Gesellschaft. Ein Hand- und Studienbuch, Warendorf 21994, S. 47; vgl. auch Jerouschek, Günther: „Diabolus habitat in eis“ - Wo der Teufel zu Hause ist: Geschlechtlichkeit im rechtstheologischen Diskurs des ausgehenden Mittelalters und der frühen Neuzeit, in: Hans-Jürgen Bachorski (Hrsg.), Ordnung und Lust: Bilder von Liebe, Ehe und Sexualität in Spätmittelalter und Früher Neuzeit, Trier 1991, S. 281-305
69 vgl. Konzilien von Nicäa (325; Denzinger, Heinrich: Kompendium der Glaubensbekenntnisse und kirchlichen Lehrentscheidungen, verb., erw. ins Dt. übertr. u. unt. Mitarb. v. Helmut Hoping hrsg. v. Peter Hünermann, Freiburg i.Br. u.a. 371991, S. 125), Ephesos (431; ebd., S. 252), Chalkedon (451; Kirchberger, Joe H.: Maria: Dogmen, Kult und Brauchtum, in: Herbert Haag et al., Maria. Kunst, Brauchtum und Religion in Bild und Text, Freiburg - Basel - Wien 1997, S. 165) und 2. Konzil von Konstantinopel (553; Denzinger a.a.O., S. 422)
70 Auszug des Dogmas in: Courth, Franz: Mariologie, bearb. v. Franz Courth, Graz - Wien - Köln 1991 (Texte zur Theologie (TzT), hrsg. v. Wolfgang Beinert et al., Abteilung Dogmatik; Bd. 6), S. 198
71 Schreiber, W./Mathys, F.K.: Infectio. Ansteckende Krankheiten in der Geschichte der Medizin, Basel 1986 (Editiones Roche)
72 Rahner, Karl, Sünde, V. Dogmatisch, in: LThK Bd. 9, Sp. 1178
73 Savramis a.a.O., S. 20
74 Hahn, Karl August (Hrsg.): Das Alte Passional, Frankfurt a.M. 1845; vgl. auch: Kälin, Beatrice: Maria, Mutter der Barmherzekeit. Die Sünder und die Frommen in den Marienlegenden des alten Passionals, Phil. Diss. a.d. Univ. Zürich, Berlin - Frankfurt a.M. - New York - Paris - Wien 1993 (Deutsche Literatur von den Anfängen bis 1700; Bd. 17); Kirchberger, Joe H.: Maria in der Literatur, in: Herbert Haag et al., Maria. Kunst, Brauchtum und Religion in Bild und Text, Freiburg - Basel - Wien 1997, S. 75-79; Schreiner, Klaus: Maria. Jungfrau, Mutter, Herrscherin, München - Wien 1994, S. 57-63
75 Schreiner a.a.O., S. 291, 501-507
76 ebd., S. 60-63
77 Kirchberger a.a.O., S. 78
78 ebd., S. 75-77
79 Stern-Magazin 47/2000, S. 279
80 ebd.
81 Sölle, Dorothee: Maria ist eine Sympathisantin, in: dies., Sympathie. Theologisch-politische Traktate, Stuttgart 31981, S. 56-61, S. 56
82 ebd., S. 59
83 ebd., S. 61
zum Autor:
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt des Textes "Rosenkranzaltar und Scheiterhaufen"?
Der Text "Rosenkranzaltar und Scheiterhaufen: Zum Verhältnis von Marienverehrung und Hexenverfolgung" von Rudolf Fidler untersucht den Zusammenhang zwischen der Marienverehrung und den Hexenverfolgungen im 17. Jahrhundert, insbesondere im Kontext der Stadt Werl/Westfalen und ihres Rosenkranzaltars. Er analysiert die Entstehung und Funktionen des Werler Rosenkranzaltars im Dreißigjährigen Krieg, die Rolle der Marienverehrung, die theologischen Sichtweisen von Weiblichkeit und die Verbindung zu Hexenbildern, sowie die Bedeutung von Sexualität bei der Definition von Hexen und der Jungfrau Maria. Abschließend wird nach einer heutigen Funktion des Altars gefragt.
Wer ist Rudolf Fidler?
Rudolf Fidler ist der Autor des Textes. Er ist promovierter Theologe und war nebenamtlicher museumspädagogischer Mitarbeiter im ‚Forum der Völker - Völkerkundemuseum der Franziskaner in Werl/Westfalen'. Er war Lehrer an einer Fachklinik für Kinder und Jugendliche in Bad Sassendorf.
Worauf basiert der Aufsatz?
Der Aufsatz basiert auf den Forschungsergebnissen von Rudolf Fidlers Dissertation mit dem Titel: Rosenkranzaltar und Scheiterhaufen. Das Rosenkranzretabel zu Werl/Westfalen (1631) im Wirkfeld von Konfessionspolitik, Marienfrömmigkeit und Hexenverfolgung.
Was waren die historischen Umstände der Entstehung des Werler Rosenkranzaltars?
Der Altar entstand im Dreißigjährigen Krieg (1618-1648) in einer Zeit wirtschaftlicher Not und konfessioneller Spannungen. Die Stadt Werl, ein katholischer Vorposten, war von protestantischen Gebieten umgeben und litt unter Kriegslasten, Unwettern und Pestausbrüchen. Die Stiftung des Altars war ein Versuch, die Gottesmutter Maria als Verbündete zu gewinnen und die Stadt vor drohenden Gefahren zu schützen.
Welche Funktionen hatte der Werler Rosenkranzaltar?
Neben der Krisenbewältigung diente der Altar als Demonstration der katholischen Glaubenstreue gegenüber dem Kölner Erzbischof nach der Rekatholisierung. Er war ein religionsdidaktisches Medium zur Vermittlung katholischer Lehren, ein identitätsstiftendes Element für die Bürger von Werl und ein Mittel zur Jenseitsvorsorge durch Gebete und Stiftungen.
Inwiefern stehen Marienverehrung und Hexenverfolgung in einem Zusammenhang?
Der Text argumentiert, dass Marienverehrung und Hexenverfolgung extreme Pole eines Frauenbildes darstellen, das durch Idealisierung und Dämonisierung von Weiblichkeit und eine negative Einschätzung der Sexualität geprägt ist. Während Maria als rein und sündenlos idealisiert wurde, wurden Hexen mit Teufelsbuhlschaft und sexuellen Orgien in Verbindung gebracht. Diese gegensätzlichen Bilder bedingten sich gegenseitig.
Welche Rolle spielte die theologische Sichtweise von Weiblichkeit bei der Entwicklung von Marien- und Hexenbildern?
Die Geschichte vom Sündenfall Adams und Evas diente als Grundlage für die negative Bewertung von Weiblichkeit. Frauen wurden als minderwertig, leicht zu verführen und verantwortlich für den Tod in der Welt angesehen. Diese Sichtweise wurde im Hexenhammer weiter verstärkt, wo Frauen als von Natur aus böse und unersättlich in ihren Begierden dargestellt wurden.
Welche Bedeutung hatte die Sexualität bei der Definition von Hexen und der Jungfrau Maria?
Die sexuelle Enthaltsamkeit Marias wurde idealisiert, während Hexen mit enthemmter Sexualität in Verbindung gebracht wurden. Die Verdammung der "bösen Lust" diente dazu, die Sexualität im Allgemeinen zu verurteilen und die Keuschheit als erstrebenswertes Ziel darzustellen. Hexen wurden als Gefahr für Männer angesehen, die sie durch Verführung körperlich und seelisch schädigen konnten.
Welche heutige Funktion könnte der Werler Rosenkranzaltar haben?
Der Altar könnte als Mahnmal dienen, um sich der unbewältigten Konflikte im Umgang mit Sexualität bewusst zu werden und sich kritisch mit theologischen Positionen auseinanderzusetzen, die zu Leib- und Frauenfeindlichkeit geführt haben. Er könnte auch dazu anregen, sich kollektive und individuelle Verdrängungen und Kompensationen bewusst zu machen und Fehlentwicklungen zu korrigieren.
- Arbeit zitieren
- Rudolf Fidler (Autor:in), 2003, Rosenkranzaltar und Scheiterhaufen, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/108396