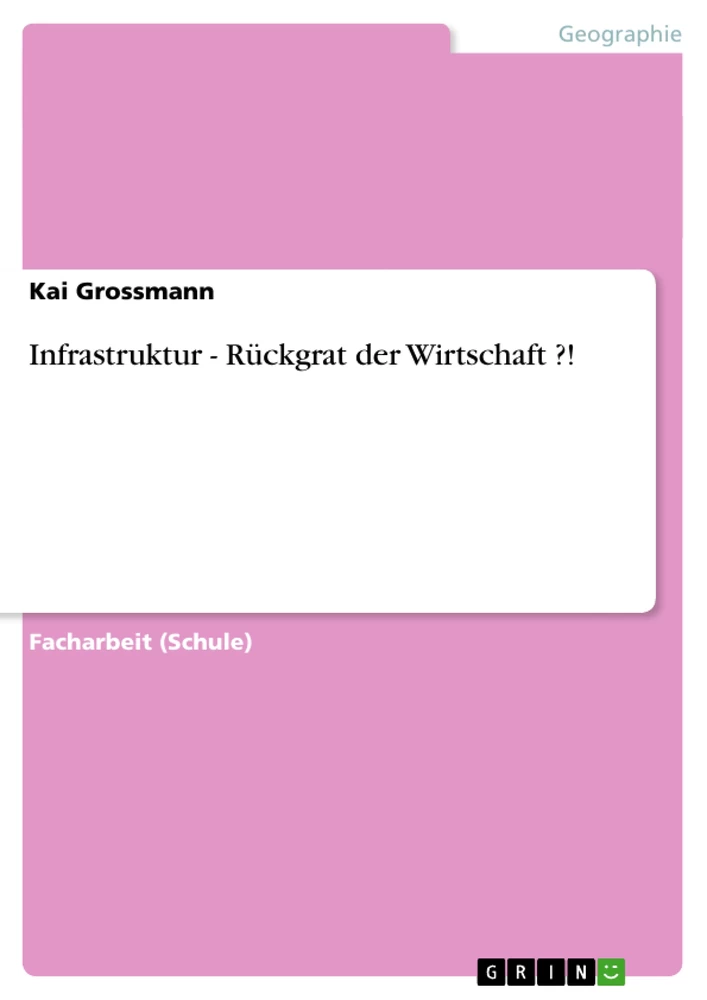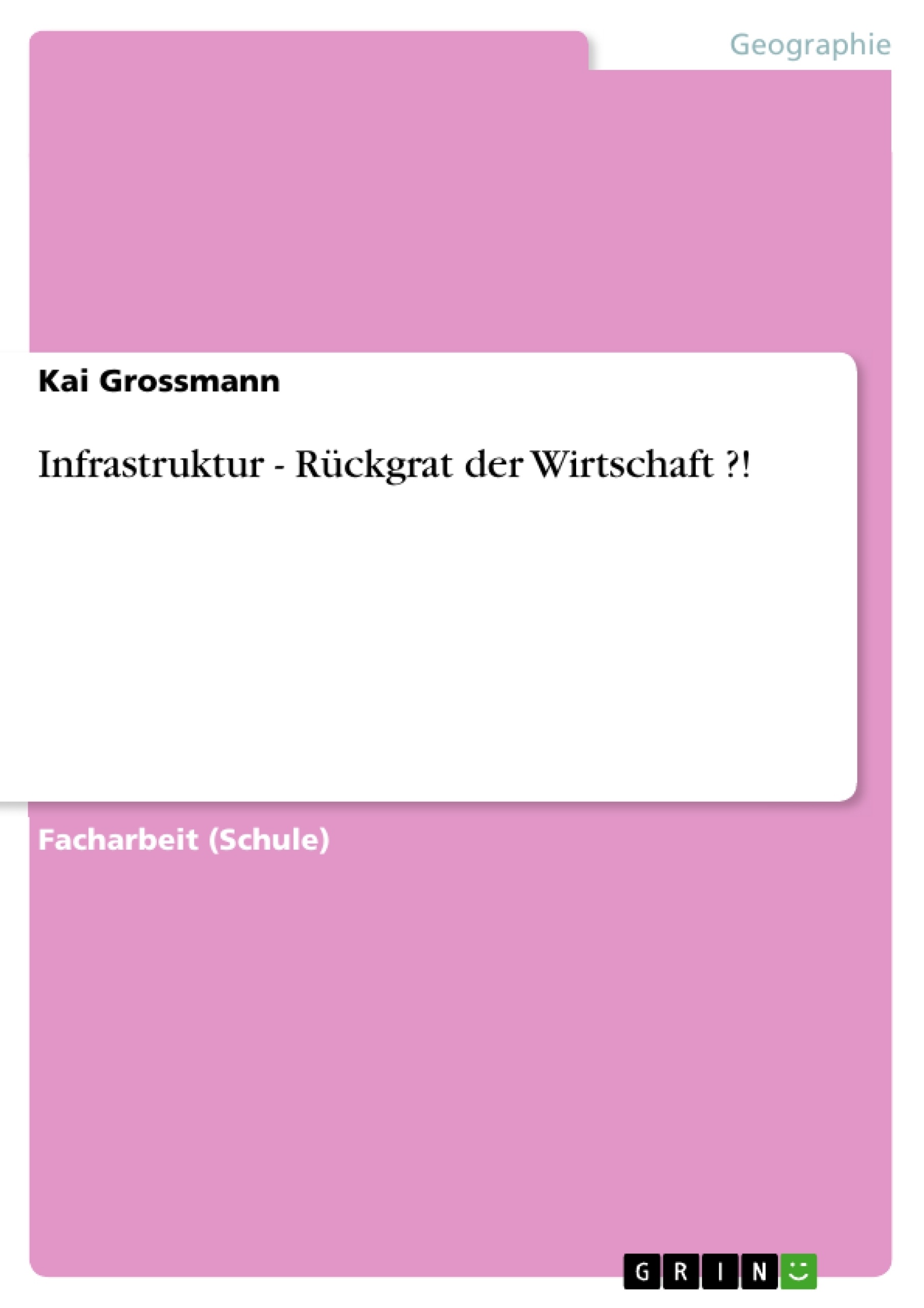Stellen Sie sich vor, Mecklenburg-Vorpommern wäre ein Körper, dessen Adern verstopft sind. Wie kann dieser Körper wiederbelebt werden, um wirtschaftliches Wachstum und nachhaltige Mobilität zu gewährleisten? Diese tiefgreifende Analyse beleuchtet die entscheidende Rolle der Infrastruktur, insbesondere der Verkehrswege, für die wirtschaftliche Entwicklung und die Lebensqualität in Deutschland, wobei der Fokus auf den Herausforderungen und Chancen in Mecklenburg-Vorpommern liegt. Von der Definition des Begriffs "Infrastruktur" über die Bedeutung von Straßen, Schienen und Wasserwegen bis hin zu den ambitionierten Verkehrsprojekten Deutsche Einheit werden die komplexen Zusammenhänge zwischen Infrastruktur, Wirtschaftswachstum und Umweltschutz untersucht. Das Buch analysiert die Notwendigkeit strategischer Investitionen in leistungsfähige Verkehrsnetze, um regionale Disparitäten auszugleichen, die Anbindung an europäische Wirtschaftsräume zu verbessern und die vielfältigen Wertschöpfungspotenziale von Metropolregionen wie Hamburg und Berlin optimal zu nutzen. Am Beispiel der A20 wird die Bedeutung moderner Verkehrswege für die Küstenregionen und das Hinterland, für Tourismus, Landwirtschaft und Gewerbe anschaulich dargestellt, wobei auch die Belange des Naturschutzes und der Anwohner berücksichtigt werden. Dieses Buch ist ein Muss für alle, die sich für Regionalentwicklung, Verkehrspolitik und die Zukunft der Mobilität in Deutschland interessieren, und bietet wertvolle Einblicke in die Herausforderungen und Chancen, die mit dem Ausbau und der Modernisierung unserer Infrastruktur verbunden sind. Es zeigt auf, wie durch gezielte Investitionen in Straßenbau, Schienennetze und Wasserwege nicht nur die Wirtschaft angekurbelt, sondern auch die Lebensqualität verbessert und die Umwelt geschützt werden kann. Entdecken Sie, wie die richtige Infrastruktur die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft stellen kann, und welche Bedeutung den Verkehrsprojekten zukommt.
Inhalt
Einleitung
1. Begriffserklärung: Infrastruktur
- Allgemeine Definition
- Typische Merkmale einer Infrastruktur
- Arten der Infrastruktur
2. Infrastruktur - Rückgrat der Wirtschaft ?! 5
3. Überblick über die Rolle der verschiedenen Verkehrswege in Deutschland
- Strasse
- Schiene
- Wasser
4. Verkehrsprojekte Deutsche Einheit
- Allgemeine Planungsziele
- Aktuelles Beispiel
5. Verkehrsprojekte Deutsche Einheit in Mecklenburg-Vorpommer
- A20: Bessere Anbindung für die Küste und
das Hinterland
- Daten und Fakten
- Belange der Umwelt
- Notwendigkeit von VDE
6. "Wer Straßen sät, wird Verkehr ernten."
Quellenverzeichnis
Einleitung
Effiziente Verkehrsnetze und -systeme sind für die Wirtschaftsentwicklung von grundlegender Bedeutung. Die Unternehmen sind auf zuverlässige und kostengünstige Zugänge zu den Märkten angewiesen. Die Bürger brauchen ein gutes Angebot an Verkehrsinfrastruktur und öffentlichen Personenverkehrsleistungen, um ihre Arbeits- und Ausbildungsplätze sowie die Einkaufs- und Freizeitangebote zu erreichen.
Das Strassennetz in Mecklenburg-Vorpommern hat eine Länge von 9.703 km (ohne Kommunalstrassen). Die Netzdichte des Strassennetzes beträgt 0,42 km/km². (Im Vergleich hierzu erreicht die Strassennetzdichte in Schleswig-Holstein einen Wert von 0,62km/km² und damit einen um 32% besseren Ausstattungsgrad.) In Relation zur Bevölkerungsdichte weist die Region zwar grundsätzlich einen guten Erschließungsgrad auf, da Mecklenburg-Vorpommern jedoch ein Flächenland ist, ist dieser Vorteil nur ein rein statistischer Wert. Negativ wirkt insbesondere, dass die Aufnahmefähigkeit der Strassen für die ständig zunehmende Verkehrsmenge sowie die Belastbarkeit der Strassen und Brücken in vielen Strassenabschnitten auf Grund des Verschleißzustandes nicht hoch genug sind.
Der immer noch große Rückstand im Ausbauniveau der Infrastruktur gegenüber den alten Bundesländern verursacht höhere Kosten für die Wirtschaft. Deshalb kann in ganz Mecklenburg-Vorpommern eine wirtschaftliche Entwicklung nur initiiert werden, "wenn die finanzielle Wirtschaftsförderung noch mehr als bisher auf die Entwicklung der Standortbedingungen für ein erfolgreiches Wirtschaften gerichtet wird." "Zuallererst muss der Ausbau der Verkehrswegeinfrastruktur beschleunigt und die Wettbewerbsfähigkeit bereits vorhandener wirtschaftlicher Agglomerationszentren erhöht werden."
Zudem muss man darauf hinweisen, dass nur mit Hilfe gut ausgebauter Verkehrsinfrastruktur die vielfältigen Wertschöpfungspotentiale der beiden größten deutschen Metropolregionen Hamburg und Berlin für das Land Mecklenburg-Vorpommern nutzbar gemacht werden können.
Am Beispiel von Mecklenburg-Vorpommern kann man sehr deutlich sehen, welchen Stellenwert die Infrastruktur im Wirtschaftswachstum und in der Mobilität eines Landes einnimmt.
1. Begriffsklärung: Infrastruktur
Allgemeine Definition
Der Begriff der Infrastruktur stammt aus dem Lateinischen und bedeutet Unterbau. Mit diesem Unterbau sind die Basiseinrichtungen einer Volkswirtschaft im engeren oder weiteren Sinne gemeint.
Eine durchgängige exakte Begriffsbestimmung existiert in der einschlägigen Literatur nicht. So versteht das Gabler-Volkswirtschafts-Lexikon unter Infrastruktur ,,die Grundausstattung einer Volkswirtschaft (eines Landes, einer Region) mit Einrichtungen, die zum volkswirtschaftlichen Kapitalstock gerechnet werden können, die aber für die private Wirtschaftstätigkeit den Charakter von Vorleistungen haben."
Woll bedient sich eines weiteren Begriffs, wenn er Infrastruktur, als ,,Ausstattung einer Volkswirtschaft mit Verkehrs- und Kommunikationseinrichtungen, Energieversorgung, Bildungs- und anderen eine wirtschaftliche Tätigkeit ermöglichenden und grundlegenden öffentlichen Einrichtungen, die Entwicklungsstand und Produktionsniveau des Landes bestimmen", definiert.
Allgemein formuliert besteht die Infrastruktur also aus Einrichtungen, die als Voraussetzung und zum Funktionieren der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung und Versorgung eines Territoriums notwendig sind. Dazu gehören Einrichtungen für den Personen-, Kapital-, Güter- und Nachrichtenverkehr, Wasser- und Stromversorgungsnetze, Entsorgungsanlagen, Einrichtungen der Verwaltung, des Bildungswesens, des Gesundheitswesens, der Erholung, der Rechtssicherung und der Kultur.
Typische Merkmale einer Infrastruktur
- Die Materielle und personelle Infrastruktur besitzt Investitionscharakter, d.h. der für deren Erstellung langfristig nutzbarer Güter nötige Aufwand dient der Erzielung von Einkommen.
- Infrastruktur verursacht sowohl positive wie negative externe Effekte. So kann eine für die Erschließung eines neuen Gewerbegebietes gebaute Straße natürlich auch von nicht in dieser Region beschäftigen Personen befahren werden (positiver externer Effekt), der dort zu erwartende Verkehr belästigt Anwohner der Straße aber mit Lärm und Abgasen (negativer externer Effekt).
Darüber hinaus existieren weitere Merkmale :
- Die Infrastruktur ist technologisch nicht teilbar, sie kann weder importiert noch exportiert werden.
- Infrastruktur besitzt den Charakter eines Kollektivgutes, sie kann von vielen genutzt werden und es besteht oft nicht die Möglichkeit des Ausschlusses.
Arten der Infrastruktur
Die von Woll vorgenommene Einteilung in konsumtive, haushaltsorientierte Infrastruktur (z.B. Parkanlagen, Theater) und in Einrichtungen der produktiven, unternehmensorientierten Infrastruktur (z.B. Hochseehäfen, Güterbahnhöfe) basiert auf den Überlegungen:
· Wer ist Nutznießer dieser Einrichtungen? Unternehmer oder Haushalte?
· Und wozu werden die Leistungen der Infrastruktur verwand? Zu privatem Konsum oder zu Produktionszwecken?
2. Infrastruktur-Rückgrat der Wirtschaft?!
Ein funktionierendes, modernes Verkehrssystem - Straße, Schiene, Wasserstraße - ist eine zentrale Voraussetzung zur Sicherung von Wirtschaftswachstum und Beschäftigung. Mangelnde Erreichbarkeit und lange Wege bedeuten für die Wirtschaft einen klaren Standortnachteil. Gleichzeitig ist die problemlose Anbindung an eine leistungsfähige Fernstrasse für potentielle Investoren ein ganz entscheidender Standortfaktor. Trotz bisheriger hoher Investitionen in die Verkehrsinfrastrukturen gibt es infolge der Verkehrszunahme weiterhin permanente Stau auslösende Engpässe, die früher als es die geltende Finanzplanung erlaubt, beseitigt werden sollen. Nicht nur Staus, im Autobahnnetz, sondern auch im Schienen- und Wasserstraßennetz führen zu erheblichen volkswirtschaftlichen Einbußen. Das Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen hat dafür ein Programm zur Beseitigung von Engpässen im Autobahnnetz, im Schienenwegenetz und im Netz der Bundeswasserstraßen vorgelegt, mit dem über die normalen Verkehrsinfrastrukturinvestitionen hinaus schnellstmöglich gravierende Engpässe beseitigt werden (siehe Diagramm). Eine leistungsfähige Verkehrs- und städtische Infrastruktur ist eine zentrale Voraussetzung für einen starken Wirtschaftsstandort Deutschland, für Wachstum und Beschäftigung. Die Investitionen des Bundes in die Infrastruktur sichern die Lebensqualität in den Städten und ihrem Umland. Sie schaffen die Grundlage für eine wachsende Mobilität in der Gesellschaft. Bei der Vernetzung der Verkehrsträger kommt dem Ausbau von Schiene, Wasserstraße und Kombiniertem Verkehr eine besondere Bedeutung zu.
So ist für mich die Infrastruktur die Grundlage bzw. das Rückgrat einer jeden Wirtschaft.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
3. Überblick über die Rolle der verschiedenen Verkehrswege in Deutschland
Strasse
Bis zum Jahr 2010 wird der Straßengüterverkehr um 95% zunehmen. Bereits heute trägt der Straßenverkehr die Hauptlast des Personen - und Gütertransports. Über 85% aller transportierten Güter werden derzeit auf der Straße bewegt. Ohne die Möglichkeit, diese Transportvorgänge effizient zu organisieren, wäre eine wichtige Voraussetzung für nachhaltiges Wirtschaftswachstum und Wohlstand nicht mehr gegeben.
Die Straßenverkehrsinfrastruktur ist der Lebensnerv des Wirtschaftstandorts Deutschland.
Bereits heute betragen die Einnahmen aus der deutschen Mineralöl- und Kfz-Steuer mehr als 41 Mrd. €. Lediglich 18 Mrd. € fließen davon in den Ausbau der Infrastruktur. Trotz dieses hohen finanziellen Beitrags der Straßeninfrastrukturbenutzer erfolgt die Erweiterung und Verbesserung der Infrastruktur schon längst nicht mehr in dem Maße, wie es der Bedarf an der Schaffung zusätzlicher Mobilitätsräume für das wachsende Güterverkehrsaufkommen erfordern würde. Nach dem Bundesverkehrswegeplan müssten in den Jahren 1991 bis 2012 insgesamt jährlich rund 10,75 Mrd. € in das Verkehrsnetz investiert werden, um den Bedarf zu decken. Im vergangenem Jahr wurden aber nur 8,2 Mrd. € investiert. Allein von 1991 bis 1997 beläuft sich der zurückgestaute Investitionsbedarf bereits auf 13,8 Mrd. €. Die Diskrepanz in der Entwicklung zwischen Verkehrsleistung und Infrastrukturausbau hat in den vergangenen Jahren zu einer immer höheren Verkehrsdichte geführt. Verkehrsstockungen und Staus sind die Folge. Allein im Güternah- und Fernverkehr beträgt der jährliche volkswirtschaftliche Schaden inklusive 2 Mrd. € staubedingtem Kraftstoffmehrverbrauch rund 23,5 Mrd. €.
Der Güterverkehr hat in den vergangenen Jahren stärker zugenommen als der Personenverkehr. Die verstärkte internationale Arbeitsteilung und die Integration der osteuropäischen Volkswirtschaften haben dazu geführt, dass die Straßenverkehrsinfrastruktur an ihrer Kapazitätsgrenze angelangt ist. Daher ist eine Investitions-Offensive für die Straßenverkehrsinfrastruktur erforderlich. Die überwiegend Nord-Süd-ausgelegten Verkehrswege müssen entsprechend des Anstiegs des Ost-West-Verkehrs ergänzt werden. Der sechsspurige Ausbau der Bundesautobahnen gehört dabei zum Infrastrukturstandard. Die Zunahme im Ost-West-Verkehr und im Binnenverkehr ließe sich durch Einrichtung von European Road-Freightways, Straßengüterverkehrstrassen um die großen Ballungszentren herum, bewältigen. Entsprechend dem Vorbild des Netz 21 der Eisenbahn, könnte eine solche Neukonzeption des Straßenwesens an den Verkehrsbrennpunkten, eine Entmischung von Straßengüterfernverkehr und Güternah- und Personenverkehr ermöglichen. Wie bei innerstädtischen Busspuren könnte an solchen Autobahnabschnitten, an denen der Güterverkehrsanteil an der täglichen Kfz-Verkehrsmenge 20% überschreitet, für Lkw eine eigene Trasse eingerichtet werden
Schiene
Schwerpunkt der Investitionen der BRD bildeten seit 1991 die neun Schienenverkehrsprojekte Deutsche Einheit.
Neue Organisationsformen des Projektmanagements sollten die Grundlage schaffen, um die neun Verkehrsprojekte Deutsche Einheit auf der Schiene schneller und wirtschaftlicher zu realisieren als bis dahin üblich. Heute sind die Projektmanagementressourcen der Bahn in der DB ProjektBau zusammengefasst.
Seither wurden in die neun Schienenverkehrsprojekte Deutsche Einheit insgesamt rund 18,5 Milliarden D-Mark investiert, 2.300 Gleiskilometer - mehr als einmal die Strecke Berlin - Moskau - wurden grundhaft modernisiert oder neu gebaut. Von der Verbesserung der Tragfähigkeit des Unterbaus, über die Erneuerung des Oberbaus, die Sanierung oder Erneuerung der Ingenieurbauwerke bis zum Lichtwellenleiterkabel wurden vorhandene Strecken praktisch neu aufgebaut.
Sechs der neun Schienenverkehrsprojekte Deutsche Einheit wurden im vergangenen Jahrzehnt dem Verkehr übergeben. Im Ergebnis des Bahnausbaus konnten auf Strecken wie Hamburg - Berlin, Magdeburg - Berlin, Hannover - Berlin, Bebra - Erfurt oder Leipzig - Dresden die Fahrzeiten bereits wesentlich verkürzt werden. Herausragendes Beispiel ist die 1998 in Betrieb genommene Schnellbahnverbindung Hannover - Berlin.
Die neue Infrastruktur schuf nicht nur Voraussetzungen für neue Angebote der Bahn, sondern zugleich auch für wirtschaftlicheren Betrieb. Dafür wurden neben der Modernisierung und Rationalisierung der Gleisanlagen beispielsweise von der PBDE bis Ende 1999 insgesamt 15 Elektronische Stellwerke mit 84 abgesetzten Stellrechnern realisiert, die rund 1.000 Kilometer Strecke steuern und damit rund 3.600 Arbeitsplätze einsparen. Strecken wie Hamburg - Berlin, Magdeburg - Berlin und Halle/Leipzig - Berlin werden beispielsweise schon fast vollständig mit Computerhilfe gesteuert.
Wesentliche Teile des Programms der neun Schienenverkehrsprojekte Deutsche Einheit sind bereits abgeschlossen. Neben den sechs fertiggestellten Projekten konnten auch im Projekt Nr. 9 (Leipzig - Dresden), Nr. 1 (Lübeck-Stralsund) und Nr. 8 (Nürnberg-Berlin) bereits große Abschnitte dem Betrieb übergeben werden
Die aktuelle Bilanz:
Von 1991 bis 1999 hat die Bundesrepublik Deutschland in das Schienenetz mehr als 72 Milliarden D-Mark (36,8 Milliarden Euro) investiert, darunter fast 39 Milliarden D-Mark (19,9 Milliarden Euro) in den neuen Bundesländern. Rund die Hälfte davon floss in die Schienenverkehrsprojekte Deutsche Einheit
Wasser
Zur Bewältigung des künftigen Verkehrs in Deutschland kann auf das Verkehrssystem Wasserstraße nicht verzichtet werden, denn die Binnenschifffahrt hat hervorragende Grundvoraussetzungen: Sie ist kostengünstig, umweltfreundlich, energiesparend und sicher.
Das Wasserstraßennetz weist derzeit regional beträchtliche Unterschiede auf: Der Rhein im Westen Deutschlands bietet schon aufgrund seiner natürlichen Beschaffenheit günstige Bedingungen für den Gütertransport per Binnenschiff. In den östlichen Bundesländern hingegen ist schon seit Jahrzehnten nicht in die Wasserstraßen-Infrastruktur investiert worden. Diese Wasserstraßen können nur von kleinen Binnenschiffen mit geringen Abladetiefen befahren werden." Im Hinblick auf die geplante EU-Osterweiterung komme jedoch gerade diesen eine besondere Bedeutung zu." so erklärte Angelika Mertens, Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen. Deshalb bestehe hier Handlungsbedarf: "Eine wettbewerbsfähige Binnenschifffahrt setzt eine leistungsfähige Infrastruktur voraus. Die Optimierung der verkehrlichen Situation der Wasserstraßen ist für uns deshalb eine vordringliche Aufgabe. Diese Investitionen kommen nicht nur Schifffahrt und Häfen zugute, sondern entlasten Straße und Schiene", betonte Mertens.
Neueste Verkehrsprognosen gehen für das Jahr 2015 von einer Güterverkehrsleistung in Höhe von 90 Mrd. tkm auf deutschen Wasserstraßen aus; dies ist ein weiterer Anstieg um 35 Prozent.
4. Verkehrsprojekte Deutsche Einheit
Allgemeine Planungsziele
Die Bedürfnisse einer mobilen Gesellschaft, die Anforderungen eines modernen Industriestaates und die Tatsache einer geografischen Mittellage des vereinten Deutschlands im erweiterten Europa bilden die strategischen Vorgaben für eine in die Zukunft weisende Verkehrswegeplanung in der Bundesrepublik Deutschland seit 1990. Die heute an vielen Stellen erkennbaren Zeichen einer sich stetig verbessernden Infrastruktur in den neuen Bundesländern sind die Ergebnisse einer an diesen Vorgaben orientierten Planung, die kurz nach Vollendung der Deutschen Einheit eingesetzt hat.
Bereits am 9. April 1991 hat die Bundesregierung die 17 Verkehrsprojekte Deutsche Einheit (VDE) beschlossen, um mit dem zügigen Aufbau einer leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur die wirtschaftliche Entwicklung in den fünf neuen Bundesländern zu fördern und das Zusammenwachsen der alten und neuen Bundesländer zu beschleunigen. Ein Unterfangen, dass hinsichtlich Komplexität und Dimension ohne Beispiel ist: neun Schienen- und sieben Fernstraßenprojekte sowie ein Wasserstraßenprojekt mit einem Gesamtvolumen von rund 36 Milliarden €. Damit machen die VDE einen entschiedenen Teil der Verkehrsinvestitionen in den neuen Bundesländern aus.
"Leistungsfähige Fernstrassen sind die Lebensadern für eine florierende Volkswirtschaft." Genau daran aber mangelt es in den neuen Bundesländern. Die Erschließung strukturschwacher Regionen, die Ansiedlung neuer Unternehmen und damit die Schaffung von Arbeitsplätzen, der Aufbau konkurrenzfähiger Wirtschaftszentren, die Erschließung neuer Märkte in den östlichen Nachbarstaaten - dies alles kann nur gelingen, wenn zwischen Ostsee und Thüringer Wald möglichst rasch eine leistungsfähige Verkehrs-Infrastruktur geschaffen wird.
Aktuelles Beispiel
Projekt 17 Wasserstraße: Ausbau Hannover - Berlin (ca. 280 km)
Mit einem behutsamen und umweltverträglichen Wasserstraßenausbau sollen die Schifffahrtsverhältnisse so gestaltet werden, dass der Verkehr mit Großmotorgüterschiffen bis 2.000 t und Schubverbänden mit 2 Leichtern bis 3.500 t möglich wird. Damit wird eine Standortverbesserung der Binnenhäfen Berlin, Brandenburg, Wustermark und Magdeburg sowie weiterer an den Wasserstraßen liegender Zentren erreicht. Außerdem werden die Bedingungen für den Containerverkehr in der Relation Hamburg - Magdeburg - Berlin deutlich verbessert. Damit können auch die stark belasteten West-Ost-Achsen der Straßen und der Schienenwege entlastet werden.
Vorrangige Ausbauten:
- Mittellandkanal, Elbe-Havel-Kanal und das Wasserstraßenkreuz Magdeburg;
Im Bau:
- Neubau der Kanalbrücke über die Elbe - Kosten rd. 105 Mio. €
- Doppelschleuse Hohenwarthe (rd. 107 Mio. €) und Schleuse Charlottenburg (rd. 50 Mio. €) sollen bis 2003 fertiggestellt sein
- diverse Streckenabschnitte in Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg sind im Bau.
Fertig gestellt:
- Teilanschluss Magdeburger Häfen mit Fertigstellung der Schleuse Rothensee im Mai 2001
Geplante weitere Fertigstellungen:
- 2003: Europaschiffe können teilabgeladen den Berliner Westhafen erreichen (Fertigstellung der Schleuse Charlottenburg)
- 2003: Elbwasserstandsunabhängiger Verkehr mit 2,50 m Abladung durchgehend bis Berlin (Sommer 1999: 1,50 m)
- 2005: Zweilagiger Containerverkehr bis Berlin (mit Einschränkungen)
- 2007: Fertigstellung des VDE 17 westlich der Elbe (Hannover - Magdeburg).
Gesamtinvestition: 2.280.000.000 €
bis 2001: 800.000.000 €
in 2002: 170.000.000 €
nach 2002: 1.310.000.000 €
5. Verkehrsprojekte Deutsche Einheit in Mecklenburg-Vorpommern
A 20: Bessere Anbindung für die Küste und das Hinterland
Mit dem 14,1 km langen Abschnitt der A 20 vom Autobahnkreuz Rostock (A 20/A 19) bis zur Anschlussstelle Satin mit Anbindung der B 110 begann der Bau der A 20 östlich der A 19.
Der geplante Neubau der A20 ist eines von sieben Fernstrassenprojekten im Rahmen der von der Bundesregierung aufgelegten "Verkehrsprojekte Deutsche Einheit" (Projekt Nr. 10).
Von den insgesamt 324 km der Fernstrasse führen 266 km durch Mecklenburg-Vorpommern. In der Verbindung mit der Westtangente Rostock (B103n - 11,4 km) und dem Rügenzubringer (B96a - ca. 20 km) erschließt die A20 die Hauptentwicklungsachsen von Mecklenburg-Vorpommern in -Ost-West-Richtung im Küstenbereich und gleichzeitig in Nord-Süd-Richtung in Vorpommern. Im Hinblick auf die Erschließungs- und Anbindungsfunktion in dem strukturschwachen und dünnbesiedelten Bundesland, aber auch zur Entlastung des nachgeordneten Strassennetzes ist die A20 unverzichtbarer Bestandteil einer leistungsfähigen Infrastruktur. Die neue Autobahn schafft eine deutliche Verbesserung der Anbindungssituation nach Westen für die Insel Rügen und die Regionen Vorpommerns. Eine weitere besondere Bedeutung dieses Abschnitts besteht in der erheblichen verkehrlichen Entlastung der Bundesstraße B 110 und B 105 sowie der bestehenden Anschlussstellen im Zuge der A 19 im östlichen stadtnahen Bereich von Rostock.
Mit der A 20 erhalten einerseits die Bewohner einen schnellen Zugang zum Fernstraßennetz, gleichzeitig profitieren Tourismus, Landwirtschaft, Handel und Gewerbe von der deutlich verbesserten Erreichbarkeit über die Autobahn. Durch die Verknüpfung mit der A1 bei Lübeck und mit der A11 südöstlich von Prenzlau schließt die A20 eine empfindliche Lücke im deutschen/europäischen Fernstrassennetz und gewinnt so über ihre regionale Funktion hinaus auch überregionale Bedeutung.
Daten und Fakten eines Abschnitts der A 20 vom Autobahnkreuz Rostock (A 20/A 19) bis zur Anschlussstelle Satin
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Belange der Umwelt
Naturschutz
Der Bau einer Autobahn ist immer mit unvermeidbaren Eingriffen in Natur und Landschaft verbunden. Zur Kompensation werden im Rahmen der landschaftspflegerischen Begleitplanung entsprechende Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen erarbeitet. Ein Teil dieser Maßnahmen liegt im näheren Trassenbereich, um bestehende ökologisch bedeutsame Flächen in ihrer Funktion zu schützen oder auch miteinander zu vernetzen.
Ein Großteil der Kompensationsmaßnahmen ist in Abstimmung mit den Naturschutzverwaltungen in den Wolfsberger Seewiesen und an der Kösterbeck vorgesehen. Der Erhalt zusammenhängender Lebensräume für verschiedene Tierarten wird ebenfalls in der Planung berücksichtigt. Die Wildunterführungen am Glöönmoor sowie am Horster See und die Wildbrücke östlich des Vietower Sees dienen diesen naturräumlichen Verbindungen.
Landwirtschaft
In weiten Teilen verläuft die A 20 auch durch landwirtschaftlich genutztes Gelände. Diese Flächen werden meist durch Flächendrainagen künstlich entwässert, die infolge des Autobahnbaus zum Teil zerstört bzw. unterbrochen werden. Damit die Qualität der Agrarflächen gesichert bleibt, werden die Drainage- und Entwässerungsleitungen wieder funktionsfähig verbunden.
Wohnen und Erholen
Bereits im Rahmen der Umweltverträglichkeitsstudie bei der Linienfindung wurde unter Abwägung aller Belange darauf geachtet, wesentliche Lärmbeeinträchtigungen für bebaute Bereiche zu vermeiden. Schalltechnische Untersuchungen zeigten, dass die zulässigen Grenzwerte bei einigen einzeln stehenden Gebäuden im Außenbereich zwar nicht am Tage, jedoch in der Nacht überschritten werden. Aktive Lärmschutzmaßnahmen (Lärmschutzwände und -wälle) sind demnach nicht erforderlich. Ein Anspruch auf passiven Lärmschutz (i.d.R. Lärmschutzfenster) besteht für einzelne Gebäude. Er wird in der Planfeststellung dem Grunde nach festgestellt. Die notwendigen Schutzmaßnahmen werden im Anschluss durch ein gesondertes Gutachten festgelegt.
Gewässer- und Trinkwasserschutz
Die Trinkwasserversorgung der Hansestadt Rostock erfolgt aus der "fließenden Welle" der Warnow. Im gesamten Einzugsgebiet der Warnow, also auch der Kösterbeck mit ihren Zuläufen, gibt es deshalb besondere Anforderungen an die Straßenoberflächenwasserreinigung.
Das auf der A 20 anfallende Regenwasser wird über Längsleitungen gesammelt und in Regenrückhaltebecken geleitet. Diese verfügen über ein Absetz-, Rückhalte- und Sandfilterbecken. Den Vorflutern wird somit zeitlich verzögert zur Vermeidung der Überlagerung von Abflussspitzen bereits vorgereinigtes Wasser schadlos zugeführt. (Übersichtskarten + Prospekte zur A20 siehe Anlagen)
Notwendigkeit von VDE
Das im Grundgesetz verankerte Recht auf Freizügigkeit ist ein Beleg für den hohen Stellenwert, der dem Bedürfnis des modernen Menschen nach Mobilität beigemessen wird. Ausdruck dieses Bedürfnisses ist die stetige Weiterentwicklung der Verkehrssysteme zu Lande, zu Wasser und in der Luft und deren Verfügbarkeit für immer mehr Menschen. Die logische Folge ist ein vor 100 Jahren nicht vorstellbares Anschwellen der Verkehrsströme.
Die aktuelle Mobilitätsstatistik veranschaulicht diesen Trend: Danach legt jeder Deutsche jährlich 1114 Wege zurück. Das Auto als Verkehrsmittel liegt dabei mit 52%deutlich an der Spitze. 28% der Wege werden zu Fuß zurückgelegt, 10% mit dem Fahrrad, 9% mit öffentlichen Verkehrsmitteln, 2% mit der Bahn.(Quelle: DIW ´94)
Diese Entwicklung ist keineswegs unproblematisch - doch sie ist eine Realität. Es muss also die Aufgabe einer gleichermaßen realitätsbezogenen wie zukunftsorientierten Verkehrspolitik sein, diese Verkehrsströme nicht unkontrolliert wuchern zu lassen, sondern sie zu bündeln und in vernünftige Bahnen zu lenken. Nicht technisch mögliche Höchstgeschwindigkeiten stehen im Vordergrund, sondern ein den ökologischen, ökonomischen und verkehrlichen Bedingtheiten angemessener, zügiger und möglichst störungsfreier Verkehrsfluss.
6. "Wer Strassen sät, wird Verkehr ernten."
Strassen und andere Verkehrswege werden natürlich nicht ohne Grund gebaut. Man will schließlich, dass diese auch genutzt werden. Außerdem muss man differenzieren zwischen Strassen, die ihren Zweck haben als Entlastungsstrassen (z.B. Umgehungsstrassen) und als Strassen, die neues Territorium erschließen und Gebiete verbinden sollen.
Bevor diese -Neubauten aber errichtet werden können, müssen jene Richtlinien mit denen der Umweltverträglichkeitsstudien (UVS) übereinstimmen, die schon in sehr frühen Stadien der Planung entstehen. In der Strassenplanung ist sie ein umfassender landschaftsplanerischer Fachbeitrag, der auf der Ebene der Linienbestimmung die Wirkung des Vorhabens auf die Umwelt erfasst, analysiert und bewertet. So kann man schon frühzeitig abschätzen, welche Belastungen auf die Umwelt zukommen werden und wie man im Sinne des vorbeugenden Umweltschutzes handeln muss. Schutzgüter sind: Wohnen und Erholen/ Tiere und Pflanzen/ Boden/ Wasser/ Luft/ Klima/ Landschaft/ Kultur- und Sachgüter.
Die Verkehrswege werden also unter jedem Aspekt des Natur- und Umweltschutzes errichtet. So kann man sich sicher sein, dass der Verkehr, welcher Art auch immer, nicht in einem unbekannten Ausmaß, welches Schädigung jeglicher Ressourcen hervorrufen würde, über diese Wege rollt.
Quellenverzeichnis:
Internet (Recherche und Bilder) :
- www.bmvbw.de
- www.bundesregierung.de
- www.autobahn-online.de
- www.Hausarbeiten.de
- www.schule.de/bics/son/verkehr/index.htm
- www.schifffahrtslexikon.de
- www.bahn.de
- www.umweltbundesamt.org
- www.frankfurt-main.ihk.de
Sachbücher:
- Gabler-Volkswirtschafts-Lexikon
- Wirtschaftslexikon, 6. Aufl.; Woll, Artur (Hrsg.)
- GEOS Schullehrbuch Gymnasium: "Wirtschaftsräume und Siedlungen"
Presse, Zeitungen und andere Materialien :
- Prospekt der DEGES (Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH):" A20"
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Fokus der "Infrastruktur" Textvorschau?
Die Textvorschau "Infrastruktur" konzentriert sich auf die Bedeutung der Infrastruktur, insbesondere der Verkehrsinfrastruktur, für die Wirtschaftsentwicklung, insbesondere im Kontext Deutschlands und am Beispiel Mecklenburg-Vorpommerns.
Was wird in der Einleitung des Textes behandelt?
Die Einleitung betont die grundlegende Bedeutung effizienter Verkehrsnetze für die Wirtschaft, die Notwendigkeit guter Verkehrsinfrastruktur für Bürger und Unternehmen und die Defizite im Ausbauniveau der Infrastruktur in Mecklenburg-Vorpommern im Vergleich zu den alten Bundesländern. Es wird auch hervorgehoben, dass die wirtschaftliche Entwicklung von Mecklenburg-Vorpommern nur durch die Verbesserung der Standortbedingungen und den Ausbau der Verkehrswegeinfrastruktur initiiert werden kann.
Wie wird der Begriff "Infrastruktur" definiert?
Der Text erläutert den Begriff der Infrastruktur als Basiseinrichtungen einer Volkswirtschaft. Es werden verschiedene Definitionen aus dem Gabler-Volkswirtschafts-Lexikon und von Woll zitiert. Im Wesentlichen besteht die Infrastruktur aus Einrichtungen, die für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung notwendig sind, einschließlich Einrichtungen für Verkehr, Energieversorgung, Bildung, Gesundheitswesen usw.
Welche typischen Merkmale einer Infrastruktur werden genannt?
Zu den Merkmalen gehören Investitionscharakter, positive und negative externe Effekte, technologische Unteilbarkeit und der Charakter eines Kollektivgutes.
Welche Arten von Infrastruktur werden unterschieden?
Es wird eine Unterscheidung zwischen konsumtiver, haushaltsorientierter Infrastruktur (z.B. Parks, Theater) und produktiver, unternehmensorientierter Infrastruktur (z.B. Häfen, Güterbahnhöfe) getroffen.
Welche Rolle spielt die Infrastruktur für die Wirtschaft?
Ein funktionierendes Verkehrssystem wird als zentrale Voraussetzung für Wirtschaftswachstum und Beschäftigung gesehen. Mangelnde Erreichbarkeit und lange Wege bedeuten einen Standortnachteil. Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur sind entscheidend für einen starken Wirtschaftsstandort Deutschland.
Welche Rolle spielen die verschiedenen Verkehrswege (Strasse, Schiene, Wasser) in Deutschland?
Die Strasse trägt die Hauptlast des Personen- und Gütertransports, jedoch sind Investitionen in den Ausbau notwendig, um den steigenden Bedarf zu decken. Die Schiene profitiert von Investitionen, insbesondere in die Schienenverkehrsprojekte Deutsche Einheit. Die Wasserstrassen spielen eine wichtige Rolle, insbesondere im Hinblick auf kostengünstige und umweltfreundliche Gütertransporte, jedoch sind Investitionen in die Infrastruktur notwendig, insbesondere in den östlichen Bundesländern.
Was sind die Verkehrsprojekte Deutsche Einheit (VDE)?
Die VDE sind 17 Verkehrsprojekte, die von der Bundesregierung beschlossen wurden, um die wirtschaftliche Entwicklung in den neuen Bundesländern zu fördern und das Zusammenwachsen der alten und neuen Bundesländer zu beschleunigen. Sie umfassen Schienen-, Fernstrassen- und Wasserstrassenprojekte.
Welche Ziele verfolgen die VDE?
Die Ziele sind die Bedürfnisse einer mobilen Gesellschaft zu befriedigen, die Anforderungen eines modernen Industriestaates zu erfüllen und die geografische Mittellage Deutschlands im erweiterten Europa zu nutzen. Konkret geht es um die Erschließung strukturschwacher Regionen, die Ansiedlung neuer Unternehmen und die Schaffung von Arbeitsplätzen.
Welche Rolle spielt die A20 in Mecklenburg-Vorpommern?
Die A20 ist ein Fernstrassenprojekt im Rahmen der VDE. Sie erschließt die Hauptentwicklungsachsen von Mecklenburg-Vorpommern in Ost-West-Richtung im Küstenbereich und gleichzeitig in Nord-Süd-Richtung in Vorpommern. Sie ist unverzichtbar für eine leistungsfähige Infrastruktur und verbessert die Anbindungssituation nach Westen für die Insel Rügen und die Regionen Vorpommerns.
Welche Umweltbelange werden beim Bau von Verkehrswegen berücksichtigt?
Im Rahmen der landschaftspflegerischen Begleitplanung werden Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen erarbeitet, um unvermeidbare Eingriffe in Natur und Landschaft zu kompensieren. Es werden Belange des Naturschutzes, der Landwirtschaft, des Wohnens und Erholens sowie des Gewässer- und Trinkwasserschutzes berücksichtigt.
Was bedeutet der Satz "Wer Strassen sät, wird Verkehr ernten"?
Der Satz bedeutet, dass der Bau von Strassen und Verkehrswegen die Nutzung dieser Wege fördert. Es wird betont, dass die Strassenplanung unter Berücksichtigung von Umweltverträglichkeitsstudien (UVS) erfolgt, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren.
Woher stammen die Informationen im Text?
Die Informationen stammen aus Internetquellen, Sachbüchern, Presse, Zeitungen und anderen Materialien, die im Quellenverzeichnis aufgeführt sind.
- Arbeit zitieren
- Kai Grossmann (Autor:in), 2003, Infrastruktur - Rückgrat der Wirtschaft ?!, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/108016