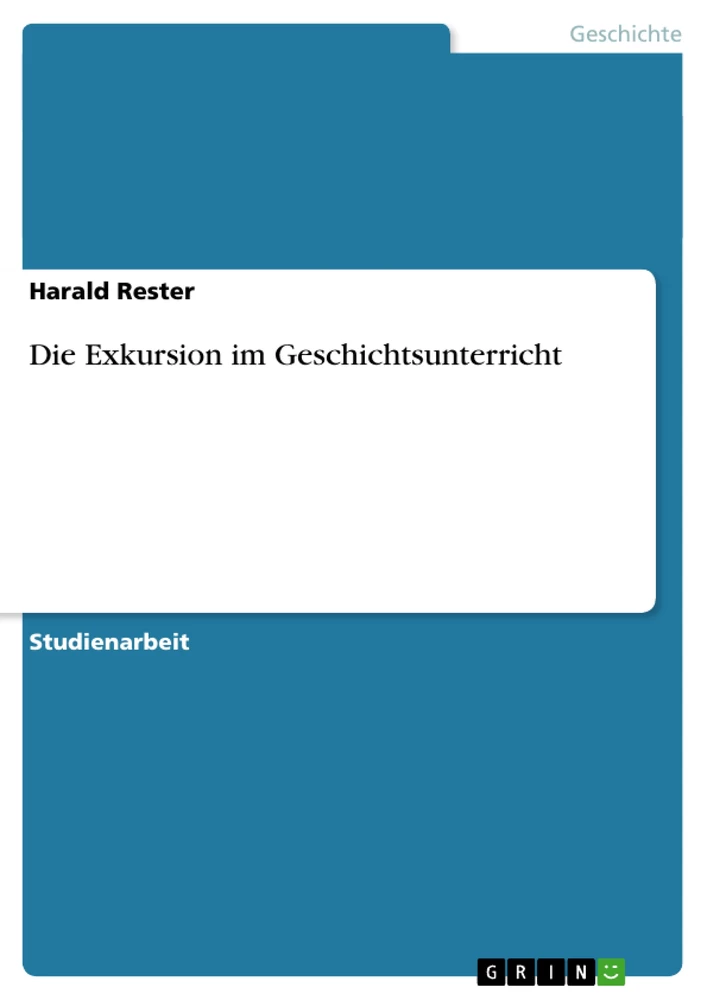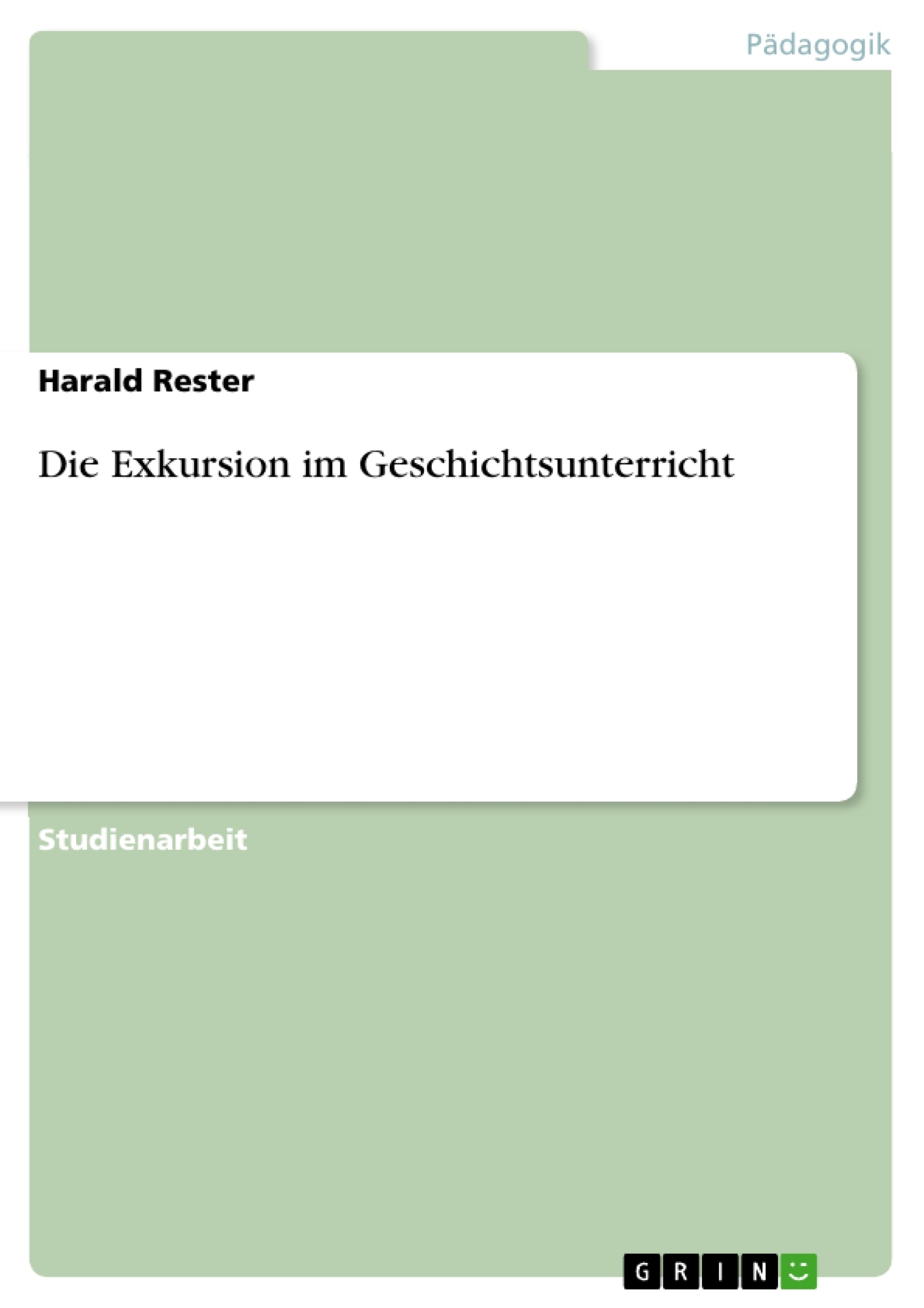Begeben Sie sich auf eine fesselnde Reise in die Welt der historischen Exkursionen, ein unverzichtbares Werkzeug für Geschichtslehrer und alle, die Geschichte lebendig erleben möchten! Dieser umfassende Leitfaden enthüllt das transformative Potenzial des Lernens außerhalb des Klassenzimmers, indem er historische Stätten, Museen und Archive in dynamische Lernumgebungen verwandelt. Entdecken Sie, wie Sie mit sorgfältiger Planung, motivierenden Aktivitäten und der direkten Auseinandersetzung mit authentischen historischen Zeugnissen das Interesse Ihrer Schüler wecken und ein tieferes Verständnis für die Vergangenheit fördern können. Von der Gestaltung anregender Museumsbesuche und Archivrecherchen bis hin zur Erkundung historischer Landschaften bietet dieses Buch praktische Anleitungen, bewährte Methoden und innovative didaktische Ansätze. Erfahren Sie, wie Sie Exkursionen effektiv in Ihren Geschichtsunterricht integrieren, um historische Zusammenhänge zu veranschaulichen, kritisches Denken zu fördern und das forschende Lernen zu unterstützen. Profitieren Sie von detaillierten Überlegungen zur Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Exkursionen, einschließlich der Auswahl geeigneter Ziele, der Entwicklung von Arbeitsmaterialien und der Bewertung des Lernerfolgs. Lassen Sie sich inspirieren, Ihre Schüler zu aktiven Entdeckern der Vergangenheit zu machen und ihnen unvergessliche Lernerlebnisse zu ermöglichen. Tauchen Sie ein in die Welt der Museumspädagogik, lernen Sie, wie man Objekte im Museum didaktisch wertvoll einsetzt und wie Archive zu spannenden Exkursionszielen werden. Entdecken Sie die didaktischen Möglichkeiten der historischen Exkursion, von der Motivation der Schüler bis zur intensiven Arbeit am Objekt. Dieses Buch bietet Ihnen das Handwerkszeug, um den Geschichtsunterricht auf eine breitere Basis zu stellen und das forschende und entdeckende Lernen der Schüler zu fördern, immer die Möglichkeiten und Grenzen einer Exkursion im Blick. Ein unverzichtbarer Ratgeber für jeden, der Geschichte nicht nur lehren, sondern erlebbar machen möchte – ein Schlüssel zur Entfaltung unterrichtlicher Freiheit und zur Förderung einer tieferen Verbindung zwischen Mensch und Vergangenheit.
1. Die historische Exkursion
Der Begriff der historischen Exkursion faßt weitgehend alle „früheren“ Begriffe, wie „Wanderung“, „Besichtigung“, „Unterrichtsgang“ etc. zusammen. Das entscheidende Kriterium dieser Organisationsform des Unterrichts ist praktisch das Verlassen der Schule um Zeugnisse der Geschichte aufzusuchen. Die Exkursion als Realbegegnung mit Geschichte bildet daher auch einen sinnvollen Kontrast zwischen dem von Papier dominierten und rezessiv geprägten Unterricht des Alltags, d.h. an die Stelle einer bisherigen kontemplativen Besichtigung steht die fragend-entdeckende Schülerarbeit. In diesem Sinne werden „Gegenständliche“ Quellen untersucht; Das können einzelne Gegenstände, Einzelbauten, bauliche Anlagen aber auch beispielsweise um Burg und Stadt, oder auch ganze Regionen sein.
Die historische Exkursion ist eine Organisationsform des historisch-politischen Unterrichts, die ein bestimmtes Thema durch die Arbeit an und mit (möglichst) originalen historischen Zeugnissen außerhalb der Schule erschließt.
Der direkte Kontakt mit altem Gemäuer, alten Schriften oder altem Werkzeug vermittelt dem Schüler historische Atmosphäre, regt ihn zum Nachdenken und Forschen an. Die Exkursion bietet darüber hinaus mit ihrer Beschäftigung mit den Quellen eine hervorragende Gelegenheit für das exemplarische Arbeiten: Die Leistung einer gegenständlichen Quelle liegt in ihrer eigenen Geschichte als Einzelerzeugnis mit ihrer Herkunft und Machart, aber gleichzeitig auch in der Repräsentation ähnlicher geschichtlicher Zeugnisse. Allerdings muß auch gesagt werden, dass die gegenständlichen Quellen vielfach anonymer und schwieriger sind, sie setzen ein höheres Maß an Vorwissen voraus um einmal die Quelle auszuwählen, aber auch um etwaige Fragen der Schüler zu beantworten.
Obwohl die Exkursion außerhalb stattfindet, werden doch in der Schule die nötigen Vor- und Nachbereitungen geleistet. Die Exkursion kann im Unterrichts zudem besondere didaktische Funktionen einnehmen: zum einen als Einstieg für den Anfang einer neuen Unterrichtsreihe oder im Laufe einer Unterrichtsreihe zur Veranschaulichung bereits gelernter Zusammenhänge, aber auch am Abschluß einer Unterrichtsreihe zur Zusammenfassung des Gelernten.
Zwar fast die Exkursion, als außerschulische Organisationsform, einen relativ weiten Bereich, dennoch bilden sich einige Schwerpunkte heraus: Zum einen Museen, Ausstellungen und Archive und zum anderen architektonische Zeugnisse. Zwischen diesen beiden ist der Besuch eines Freilichtmuseums einzuordnen.
2. Landschaft und historische Stätten
Martin Schwind befasst sich als Geograph mit einer Klassifizierung von Landschaften.
Eine Landschaft ist insofern Kulturlandschaft, da sie durch den Menschen umgeprägt wurde und beinhaltet somit geschichtlich bedingte Züge.
Schwind nennt vier Kategorien, aus denen sich die heutige Kulturlandschaft ergibt:
- geschaffene Formen der Gegenwart (Städte, Verkehrseinrichtungen, Neusiedlungen)
- geschaffenen Formen der Vergangenheit, welche aber noch lebendig und gegenwärtig sind (Städte, Dörfer, Flurformen, Straßennetz)
- geschaffenen Formen der Vergangenheit, mit nicht mehr lebendigen Formen (Schlösser, Befestigungswerke, Römerstraßen)
- geschaffene Formen der Vergangenheit, aber nur noch durch Spuren feststellbar (Ruinen, alte Raine)
Landschaft einerseits, und Mensch andererseits stehen in der Kulturlandschaft in einem engen Verhältnis, d.h. Landschaft ist nicht nur ein bloßer Schauplatz geschichtlicher Vorgänge, sondern gestaltet und greift selbst in die Geschichte ein. Eine somit bestimmte Landschaft als Kulturlandschaft fällt praktisch mit dem Begriff der Geschichtslandschaft, oder auch historischen Landschaft zusammen. Die Landschaft fördert im geschichtlichen Zusammenhang das Gefühl, das sich Geschichte im räumlicher Gebundenheit abspielt und diese wiederum die Landschaft prägt.
„“Wichtig dabei ist, dass bei einer Exkursion die Lokalisation historischen Geschehens, die ja zugleich ein Aufdecken der wechselseitigen Beziehungen zwischen historischem Prozeß und geographischem Milieu ist, nicht nur auf der Karte und im Bild stattfindet, sondern in der konkreten Begegnung mit dem originalen Raum erlebt wird.“
Historische Stätten sind alle Orte, Ortschaften und Örtlichkeiten die eine geschichtliche Entwicklung erfuhren und wo Geschichte als Ereignis stattfand. Es sind Stätten die in ihrer konkreten Gestalt eine historische Aussage besitzen, aber auch Stätten denen diese Aussage augenscheinlich fehlt und wo man es ihnen nicht mehr (sofort) ansieht, z.B. Schlachtfelder. Die historische Landschaft wird somit durch die historischen Stätten erst sichtbar und die historischen Stätten zeigen die historischen Begebenheiten.
Für den interpretatorischen Zugang zu historischen Stätten gilt, dass es entscheidend darauf ankommt auch Zusammenhänge wie ein Bauwerk entstanden ist, in denen es gestanden hat, oder noch steht, aufzudecken. Die Zusammenhänge können räumlicher Art sein, aber auch politisch, religiös, wirtschaftlich, etc. sein. Wenn diese Zusammenhänge erarbeitet werden geben sie schließlich die eigene Geschichte und die des Gemeinwesens, sowie die Funktionen eines Bauwerks preis.
Einige Exkursionsmöglichkeiten (nach Walter Ziegler):
- Steinzeit: Wohnhöhlen, Siedlungsspuren
- Metallzeit: Hallstatthügelgräber, Kelt. Viereckanlagen, Wehranlagen
- Römerzeit: Limes, Römerlager, Römerstraßen, Ausgrabungen
- Frühes MA: Kirchen, Stadtmauern, Ringwälle
- Hohes MA: Dome, Klöster, Marktplätze, Brücken
- Spätmittelalter: Kirchen, Rathhäuser, Spitale, Universitäten
- Reformation: Evangelische Kirchen, Schulen, Bibliotheken
- Barock: Schlösser, Residenzen, Wallfahrtskirchen, Manufakturen
- Aufklärung: Anlage von Straßen, Kanälen
- 19./20. Jahrhundert: Fabriken, Eisenbahnen, Bergwerke, Industrieanlagen, Verwaltungsbauten
3. Das Museum als Exkursionsziel
3.1 Die Museumspädagogik
In den letzten Jahren kommt es immer mehr zu einer erstaunlichen Konjunktur für Museen und Ausstellungen. Dieser Erfolg kommt in erster Linie von den Museen selbst, die langjährig eine neue Museumspädagogik planten. Die Museumspädagogik leistet eine Zuwendung der Museen zu pädagogischen Aufgaben und didaktischen Fragestellungen. Die bisherigen Aufgaben der Museen, das Sammeln, Erhalten und Ausstellen, werden durch wirksame Vermittlung des ausgestellten Objektes, sowie dessen historischen, künstlerischen und funktionalen Sachverhalte, erweitert. Diese Vermittlung zielt zum einen auf eine bessere Vermittlung der Objekte an den Museumsbesucher, aber auch an den Besucher selbst, der sich mit den Objekten Auseinandersetzen soll.
Die Museumspädagogik verfolgt drei wesentliche Ziele:
- Das Bemühen, durch geeignete Maßnamen möglichst viele verschiedene Besucher anzusprechen und diesen die Scheu vor Museen zu nehmen
- Das Erschließen der Museumsbestände in einer adäquaten Form, so z.B. durch Führungen, Unterricht, Vorträge, Arbeitsgemeinschaften oder Exkursionen
- Anregung zu einer kritischen Auseinandersetzung mit den ausgestellten Objekten, Besinnung über die eigene Position
Zwar richtet sich die Museumspädagogik generell an alle Interessierten, doch der Schwerpunkt liegt eindeutig bei der Zusammenarbeit mit Schulen und Schülern.
Generell sollte eine Gruppe von Schülern von ihrem jeweiligen Klassenlehrer begleitet werden. Er kennt seine Schüler am besten, kann den Kenntnisstand beurteilen und führt schließlich auch den vor- und nachbereitenden Unterricht durch. Da aber leider nur die wenigsten Lehrer für die Aufgabe, Unterricht im Museum durchzuführen, ausgebildet worden sind, bemühen sich die Museen ihrerseits um den Einsatz von Museumspädagogen. Ansonsten hilft dem Lehrer das Angebot didaktischer und methodischer Hilfen der Museen.
3.2 Objekte in Museen
Entgegen der älteren Auffassung, dass sich ausgestellte Objekte bei längerem Betrachten selbst erklären, geht man heute dazu über die Exponate zu beschriften. Dies wird dadurch verdeutlich, dass die Ausstellungsgegenstände ursprünglich nicht für Museen geschaffen wurden. Das Objekt tritt somit aus all seinen Zusammenhängen heraus, verliert dadurch seine Umgebung, Funktion und historische Aussagekraft. Die einfachste Form diesem entgegenzuwirken ist ein Textschild in der Nähe des Objekts. Die Forderungen gehen auf ein gut plaziertes Textschild in Augenhöhe, welches gut Lesbar ist und eine ausreichend informierende Betextung aufweist. Günter Gottman schlägt hierbei eine dreistufige Textinformation vor: Eine großgeschriebene Benennung des Exponats, darunter eine etwas kleinere allgemeine Satz- oder Funktionsbeschreibung und danach eine ausführliche Sachinformation. Des weiteren könne auch Fotographien oder Karten hilfreich dabei eingesetzt werden. Das Objekt kann so in seinem ursprünglichen Zusammenhang gezeigt werden und Karten zeigen z.B. Ausgrabungsorte oder Verbreitungen.
Auch Dias oder Filme sind weitere Informationsmöglichkeiten die in der Nähe eines Exponats gezeigt werden können. Sie widmen sich meist ganzen Themengruppen, seltener einzelnen Objekten. Das Dia wird von den Museumspädagogen anerkannt, wo hingegen der Film schwieriger im Museum einzusetzen ist, da der Film einen festen Raum, sowie feste Anfangszeiten benötigt. In der Vor- und Nachbereitung allerdings läßt sich ein Film hervorragend für größere Zusammenhänge oder Animationen verwenden.
In der Regel wird im Museum versucht, Originale auszustellen. Aber vor allem im archäologischen Bereich wird sich niemand gerne einzelne Scherben ansehen uns so werden häufig Rekonstruktionen auch mit Ergänzungen eingesetzt. Rekonstruktionen, aber auch Kopien haben den großen Vorteil, dass sie dem Schüler erlauben die Exponate auch anzufassen, ohne gleich ein Original im schlimmsten Falle zu zerstören oder zu entwerten. So erlauben diese weit eher den didaktisch gewünschten Zugriff als ein Original: Kopien oder
Rekonstruktionen können mehrfach produziert werden und so einer Schulklasse zur Verfügung gestellt werden. Dennoch ist es natürlich besser, dem Schüler Originale und nicht „abgekupferte“ Exponate zu zeigen.
3.3 Schriftliche Arbeitsmaterialien
Die gebräuchlichsten Arbeitsmittel beim Unterricht in Museen stellen Arbeitsblätter dar. Sie sind entweder vom Museum gestellt oder auch vom Lehrer vorbereitet. Die Schüler erarbeiten darin bestimmte Themenkomplexe an den jeweils aufzusuchenden Objekten, in der Schule werden schließlich die Arbeitsergebnisse zusammengetragen und ausgewertet. (Siehe auch 5.2) Kritiker bemängeln allerdings an den Arbeitsblättern, dass sie sich regelrecht zwischen den Schüler und dem betreffenden Objekt stellen, die Aufmerksamkeit zu sehr auf sich ziehen und so ein spontanes Erleben beeinträchtigen.
4. Das Archiv als Exkursionsziel
Auch Archive haben in letzter Zeit immer mehr versucht sich einer interessierten Öffentlichkeit zu zeigen. Vorbildfunktion ist der „Service educatif“, eine Zusammenarbeit zwischen französischen Archiven und Schulen.
Eine einmalige Archivbesichtigung stellt wohl die einfachste Form der Begegnung zwischen Schule und Archiv dar, hat allerdings auch den Nachteil, dass sich das Archiv „nur“ selbst repräsentieren wird und kein Schüler mit den Quellen direkt auf Tuchfühlung gehen kann. Wenn sich auch nicht eine längere Zusammenarbeit zwischen Schule und Archiv für eventuelle Nachforschungen ergibt, wird es zu keiner nennenswerten Auseinandersetzung mit den Quellen kommen. Archivausstellungen, unterschieden werden Dauerausstellungen und zeitlich begrenzte Sonderausstellungen, sind didaktisch gesehen schon etwas besser für den Schüler konzipiert, da die Archivalien besser aufbereitet sind und dem Schüler besser vermittelt werden können.
Johannes Bischoff unterscheidet des weiteren noch zwei verschiedene Ausstellungsformen:
- a) Archivalienausstellung
- ⇒ die Ausstellung beschränkt sich auf eigentliche schriftlichen Aufzeichnungen, auf Archivalien im traditionellen Sinn
- b) Archivausstellung
- ⇒ in der Ausstellung werden die Archivalien mit neuzeitlichen Informationsträgern aufbereitet, bzw. gemischt;
Wagner spricht bei der Archivausstellung von der „integrierten Gesamtdokumentation“, einer Erweiterung der traditionellen Ausstellung mit Plakaten, Filmen, Tonträgern und auch Gebrauchsgegenständen. Die Fülle der verschiedenen Quellen macht so eine Ausstellungsaussage intensiver und erfahrbarer. Die Archivausstellungen unterscheiden sich eigentlich nur in dem hohen Anteil schriftlicher Quellen vom eigentlichen Museum, aber hier besteht insbesondere Gefahr, das schriftlichen Quellen neben Fernseher und Tonbandaufnahmen nicht genug Beachtung geschenkt werden. Da das Schriftgut noch weniger Besucher anspricht als museale Gegenstände, stellt sich wieder das Problem der Beschriftung und Erläuterung der Exponate dar. Ein Ausstellungskatalog leistet in diesem Fall die Besten Dienste; Die Austellungsstücke sind mit vollem Text abgedruckt und alle nötigen Informationen werden den Interessierten gegeben.
„Wie soll er [der Lehrer] nun ein archivisches Schriftstück, u. U. in fremder Sprache oder schwer lesbar, von dem er durch Glas durch eine Vitrine getrennt ist, das nur von einigen Schülern überhaupt betrachtet werden kann, die an der Vitrine Platz haben...wie also soll er selbst mit einer geübten Klasse und in Auswahl sich durch die Fülle der zu einem Ereignis oder Thema ausgebreiteten Quellen arbeiten?“
Materialien und Gegenstände, welche man nicht selbst berühren kann sind eben nicht so beeindruckend wie ein altes Buch, dessen vergilbte Seiten man aufschlägt. Gregor Richter und Hans-Joachim Behr machten den Vorschlag, kleinere und speziellere Ausstellungen, die sich direkt am Lehrplan orientieren, durchzuführen. Daraus würde ein Angebot der insbesondere kommunalen Archive resultieren, das bei wiederkehrenden Themen immer wieder Schüler die speziellen Ausstellungen besuchen könnten. In diesen wird Anschauliches, Konkretes und vertraute Orts- und Sachbezüge vermittelt, sowie Materialien zu Verfügung gestellt, das den Schüler insgesamt einen unmittelbaren Zugang zu der Geschichte seiner engeren Heimat vermittelt. Die Archive würden somit Quellen zur Verfügung stellen, die nicht im normalen Quelleneditionen zu finden sind, und gleichzeitig durch ihre Einzigartigkeit den Schüler motivieren
5. Didaktischen Möglichkeiten der historischen Exkursion
5.1 Motivation
Zwar gibt es keine gesicherten Erkenntnisse, wann und wie stark Kinder an Geschichte interessiert sind und in welcher Weise sie dadurch animiert werden, doch fest steht, dass die Kinder im Laufe ihrer Entwicklung durch zunehmendes kulturhistorisches Interesse und zunehmender Reisehäufigkeit wachsende Bedeutung an Besichtigungen und Museen finden.
Der Grund der Motivation der Schüler durch eine Exkursion liegt zum einen im Verlassen der Schule: Der Unterricht nähert sich durch das Verlassen der herkömmlichen Lernumgebung wieder einer natürlichen Lernumgebung an, in der Umwelt durch Beobachtungen und Erfahrungen gelehrt wird. Der fehlende Zwang einer Schulorganisation, eines vielleicht „erdrückenden“ Stundenplanes und/oder Lehrplanes, wirkt zudem befreiend und dadurch auch motivierend auf den Schüler, sowie auf den Lehrer. Themen können nun gründlich, ohne Pausenunterbrechungen etc. und ohne einen „höheren Zwang“ behandelt werden.
Der Begriff der Realbegegnung tauchte bereits auf und spielt hier wieder eine große Rolle: sie ist die zweite große Motivationskraft der Exkursion. Begegnungen mit tatsächlichen historischen Zeugnissen sind unerläßlich. Erst sie entwickeln ein wirkliche Begegnung mit der Geschichte selbst. Heinrich Roth schreibt dazu:
“Es darf nicht nur über den Gegenstand geredet werden, sondern der Gegenstand muss selbst da sein.“
Bisher wurde immer nur eine aufbereitete, oftmals geschönte Geschichte durch Lehrmittel vermittelt, aber jeder Schüler wird sich eher für eine Burg interessieren, die er selbst in natura sieht, als für eine, die er in einer Abbildung sieht. Historische Zeugnisse mit ihrer Signalwirkung besitzen in der Tat eine Aura des historischen, das anschaulich, exemplarisch und auch präsentativ einen Sachverhalt erschließt.
Ein weiterer Punkt der Motivation liegt in der Zusammenarbeit von Lehrer und Schüler. Deutlich wird dies, wenn man betrachtet, dass Lehrer und Schüler während einer Exkursion oftmals den ganzen Tag mit gemeinsamer Arbeit verbringen, und abends eventuell noch gemeinsam zusammen sitzen. Sie unterliegen alle den gleichen Anstrengungen und haben aufgrund dieser Gleichstellung bessere Kontaktmöglichkeiten und der Lehrer auch so eine gezieltere kameradschaftlichere Wirkung auf den Schüler.
Die Gleichstellung tritt zudem dadurch hervor, dass die Schüler möglichst viel an Planung und Verantwortung für eine Exkursion mit tragen und dadurch motiviert werden, dass sie ihre eigenen Pläne erreichen wollen
5.2 Arbeit am Objekt
Ein Überblick über die einzelnen Phasen zur Arbeit am Objekt stellt sich so dar:
- Fragestellung, Arbeitshypothese
- Reflexion möglicher Methoden
- Datenerhebung und Aufzeichnung
- Interpretation, Bewertung von Ergebnissen, Methodenkritik
- Feststellung von Regelhaftigkeiten
Um historische Zusammenhänge und somit eine exemplarische Erschließung historischer Erkenntnisse zu erarbeiten; museale Isolierung aufzuheben, dient die Arbeit am Objekt. Die Herangehensweise an ein Objekt ist durch ein mehr oder weniger präzises Vorwissen gekennzeichnet und lenkt so die Betrachtung des Schülers. Diese Lenkung kann aber auch von außen, z.B. durch Arbeitsaufträge erfolgen.
- Die einfachste Form stellt ein Arbeitsauftrag da, in welchem der Schüler bestimmte Objekte beschreibt, malt oder nachzeichnet. Es fordert ein genaues Hinsehen und Einlassen auf das Objekt. Aber auch selbstgemachte Photographien helfen den Blick für Wesentliches zu schulen.
- Eine weitere sinnliche Betrachtungsmöglichkeit ist das Anfassen von Objekten, was vor allem von der Museumspädagogik immer gefordert wird. Gerade bei Kindern, aber auch bei Erwachsenen ist das Begreifen ein wesentlicher Bestandteil für das Verständnis eines Objekts. Museale Objekte werden dadurch ihrer Isolierung entrissen, sie werden wieder in ihre ursprünglichen Sach-, sowie Funktionszusammenhänge zurückgeführt und vermitteln Geschichte „hautnah“.
- Bauen, Basteln und Modellieren stellen eine weitere Möglichkeit des hantierenden Lernens dar. Ganze Burgen können mit Bögen aus Papier nachgebaut werden und einfache Zusammenhänge an Modellen aufgezeigt werden.
- Das Wandern und Gehen sollte bei Exkursionen nicht vernachlässigt werden. Die Festung Marienberg zu „erklimmen“ ist wohl ein einprägsameres Erlebnis für den Schüler, als direkt mit den Bus vor den Eingang gefahren zu werden und sich nachher eine Topographische Karte anzusehen. Es werden wieder „hautnahe“ Gefühle vermittelt, wie sich z.B. mögliche Angreifer der Burg gefühlt haben, läßt die Schüler in einer Art und Weise Geschichte erleben.
Interpretationen der Objekte geschehen am besten in Unterrichtsgesprächen und Einzel- oder Gruppenarbeit. Der Lehrer dient hierbei, sowie bei den Begegnungen der Schüler mit den Objekten als Organisator, als Leiter des unterrichtlichen Geschehens. Er ist mehr Partner und lenkt eventuell den Unterrichtsverlauf mit Fragen und Impulsen.
Zur Interpretationen von schriftlichen Quellen, z.B. aus Archiven, stellt Hey folgenden Arbeitskanon vor:
- Art der Quelle klären!
- Sämtliche Personen feststellen! (auch Verfasser, Adressat)
- Geschichtlichen Umstände analysieren!
- Interpretation des Inhalts!
- Einordnung der Quelle in spezielle geschichtliche Verhältnisse
- Kritisches Gesamturteil der Schüler
6. Überlegungen zur Planung und Vorbereitung
Die Verbindung eines schulischen Unterrichts und einer Exkursion kann, je nach Einsatzart stark variieren. Eine Exkursion zur reinen Veranschaulichung oder Illustration der behandelten Themen im Unterricht ist wohl die loseste Verbindung. Eine Verflechtung von Unterricht und Exkursion findet dann statt, wenn einzelnen Exkursionen unabdingbare Teileinheiten des Unterrichts bilden. Ein Thema stellt somit eine Aufgabe dar, die im Projekt durch unterschiedliche Quellenarbeit und die verschiedenen Möglichkeiten des Arbeitens an einem Objekt, gelöst wird.
Wie bereits bei Punkt 1 geschildert wurde kann eine Exkursion, z.B. im Rahmen einer Unterrichtseinheit, an jeder Stelle stehen. Zu erwähnen bleibt jedoch, dass eine Exkursion in der Mitte einer Unterrichtsreihe für den Schüler am wertvollsten ist, da er bereits in das Thema eingeführt wurde und nun noch durch die Exkursion motiviert wird.
Das Thema einer Exkursion kann sich aus der vorherigen Unterrichtsreihe ergeben, kann aber auch speziell für die Exkursion neu formuliert werden. Häufig wird das Thema von dem einzelnen Exkursionsziel beeinflußt oder mitbestimmt, aber darf nicht mit den Lernzielen der Exkursion verwechselt werden. Die Lernziele komplettieren die Begriffstrias aus Thema und Exkursion. Was die kognitiven Lernziele betrifft, so können hier nicht von vornherein
allgemeine Lernzeile bestimmt werde, da sie doch sehr stark von jeweiligen Exkursionsthema abhängen. Anders sieht es da bei den instrumentalen Lernzielen aus. Hier lassen sich
allgemeine Ziele ohne weiteres formulieren und können in speziellen Bereichen ergänzt werden. Im folgenden die operationalen, bzw. instrumentalen Lernziele nach Hey:
- Übung verschiedener Wahrnehmungsfähigkeiten
- Eigenarbeit des Schülers durch Auffinden, Vergleichen, Ordnen und Erkennen von Zusammenhängen
- Entwickeln, Vertreten eigener Wertvorstellungen
- Eigene Erarbeitung von Beurteilungskriterien eines Objektes
- Entwicklung übertragbarer Methoden bei der Befragung von Kunst, Technik, Umwelt
- Entwicklung und Anwendung von Arbeitstechniken zum Erschließen historischer Zusammenhänge, sowie Wirkungszusammenhängen
7. Nachbereitung einer Exkursion
Die Nachbereitung beginnt bereits während der Exkursion, z.B. mit einem kritischen Gespräch zu einem Programmpunkt, oder mit Lob und Tadel. Eine solche „Manöverkritik“ könnte auch in Form eines abendlichen Colloquiums geschehen, aber weitaus sinnvoller für eine Nachbereitung ist ein Exkursionsprotokoll. So kann eine Gruppe für einen Tag der Exkursion ein solches Protokoll erstellen, in welchem die Durchführung an den Maßstäben der Planung und des Ergebnisses überprüft wird. Des weiteren besteht auch die Möglichkeit eine Gruppe für die gesamte Dauer der Exkursion abzustellen und die fortlaufend ein Protokoll erstellen, dafür aber von einigen Aufgaben der anderen Schüler befreit wird.
Die einfachste Form der Nachbereitung ist die Fortsetzung der vorher begonnenen Unterrichtsreihe. Alle Ergebnisse und Materialien können nun in den Unterricht integriert werden. Ein Bericht der Exkursion kann z.B. zu einer kleinen Ausstellung über die Exkursion werden. Vor allem Bild- und Kartenmaterial kann in solchen Fällen gut zum Einsatz kommen und Interessierte darauf aufmerksam machen. Eine solche Selbstdarstellung unterrichtet so Interessierte besser als ein Exkursionsbericht. Eine Kontrolle von Lernerfolgen, ob gesetzte Lernziele erreicht worden sind, kann durch Tests oder Fragebögen erfolgen. Diese können auch als Methode der Rückkopplung eingesetzt werden und liefern so Kritik an der Exkursion.
8. Möglichkeiten und Grenzen einer Exkursion
Abschließend werde ich nun Möglichkeiten aber auch Grenzen einer Exkursion aufzeigen. Fest steht, dass die historische Exkursion die für den Geschichtsunterricht wichtige Quellen untersucht, die sonst verloren gehen würden. Darüber hinaus besitzen die Objekte der Exkursion mehr historische Aussagekraft als ein simples Schulbuch. Die Arbeit an den Objekten der Exkursion stellt ein Musterbeispiel exemplarischen Lernens dar, wodurch einerseits Quellen erschlossen werden können die bereits didaktisch aufbereitet sind, sprich Museen oder Archive, aber andererseits auch historische Städten, z.B. eine Ruine, die sich der Schüler selbst erschließen muß. Befinden sich die Objekte in einer Isolierung, etwa in einem Museum, so versucht die Exkursion diese Aufzuheben und das Objekt in einen ursprünglichen Zusammenhang zu rücken und somit nach der historischen Aussage zu suchen. Gerade bei der Exkursion kommt es durch die Realbegegnung zu einer hohen Motivation der Schüler. Des weiteren erlaubt die Exkursion gute Möglichkeiten für viele Arbeitsformen, die in der Schule nicht so oft verwirklicht werden können, z.B. Gruppenarbeit. Mehr als in der Schule haben die Teilnehmer der Exkursion die Möglichkeit Arbeit, sowie Arbeitszeit selbst zu gestalten und das enge Zusammenarbeiten von Schüler und Lehrer ermöglicht statusunabhängige zwischenmenschliche Beziehungen und erfordert gegenseitige Rücksichtnahme und Disziplin.
Trotz all dieser enormen Möglichkeiten stehen diesen natürlich auch einige Grenzen gegenüber: Abhängig ist die historische Exkursion von den Quellen. Je schlechter ihre Zugänglichkeit, desto schlechter kann ein exemplarisches Arbeiten stattfinden. Zudem erschließt ein Objekt meistens nicht seine historische Aussage von sich selbst aus, es werden Hilfsmittel benötigt, auch für Ergänzungen und Kontrollen des Ergebnisses. Durch das Verlassen der Schule wird die Exkursion auch abhängig von äußeren Umständen wie Wetter und Angeboten vom Museen, Archiven etc. Schließlich ist die Exkursion auch nur eine Stufe im Prozeß des Lernens. Es bedarf einer Weiterführung der gewonnenen Erkenntnisse durch den schulischen Unterricht mit anderen Methoden und Medien.
Dennoch erschließt eine Exkursion neue Qualitäten für den Unterricht; Ein Versuch den Geschichtsunterricht auf eine breite Basis zu stellen und forschendes und entdeckendes Lernen der Schüler zu fördern.
„Das Verlassen der Schule - das entscheidende Kriterium der Exkursion – wird damit zum Eintritt in einen Raum unterrichtlicher Freiheit, der von den schulischen Zwängen noch weitgehend unberührt ist. Diese Freiheit aber ist eine Voraussetzung für jedes echte Lernen, das sich aus der Begegnung zwischen Mensch und Objekt entwickelt und nicht von außen aufgezwungen wird.“
Bibliographie:
- Hey, Bernd: Die historische Exkursion: zur Didaktik und Methodik des Besuchs historischer Stätten, Museen und Archive. Stuttgart, 1978.
- Niemetz, Gerold: Praxis Geschichtsunterricht. Methoden – Inhalte – Beispiele. Stuttgart, 1983.
- Niemetz, Gerold: Lexikon für den Geschichtsunterricht. Würzburg, 1984.
Häufig gestellte Fragen
- Was ist eine historische Exkursion?
- Eine historische Exkursion ist eine Form des historisch-politischen Unterrichts, bei der ein bestimmtes Thema durch die Arbeit an und mit (möglichst) originalen historischen Zeugnissen außerhalb der Schule erschlossen wird. Sie beinhaltet das Verlassen der Schule, um Zeugnisse der Geschichte aufzusuchen und bietet einen Kontrast zum papierdominierten Unterrichtsalltag.
- Welche Kategorien von Kulturlandschaften gibt es laut Martin Schwind?
- Martin Schwind nennt vier Kategorien: geschaffene Formen der Gegenwart, geschaffene Formen der Vergangenheit (noch lebendig), geschaffene Formen der Vergangenheit (nicht mehr lebendig) und geschaffene Formen der Vergangenheit (nur noch durch Spuren feststellbar).
- Was ist Museumspädagogik?
- Museumspädagogik ist die Zuwendung der Museen zu pädagogischen Aufgaben und didaktischen Fragestellungen. Sie erweitert die Aufgaben des Sammelns, Erhaltens und Ausstellens durch die Vermittlung des ausgestellten Objektes und dessen historischen, künstlerischen und funktionalen Sachverhalte.
- Welche Ziele verfolgt die Museumspädagogik?
- Die Museumspädagogik verfolgt drei wesentliche Ziele: die Ansprache möglichst vieler Besucher, die Erschließung der Museumsbestände in adäquater Form und die Anregung zu einer kritischen Auseinandersetzung mit den ausgestellten Objekten.
- Wie werden Objekte in Museen dem Besucher näher gebracht?
- Objekte in Museen werden durch gut platzierte und informierende Textschilder, Fotografien, Karten, Dias oder Filme erklärt und in ihren ursprünglichen Zusammenhang gebracht. Rekonstruktionen und Kopien ermöglichen den Schülern den taktilen Umgang mit den Exponaten.
- Wie können Archive als Exkursionsziel genutzt werden?
- Archive können durch einmalige Archivbesichtigungen, Archivausstellungen (Archivalienausstellung oder Archivausstellung mit modernen Informationsträgern) für Schüler zugänglich gemacht werden. Wichtig ist, dass die Ausstellungen lehrplanorientiert sind und einen unmittelbaren Zugang zur Geschichte der engeren Heimat vermitteln.
- Was sind die didaktischen Möglichkeiten einer historischen Exkursion?
- Die didaktischen Möglichkeiten umfassen Motivation durch Verlassen der Schule und Realbegegnung, Zusammenarbeit von Lehrer und Schüler, Arbeit am Objekt (Beschreiben, Anfassen, Bauen, Wandern) und Interpretationen in Unterrichtsgesprächen.
- Welche Phasen umfasst die Arbeit am Objekt?
- Die Arbeit am Objekt umfasst Fragestellung/Arbeitshypothese, Reflexion möglicher Methoden, Datenerhebung und Aufzeichnung, Interpretation/Bewertung/Methodenkritik und Feststellung von Regelhaftigkeiten.
- Wie sollte eine Exkursion geplant und vorbereitet werden?
- Die Exkursion sollte in den Unterricht integriert werden und ein Thema haben, das sich aus der vorherigen Unterrichtsreihe ergibt oder speziell für die Exkursion formuliert wird. Wichtig sind die Festlegung von kognitiven und instrumentalen Lernzielen.
- Wie kann eine Exkursion nachbereitet werden?
- Die Nachbereitung kann durch ein Exkursionsprotokoll, die Integration der Ergebnisse und Materialien in den Unterricht, eine Ausstellung über die Exkursion oder durch Tests und Fragebögen zur Erfolgskontrolle erfolgen.
- Welche Möglichkeiten und Grenzen hat eine Exkursion?
- Zu den Möglichkeiten zählen die Untersuchung wichtiger Quellen, exemplarischen Lernens, hohe Motivation, viele Arbeitsformen. Zu den Grenzen zählen die Abhängigkeit von der Zugänglichkeit der Quellen, äußeren Umständen und die Notwendigkeit der Weiterführung der Erkenntnisse durch den schulischen Unterricht.
- Quote paper
- Harald Rester (Author), 2002, Die Exkursion im Geschichtsunterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/107969