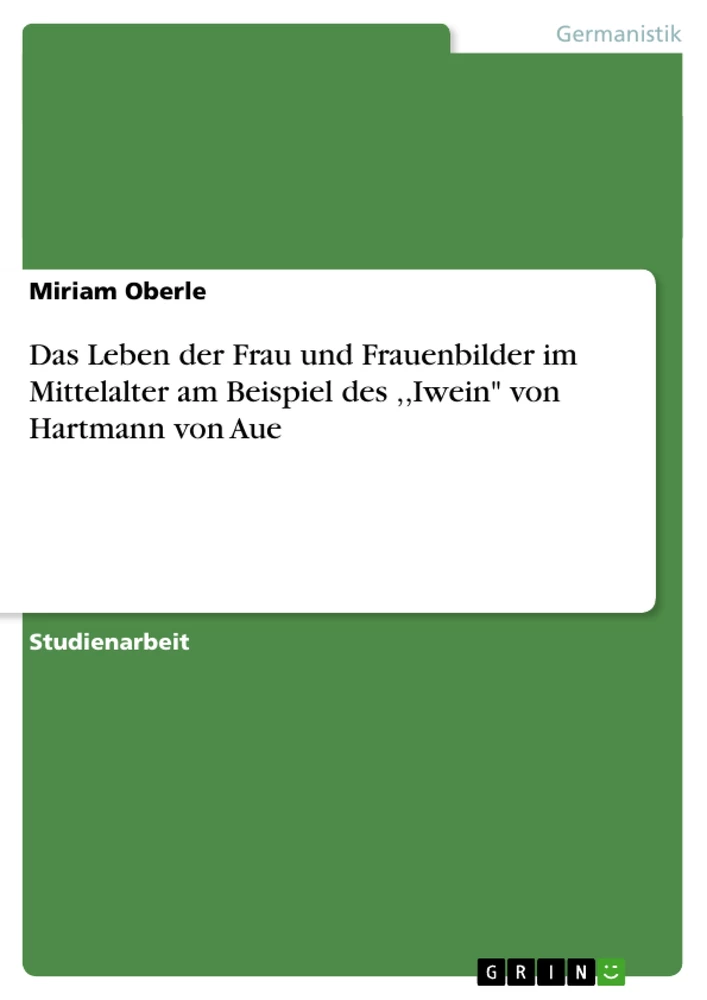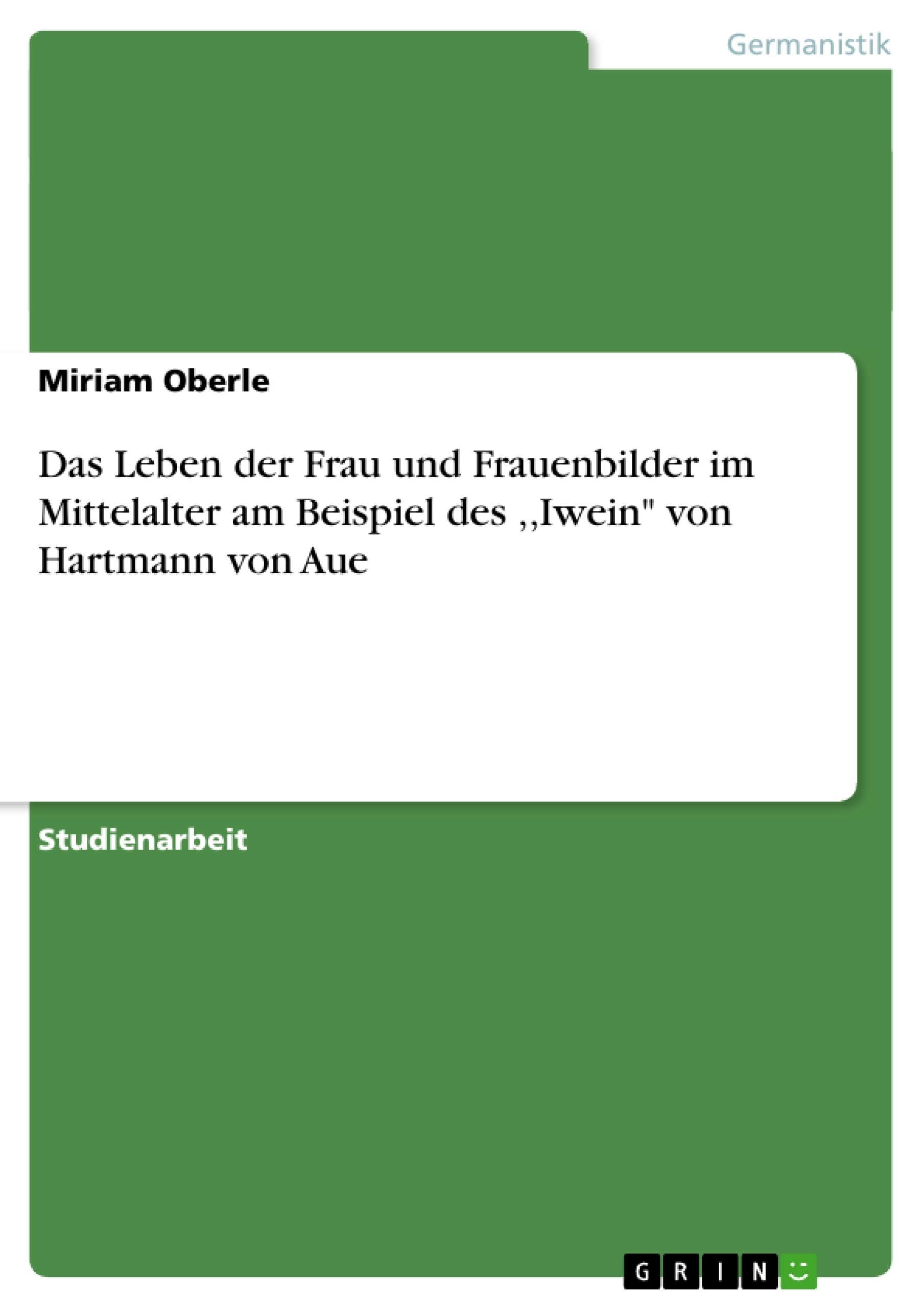Inhaltsverzeichnis
1 HartmannsIwein
1.1 Biographisches und zeitliche Einteilung
1.2 Inhalt und Intention
1.3 Minne und das höfische Modell im „Iwein”
1.3.1 Hartmann, der Hof und die Minne
2 Liebe, Ehe und Tugenden im Mittelalter
2.1 Laudine, wîp und künegin
2.1.1 Laudines Eheverständnis
2.1.2 Iweins Treuebruch und Laudines Problematik
2.2 Männerblicke oder Iwein und die Minne
2.3 „Des Weibes Art und Tugenden”
3 Zeit der Frauen?
4 Literaturverzeichnis
4.1 Primärliteratur
4.2 Sekundärliteratur
1 Hartmanns Iwein
1.1 Biographisches und zeitliche Einteilung
Da es weder eine urkundliche Erwähnung noch außerliterarische Quellen gibt, kann Hartmann von Aues Leben und Werk nicht präzise eingeteilt werden. Die Lebensdaten belaufen sich auf den Zeitraum von etwa 1160/70-1210.
„Iwein” ist Hartmann von Aues letztes Werk. Da es in Wolfram von Eschenbachs „Parzival” erwähnt wird, das nach 1205 geschrieben wurde, siedelt man den „Iwein” um 1200 an.
Vorbild für Hartmanns „Iwein” ist Cretien de Troyes „Ywain”. Die Geschichte des Iwein bildet die klassische Form des mittelalterlichen Versromans in Frankreich und Deutschland, d.h. die Hervorhebung des Aventürenweges eines bisher kaum bekannten Ritters am Artushof (wie. z.B. „Erec”, „Parzival”, etc.).
1.2 Inhalt und Intention
Wie schon in anderen Werken von Hartmann von Aue geht es auch hier um den Läuterungs– bzw. Selbstfindungsprozeß des Helden. Am vermeintlichen Höhepunkt im Leben des Protagonisten fällt er in eine Sinnkrise und muß zunächst alles wieder verlieren. So auch Iwein. Schon kurz nach der Hochzeit mit Laudine steht er zwischen zwei Wertesystemen - auf der einen Seite steht der Artushof, der êre, rîterschaft und âventuire verkörpert, auf der anderen Seite der Laudinehof, der für minne und die Pflichten eines Ehemanns und Grundherren, den wirt, steht.
Die Frage, die sich in dieser Arbeit stellt, geht weg vom eigentlichen Helden
Iwein und beschäftigt sich mit der Rolle der Frau bzw. mit dem Frauenbild innerhalb des Romans und während des Mittelalters.
Was davon ist Dichtung und wieviel davon spiegelt das wirkliche Leben der Frauen dieser Zeit wieder?
Die Forschung ist sich einig, daß es sehr schwer ist, sich ein Bild der Frau im Mittelalter zu schaffen, da Frauen, wenn überhaupt, oft in einem klerikalen Kontext (und somit negativ oder verklärt) erwähnt wurden. Sich ausschließ- lich auf die Darstellung von Frauen in der Dichtung zu berufen ist in soweit fragwürdig, da hier oft eine Idealisierung der Frau stattfindet und die Texte meist von Männern für Männer geschrieben wurden und diese auch oft zur puren Unterhaltung, was der „Wahrheitsfindung” nicht unbedingt dienlich ist. Die höfische Epik und so auch „Iwein” gewährt lediglich einen Einblick in die feudale Oberschicht. Da es keine eindeutigen Quellen gibt, bleibt die Frage offen, wie die Frauen selbst ihr Leben und ihre Rolle empfunden haben — aber man kann den Versuch machen den Status der Frau zu erahnen, indem man epische, symbolische, rechtliche und geschichtliche Aspekte heranzieht.
1.3 Minne und das höfische Modell im „Iwein”
Das Grundprinzip des höfischen Modells ist recht simpel: Im Mittelpunkt steht eine Dame, die verehrt wird. Oft handelt es sich auch um verheiratete Damen des Hofes, deren Gunst die Junggesellen erlangen wollen. Meist versteht man unter Minne die fleischliche Begierde. Die Dame ist die Herrin des Hauses und der Junggeselle ordnet sich ihr als treuer Vasall unter. Er gibt sich ihr sozusagen als Geschenk und wird ihr Leibeigener. Später wird die Minne jedoch zum Vorspiel der Ehe.
1.3.1 Hartmann, der Hof und die Minne
Die Auseinandersetzung mit der Minne ist bei Hartmann vor allem die Auseinandersetzung mit dem Verhältnis zwischen Mann und Frau. „Für Hartmann aber (und nach ihm für Wolfram) ist die eheliche Liebe die eigentliche
„hohe Minne”. Nicht unerfüllte Sehnsucht, sondern Konflikt und Beziehung zwischen Mann und Frau sind es, welche sittigend und erzieherisch wirken.”1 So ist Hartmanns „Iwein” nicht nur die Skizzierung des höfischen Modells, sondern das Idealbild einer Beziehung zwischen Mann und Frau, das sich gegenseitig bedingt, lenkt und erzieht. Und er beschreibt immer wieder die Tugenden, die Frau und Ritter haben sollten.
in liebte hof und den lîp manec maget unde wîp,
die schœnsten von den rîchen.2
Männer und Frauen,
die schönsten aus den ganzen Ländern, machten den Hof und das Leben freundlich
[...]dise sprâchen wider diu wîp, dise banecten den lîp,
dise tanzten, dise sungen,
dise liefen,dise sprungen,dise hôrten seitspil,[...]3
die einen sprachen mit den Frauen, andere tummelten umher,
die einen tanzten, andere sangen, diese liefen, jene sprangen,
andere lauschten dem saitenspiel,[...]
Betrachtet man diese Beschreibungen, so liegt es nahe, zu glauben, daß es den Frauen (zumindest den Edelfrauen) recht gut geht und sie durch Ablehnen oder Annehmen der Minnewerbung eine gewisse Macht besitzen. Im alltäglichen Leben jedoch ist die Geringschätzung der Frau und Gewalt nicht unüblich. Zumindest jedoch entwickelt sich durch das höfische Modell eine Aĉhtung von gewaltsamer Eroberung, sprich Vergewaltigung. Stattdessen
wird die Werbung reglementiert und in Etappen des Hofierens eingeteilt. Doch hatte eine Edelfrau die freie Wahl? Waren Liebesheiraten möglich? Ehe bedeutete nicht gleich Liebe, schloß sie aber auch nicht aus. Im 11. und 12.Jahrhundert liegt die Kontrolle der Ehe immer mehr in der Hand der Kirche. Auch sie bestimmt den Zweck und Wert der Ehe. Ihr alleiniger Zweck liegt in der Sicherung der Nachkommen, und sie ist ein Sakrament, dem man Treue leistet. Dennoch gilt, zumindest theoretisch, das Prinzip des gegenseitigen Einverständnisses und sie ist grundsätzlich auch unauflöslich. Die Praxis sah natürlich oft anders aus. „Bei den Adelsgeschlechtern standen die Kinder, vor allem die Mädchen, im Dienste der Macht und des Reichtums. Endogamie, Verstoßung (meist wegen Unfruchtbarkeit der Frau) und Wiederverheiratung begründete hier eine „fortwährende Polygamie”, die im Interesse der Erbfolge strategisch eingesetzt wurde.”4
[...]
1Eva-Maria Carne: Die Frauengestalten bei Hartmann von Aue, S.7
2Iwein,V 45-47
3Ebenda, V 65-69
Häufig gestellte Fragen zu Hartmanns Iwein
Worum geht es in Hartmanns Iwein?
Hartmanns Iwein ist ein mittelalterlicher Versroman, der den Läuterungs- und Selbstfindungsprozess des Ritters Iwein thematisiert. Iwein gerät in eine Sinnkrise und muss zunächst alles verlieren, bevor er sich selbst wiederfinden kann. Ein zentrales Thema ist das Verhältnis zwischen Iweins Pflichten als Ehemann und Grundherr (wirt) gegenüber seiner minne zu Laudine und seinem Streben nach êre, rîterschaft und âventuire am Artushof.
Wann wurde Hartmanns Iwein geschrieben?
Da es keine urkundlichen Erwähnungen gibt, kann das Leben und Werk Hartmanns von Aue nicht präzise datiert werden. Es wird angenommen, dass Iwein um das Jahr 1200 entstanden ist, da es in Wolfram von Eschenbachs Parzival erwähnt wird, das nach 1205 geschrieben wurde.
Was ist die Intention des Romans?
Neben der Darstellung des Läuterungsprozesses des Helden thematisiert die Arbeit die Rolle der Frau und das Frauenbild im Roman und im Mittelalter im Allgemeinen. Die Arbeit fragt: Was davon ist Dichtung und wieviel davon spiegelt das wirkliche Leben der Frauen dieser Zeit wieder?
Was ist Minne im Kontext von Iwein?
Minne im höfischen Kontext bezeichnet die Verehrung einer Dame, oft einer verheirateten Frau am Hof. Der Junggeselle unterwirft sich ihr als Vasall und dient ihr treu. Hartmann sieht die eheliche Liebe als die eigentliche hohe Minne, wobei Konflikte und Beziehungen zwischen Mann und Frau erzieherisch wirken.
Welche Rolle spielt das höfische Modell in Iwein?
Das höfische Modell beeinflusst die Darstellung der Beziehung zwischen Mann und Frau. Es betont die Tugenden, die sowohl Frau als auch Ritter haben sollten, und reglementiert die Werbung um die Dame in Etappen des Hofierens. Die höfische Epik gewährt dabei einen Einblick in die feudale Oberschicht.
Was ist die Bedeutung der Ehe im Mittelalter und im Kontext des Romans?
Die Ehe im Mittelalter, vor allem in Adelskreisen, diente oft strategischen Zwecken zur Sicherung von Macht und Reichtum. Obwohl die Kirche das Prinzip des gegenseitigen Einverständnisses und die Unauflöslichkeit der Ehe betonte, wurden in der Praxis oft politische Erwägungen berücksichtigt. Im Roman spiegelt sich dies in der Frage wider, ob Liebesheiraten möglich waren und wie die Frauen ihre Rolle in der Ehe empfanden.
Welche Quellen werden zur Analyse des Frauenbilds im Mittelalter herangezogen?
Die Analyse des Frauenbilds im Mittelalter stützt sich auf verschiedene Quellen, darunter epische, symbolische, rechtliche und geschichtliche Aspekte. Die Forschung betont die Schwierigkeit, ein umfassendes Bild zu gewinnen, da Frauen oft nur in einem klerikalen Kontext erwähnt werden und die Dichtung oft eine Idealisierung der Frau darstellt, die von Männern für Männer geschrieben wurde.
Wer ist Laudine?
Laudine ist Iweins Ehefrau. Sie verkörpert die Pflichten eines Ehemanns und Grundherren, den wirt.
- Arbeit zitieren
- Miriam Oberle (Autor:in), 2001, Das Leben der Frau und Frauenbilder im Mittelalter am Beispiel des ,,Iwein" von Hartmann von Aue, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/107797